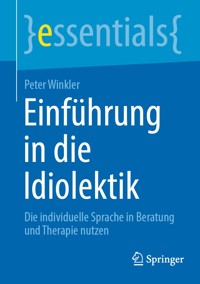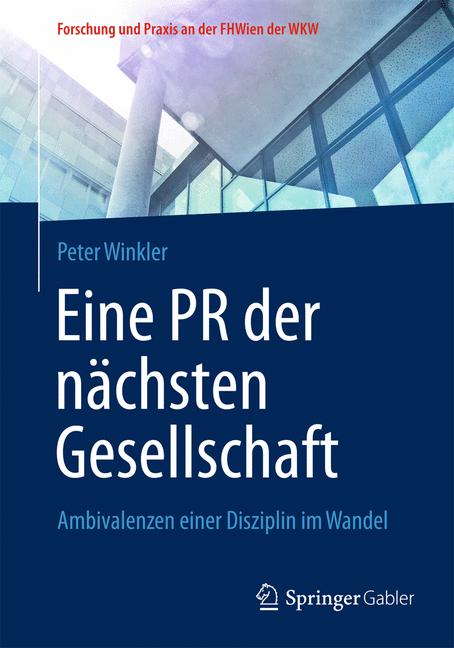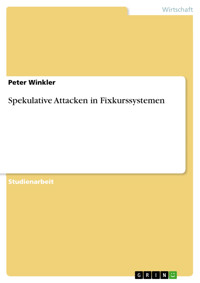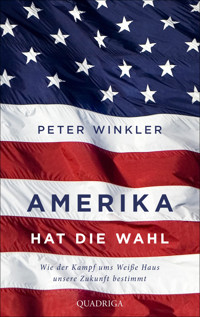
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im November 2024 wird in den USA gewählt. Es wird das Schicksalsjahr für Amerikas Demokratie, denn Donald Trump hat 2020/21 ein Tabu gebrochen: Er versuchte, den friedlichen Machttransfer aufzuhalten und ließ fanatische Fans das Kapitol stürmen. Wer sind die wichtigsten politischen Köpfe und wofür stehen sie? Wird Biden noch einmal antreten? Und warum verschwand die Hoffnungsträgerin Kamila Harris in der Bedeutungslosigkeit? Was haben Deutschland, Europa und die Weltpolitik von den USA nach den Wahlen zu erwarten? Die Außenpolitik, die Wirtschaftsbeziehungen und das Verhältnis zu China werden maßgeblich von der nächsten US-Regierung geprägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumEinleitung: Die Qual dieser ganz besonderen Wahl1. Der Tabubruch und seine Folgen1.1. Ein Schock, der rasch überwunden wird1.2. Neue Gipfel der Angstmacherei1.3. Lügen können richtig viel Geld kosten1.4. Warum sollte Trump eine Niederlage akzeptieren?1.5. Ein unheimliches drittes Szenario1.6. Wie wahrscheinlich ist ein Chaos?1.7. Portland und Kenosha: Vorboten der neuen Normalität?1.8. Für Destabilisierung braucht es keinen Bürgerkrieg1.9. Was bedeutet das für Amerikas Verbündete?2. Einmaleins des amerikanischen Wahlkampfs2.1. Ohne Koalitionen kein Sieg2.2. Die riskante Wette mit Joe Biden2.3. Das Dilemma mit Donald Trump2.4. Je mehr, desto besser?3. Wer und was besondere Aufmerksamkeit verdient3.1. Der Titelverteidiger3.2. Der Herausforderer3.3. Kamala Harris: nicht mit ihr, aber auch nicht ohne sie3.4. »Florida Man« Ron DeSantis verliert seinen Glanz3.5. Nikki Haley: die »Erwachsene im Raum«?3.6. Drittkandidaten mit hoher Sprengkraft4. Was der Kampf ums Weiße Haus für Europa bedeutet4.1. Wie eine Regierung Trump 2.0 aussehen könnte4.2. Wären andere Republikaner wesentlich anders?4.3. Sicherheitspolitik: mit Trump mehrvom Gleichen4.4. DeSantis auf dem internationalen Parkett4.5. Selbstfindungsprozess der Republikanischen Partei4.6. Joe Bidens umfassendes Heilsversprechen5. Zu viel Polarisierung zerreißt die Demokratie5.1. Vertrauensverlust auf beiden Seiten5.2. Wer will, dass der Kongress nichts zustande bringt?5.3. Vorwahlen können undemokratisch sein5.4. Mehrheiten mit dem Zeichenstift5.5. »Wir« und »die anderen«: Stammesdenken im Cyber-Zeitalter5.6. Das große »Sortieren« der Bevölkerung5.7. Die Landbevölkerung unter demografischem Druck5.8. Hohe Bevölkerungsdichte in »blauen Zonen«5.9. Nicht jede Stimme zählt gleich viel5.10. Der Stadt-Land-Graben wird politisch6. Nichts brennt wie die Neugier: Warum Prognosen so schwierig sind6.1. Falsche Freunde: vermeintliche Gewissheiten6.2. Demografie allein reicht nicht6.3. Von der Arbeiter- zur Akademikerpartei6.4. Wer ist am Kulturkampf schuld?6.5. Personenkult gegen Themenkult6.6. Wie lange halten die Institutionen?DankeswortAnmerkungenÜber dieses Buch
Im November 2024 wird in den USA gewählt. Es wird das Schicksalsjahr für Amerikas Demokratie, denn Donald Trump hat 2020/21 ein Tabu gebrochen: Er versuchte, den friedlichen Machttransfer aufzuhalten und ließ fanatische Fans das Kapitol stürmen. Wer sind die wichtigsten politischen Köpfe und wofür stehen sie? Wird Biden noch einmal antreten? Und warum verschwand die Hoffnungsträgerin Kamala Harris in der Bedeutungslosigkeit? Was haben Deutschland, Europa und die Weltpolitik von den USA nach den Wahlen zu erwarten? Die Außenpolitik, die Wirtschaftsbeziehungen und das Verhältnis zu China werden maßgeblich von der nächsten US-Regierung geprägt.
Über den Autor
Peter Winkler hat über drei Jahrzehnte als Auslandskorrespondent der NZZ berichtet, seit 2011 aus den USA. In dieser Zeit hat er neben drei Präsidenten Trump, Obama und Biden auch die immer stärker werdende politische und gesellschaftliche Polarisierung miterlebt. Er ist bekannt für seine schonungslosen Analysen, die er seinen Leser:innen auf verständliche Art vermitteln kann. Winklers Artikel gehören zu den meistgelesenen der NZZ denn er berichtet unabhängig, anschaulich und direkt.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG,Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Burkard Miltenberger, Berlin
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Billeunter Verwendung eines Motivs von © shutterstock: Digital Media Pro
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4876-6
quadriga-verlag.de
lesejury.de
Einleitung: Die Qual dieser ganz besonderen Wahl
»Amerika hat die Wahl« – und das in vielerlei Hinsicht. Buchstäblich am 5. November, wenn das grosse Finale des Wahlzyklus 2024 über die Bühne gehen soll. Aber statt freudiger Erwartung herrscht im Publikum im Vorfeld vielmehr Unmut. Da stehen sich aller Wahrscheinlichkeit nach zwei alte weiße Männer gegenüber, der amtierende und ein ehemaliger Präsident, die eine Mehrheit der Amerikaner eigentlich gar nicht mehr wählen möchte. Der eine wäre bei seiner Vereidigung 82 Jahre alt, der andere 79. Ist es so schwierig, anderes, vielleicht gar jüngeres Personal zu finden?
Wir wissen vermutlich immer noch nicht, ob es wirklich zu diesem Duell kommen wird. Im amerikanischen Wahlkampf ist vieles möglich. Doch selbst wenn im November Joe Biden und Donald Trump zur Wahl antreten, steht mehr auf dem Spiel als nur die Frage, welcher der beiden der westlichen Führungsmacht vorsteht. Amerika hat auch die Wahl, ob es den Aufbruch in eine Zukunft wagen will, in der es auf seine vielfältig zusammengesetzte Bevölkerung stolz ist und in der zwar ein gesunder Wettbewerb herrscht, sich die verschiedenen Gruppen aber nicht stets neidisch belauern und missgünstig gegenüberstehen. Oder wollen sich die USA doch lieber noch einmal rückwärts wenden, vergangene Größe herbeisehnen und die Zeiten der unbestrittenen weißen Vorherrschaft beschwören?
Amerika hat auch die Wahl, ob es seine Führungsaufgabe im Lager der freiheitlichen Demokratien in einem kooperativen oder einem konfrontativen Stil wahrnehmen will – und nicht zuletzt hat es die Wahl, ob es diese Rolle überhaupt noch spielen will. Das sind Fragen, die auf Amerika zukommen, ob nun einer der zwei alten weißen Männer Präsident wird oder doch noch jemand anderer. Und es sind Fragen, die uns auch diesseits des Atlantiks bewegen und bewegen müssen.
In manchen europäischen Staaten scheinen die Meinungen allerdings bereits gemacht: Da heißt es, das Duell der Alten sei schlechte Werbung für die Demokratie, die im letzten Jahrzehnt von autoritären »Gegenmodellen« ohnehin immer stärker unter Druck geraten ist. Dass ein Duell stattfinden könnte, das eigentlich die Mehrheit nicht will, wird häufig den amerikanischen Republikanern und ihrer Hinwendung zu Donald Trump angelastet. Sie hätten die Chance verpasst, sich von Trump zu emanzipieren, dann hätten sie eine unbelastete Figur in eine aussichtsreiche Position für die Wahl im Herbst bringen können. Und dann hätte vielleicht auch Biden der Versuchung widerstehen können, trotz seiner unübersehbaren Schwäche erneut anzutreten. Biden fühlt sich gegenüber dem Mann, den er aus dem Weißen Haus verdrängte, im Vorteil. Und offensichtlich glauben auch viele Demokraten, dass ein Mann mit so viel Gepäck wie Trump unmöglich noch einmal gewinnen könne.
Genau deshalb wollen Biden und die Mehrheit der Parteiführung offenbar im November den dramatischen Showdown des klassischen Westerns inszenieren. Dafür kamen ihnen die verschiedenen Strafverfahren gegen Trump gerade recht. Sie wussten natürlich, dass die Anklagen im gegnerischen Lager zu einem Wagenburg-Effekt führen würden, dass sich die Republikaner um Trump scharen würden und dass es für jeglichen Herausforderer in der Republikanischen Partei umso schwerer werden würde.
Trotz beunruhigender Umfrageresultate in einigen kritischen Bundesstaaten rechnen sich die Demokraten für die Wahl im November 2024 deshalb Vorteile aus. Die Medienberichte über die Prozesse oder deren Vorbereitungen sollen dafür sorgen, dass Trumps Tabubruch nach der letzten Präsidentenwahl in den Schlagzeilen bleibt. Er selbst wird keine Gelegenheit auslassen, die Mär von der »gestohlenen Wahl« zu verbreiten und sich als Opfer dunkler Machenschaften darzustellen. Er soll dazu provoziert werden, immer schrillere Töne anzuschlagen, was in den letzten Monaten des Jahres 2023 bereits unüberhörbar der Fall war. Das müsste ihn, so lautet das Kalkül der Demokraten, für Wechselwähler und Unabhängige unwählbar machen. Zugleich soll es die potenziellen demokratischen Wählerinnen und Wähler derart aufschrecken, dass sie hoch motiviert an die Urnen strömen.
Sollte der Plan der Demokraten aufgehen, würde Trump sowohl rechtlich als auch politisch zur Verantwortung gezogen: einerseits mit möglichen Schuldsprüchen vor Gericht, anderseits mit einer weiteren Wahlniederlage. Das wäre, so hoffen sie, ein wirksames Mittel der Abschreckung gegen all jene, die sich Trump und dessen Verhalten nach seiner Wahlniederlage 2020 zum Vorbild machen wollen. Das einzige Problem dieser Wette ist, dass auch ein ganz anderer Ausgang möglich ist. Ein Sieg Trumps hätte verheerende Folgen. Eine Wiederwahl würde ihn nicht nur für geraume Zeit juristisch unantastbar machen, sie würde ihn und seinen Versuch, die friedliche Übergabe der Macht zu torpedieren, auch politisch rehabilitieren.
Trump hat bereits mehrfach damit gedroht, dass er sich im Fall eines Wahlsiegs rächen werde. Er schiebt vor, Unrecht vergelten zu wollen, das seinen Wählerinnen und Wählern angetan worden sei. Aber es ist völlig klar, dass es ihm nur um seine eigene Person geht. Es ist kaum vorstellbar, dass Trump nicht versuchen würde, diese Drohungen wenigstens zum Teil wahrzumachen. Es könnte dann in Amerika zum neuen Normalzustand werden, dass jene an der Macht den politischen Gegner mit Strafverfahren überziehen.
Wenn es denn so offensichtlich ist, was die Demokraten vorhaben, so fragt man sich unwillkürlich, warum die Republikaner das Spiel mitspielen. Dafür gibt es eine Reihe von Erklärungen. Die einfachste ist, dass ein wesentlicher Teil der konservativen Wählerschaft kompromisslos hinter Trump steht. Dieser hatte die Republikanische Partei mit seinem Sieg in den Vorwahlen von 2016 gekapert wie ein Pirat. Die unfreundliche Übernahme war relativ einfach, weil die Partei sich in einer Identitätskrise befand. Vier Jahre zuvor, 2012, hatte sie nämlich gegen einen Präsidenten verloren, der wegen des schleppenden Gangs der Wirtschaft und wegen der damals äußerst unbeliebten Reform der Krankenversicherung durchaus zu schlagen gewesen wäre. Aber Barack Obama siegte, dank einer Regenbogenkoalition mit Mehrheiten bei den Frauen, den jungen und den nicht weißen Wählern.1 Die republikanische Führung stellte ihre Strategie daraufhin auf den Prüfstand. In ihrer Analyse kam sie zum Schluss, die Partei müsse sich gegenüber genau diesen Wählergruppen stärker öffnen, um wieder wachsen und sich reale Siegeschancen erarbeiten zu können.2
Doch die Parteibasis hatte andere Pläne. Unter den Bewerberinnen und Bewerbern, die vier Jahre später versuchten, den Sprung ins Weiße Haus zu schaffen, wählten sie exakt denjenigen, der von einer Öffnung der Partei für neue Bevölkerungsschichten am wenigsten hielt. Ganz im Gegenteil – Donald Trump wandte sich vornehmlich an die Weißen und schaffte es, diese immer noch größte Wählergruppe in einer Art zu mobilisieren, die kaum jemand für möglich gehalten hatte.
Die Übernahme der Republikanischen Partei durch Trump war auch darum so einfach, weil es die beiden großen Parteien in Amerika in den letzten Jahrzehnten zuließen, dass von außen kommende, manchmal intransparente Kräfte über ihre Geldspenden sehr viel Einfluss erhielten. Die Ohnmacht der Parteien, unerwünschte Quereinsteiger abzuwehren, zeigte sich 2016 exemplarisch. Trump, der republikanische Kandidat, hatte seine Parteizugehörigkeit wie die meisten seiner Ansichten immer wieder mal gewechselt; er hatte sich auch schon als Demokrat und als Unabhängiger registrieren lassen. Bei den Demokraten war Bernie Sanders, der plötzlich zum überraschend starken Rivalen Hillary Clintons aufstieg, nicht einmal Parteimitglied.
Amerika ist nicht Europa
Wenn ausländische Journalisten und Analytiker vor einer Wahl jeweils die Parteiprogramme mit der Lupe nach politischem Sprengstoff absuchen und atemlos darüber berichten, wenn sie welchen gefunden haben, bedeutet dies vor allem eines: Sie haben das amerikanische Parteiensystem missverstanden, weil sie es aus einer europäischen Perspektive heraus betrachteten. Die beiden großen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, unterscheiden sich jedoch fundamental von ihren europäischen Schwestern. Früher waren sie in erster Linie bloße »Wahlmaschinen« gewesen. Die Spannweite ihrer Flügel war dermaßen groß, dass sich darunter problemlos vier oder mehr Parteien im westeuropäischen Sinn wiederfinden konnten. Eine gemeinsame ideologische Ausrichtung existierte kaum.
Das hat auch mit ihrer etwas eigenartigen Führungsstruktur zu tun. Formell stehen den Parteien zwar Leitungsausschüsse vor, das Republican National Committee (RNC) und das Democratic National Committee (DNC). Aber deren Aufgabe ist grundsätzlich administrativer Natur. Die wirklichen Chefs der amerikanischen Parteien sind amtierende Präsidenten oder die Präsidentschaftskandidaten, wenn ihre Nominierung feststeht. Selbst wenn diese an Macht und Einfluss verlieren, wenn sie zu »lame ducks« werden, zu lahmen Enten, die nichts mehr bewirken können, droht in der Regel keine Gefahr von der formellen Parteiführung in den Leitungsausschüssen. In diesem Fall positionieren sich eher Parteikolleginnen und -kollegen im Kongress oder einflussreiche Gouverneure, um personelle Fragen zu klären. Doch solange sie noch Autorität haben und politisches Gewicht auf die Waage bringen, lassen sich Präsidenten ganz sicher nicht von einem Parteiprogramm vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben.
Für Kandidaten sind solche Programme eigentlich nur bis zum Wahltag interessant. Mit einem Verweis auf die eine oder andere Passage im Parteiprogramm können sie den verschiedensten Interessengruppen einigermaßen glaubwürdig versichern, dass sie deren Anliegen gehört, ernst genommen und auf die politische Tagesordnung gesetzt haben. Dabei gibt es allerdings einen Abnutzungseffekt, denn an Interessengruppen mangelt es auch in Amerika nicht. Die Programme gleichen darum Listen für den Großeinkauf: Es gibt kaum einen Artikel des täglichen Bedarfs, der nicht darauf zu finden ist. Die Folge ist, dass das Wahlprogramm noch mehr an Relevanz verliert.
Das hat sich bis heute nicht wesentlich geändert, auch wenn die Spannweite der Parteiflügel stark geschrumpft ist und es zwischen den Parteien kaum noch ein Überlappen in der Mitte gibt. Trump ging 2020 noch einen Schritt weiter. Er verzichtete darauf, überhaupt ein Parteiprogramm ausarbeiten zu lassen. Vielleicht ist es auf seinen unternehmerischen Hintergrund zurückzuführen, dass er am Sinn einer arbeits- und kostenintensiven Übung zweifelte, die eher früher als später sowieso Makulatur wird.
Trumps Verzicht auf ein Programm ist aber auch die Konsequenz eines anderen, immer stärker spürbaren Trends bei den amerikanischen Präsidentenwahlen: Der wichtigste Programmpunkt lautet »Siegen« – oder wenigstens »Verhindern, dass der Gegner gewinnt«. Dazu reicht es, Reizthemen zu bewirtschaften, damit den potenziellen Wählerinnen und Wählern möglichst der Schreck in die Glieder fährt. Das gezielte Schüren von Furcht und Abneigung mag langfristig für die Demokratie schädlich sein, leider funktioniert die Methode jedoch ziemlich gut, und zwar nicht erst, seit Donald Trump am 16. Juni 2015 im New Yorker »Trump Tower« die goldene Rolltreppe hinunterglitt, um seine Bewerbung für das Präsidentenamt bekanntzugeben. Henry Adams, ein Spross jener neuenglischen Familie, die im 18. und 19. Jahrhundert zwei amerikanische Präsidenten gestellt hatte, erkannte dies schon vor über 100 Jahren. In seiner Autobiografie mit dem Titel »The Education of Henry Adams«, für die er 1919 posthum den Pulitzer-Preis erhielt, schrieb er über seine Heimat: »Politik, egal welcher Ausrichtung, war in der Praxis schon immer das systematische Organisieren von Hass.«3
Politische Geiselhaft
Unter Trumps Führung ist die Grand Old Party, wie sich die Republikanische Partei immer noch gerne nennt, unberechenbarer und aggressiver geworden. Sie hat sich Trump ausgeliefert, weil dieser in der Basis auf eine große, überaus loyale Gefolgschaft zählen kann. Unter jenen, die am Vorwahlprozess teilnehmen, wird ihr Anteil auf mindestens 30 bis 40 Prozent geschätzt. Die angebliche Politisierung der Justiz durch die Demokraten hatte dann den von den Demokraten gewünschten Effekt: Sie trieb die Republikaner in die Arme Trumps. Die erste Vorwahl in Iowa am 15. Januar zeigte, dass dieser praktisch ohne Anstrengungen 51 Prozent der Stimmen ergattern konnte. Sein stärkster Rivale, Gouverneur Ron DeSantis aus Florida, hatte monatelang sämtliche Countys von Iowa bereist, immerhin 99 an der Zahl, und sich ganz auf den Bundesstaat konzentriert. Er konnte nicht ein einziges County für sich entscheiden und landete weit abgeschlagen mit gut 21 Prozent der Stimmen auf Platz 2. Man könnte einwenden, dass Iowa zwar den Reigen der Vorwahlen eröffnete und darum viel Aufmerksamkeit erhielt, dass aber die Resultate aus dem betont ländlichen, weissen und religiösen Iowa nie besonders relevant seien. Dies ist insofern richtig, als ein Sieg in Iowa noch nicht viel über die Chancen im November aussagt. Aber Tatsache ist, dass Niederlagen in Iowa schon viele Ambitionen auf das Präsidentenamt zunichte machten, ganz genau so, wie es DeSantis widerfuhr.
Die republikanischen Wähler über einen Leisten zu schlagen und als reaktionäre Rassisten abzustempeln ist nicht zielführend. Im gegenwärtig gültigen System, bei dem die Präsidentschaftskandidaten in Vorwahlen im ganzen Land gekürt und dann an einem Parteikonvent formell bestätigt werden, ist es sehr schwierig, sich gegen eine solche Sperrminorität von 30 bis 40 Prozent durchzusetzen. Trump hätte nur erreichen müssen, dass seine Rivalen einander den Rest der Stimmen streitig machen, dann würde keiner von ihnen auch nur entfernt an seine Werte herankommen. Wir wissen, dass es anders kam. Selbst als er nur noch eine Konkurrentin hatte, schaffte er es mühelos, die Mehrheit zu ergattern. Und sogar wenn in konservativ gesinnten Kreisen eine Mehrheit offen für eine alternative Kandidatur gewesen wäre, hätte sie schlechte Karten, um sich gegen die Hindernisse des Vorwahlsystems durchzusetzen. Die Gründe dafür werden in den Kapiteln fünf und sechs breiten Raum einnehmen.
Die Demokraten spielen auf ihre Weise mit. In ihrer Bewertung des Geschehens kann es ihnen nur nützen, wenn Trump wieder zum offiziellen Kandidaten nominiert wird. Schließlich hat er die Republikaner 2018 und 2020 in eine Niederlage geführt und 2022 dafür gesorgt, dass ihr Ergebnis bei den Kongresswahlen weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Mit dem Verweis auf die Erstürmung des Kapitols in Washington am Dreikönigstag 2021 setzen die Demokraten alles daran, Trump als Anführer eines unkontrollierbaren Mobs darzustellen. Dafür werfen sie alles Republikanische in einen Topf, alles wird – unter Berufung auf Trumps Losung »Make America Great Again« – mit der leicht erkennbaren und abschreckenden Marke MAGA versehen. Auch dieses Vorgehen gleicht frappant der Politik, wie sie Henry Adams beschrieben hatte.
Vielleicht haben die Demokraten recht, und sie können gegen Trump auch mit einem gebrechlich wirkenden Kandidaten gewinnen. Aber es gab in Amerika immer wieder Wahlen, deren Ausgang gesichert schien, bis sie in einer Überraschung endeten. Die Wählerinnen und Wähler schätzen es nicht, wenn sie den Eindruck haben, es werde in den Machtzirkeln vorbestimmt, wie sie sich zu verhalten hätten. Präsident Harry Truman hatte das große Vergnügen, nach seiner unerwarteten Wiederwahl im Jahr 1948 eine Ausgabe der »Chicago Daily Tribune« vorzeigen zu können, auf der etwas voreilig seine Niederlage verkündet wurde.4 Hillary Clinton sowie weite Teile der medialen Landschaft und der Meinungsforschungsinstitute erlebten die letzte große Überraschung 2016 am eigenen Leib. Über Sieg und Niederlage entschieden sowohl damals als auch 2020 nur einige zehntausend Stimmen.
Dieses Buch wird nicht voraussagen, wer im November 2024 zum Präsidenten der USA gewählt wird. Das kann und will es auch gar nicht versuchen. Aber es kann vielleicht zeigen, was alles auf dem Spiel steht und warum das amerikanische Wahlsystem nicht immer bewirkt, dass der Wille des Volkes triumphiert.
1. Der Tabubruch und seine Folgen
Ein Gedankenspiel: Es ist der 6. Januar 2021, frühabends in Washington. Europa ist mit mulmigen Gefühlen zu Bett gegangen, und Amerika verfolgt fassungslos, was in seiner Hauptstadt vorgeht. Aufgebrachte Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump haben das Kapitol gestürmt. Dort nehmen sie eine Reihe von Geiseln, unter ihnen Vizepräsident Mike Pence und die demokratische Vorsitzende (Speaker) des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Die Polizeikräfte haben sich auf Verlangen der Besetzer aus dem Wahrzeichen der amerikanischen Demokratie zurückgezogen. Vor laufenden Fernsehkameras fordern Anhänger Trumps ultimativ, dass der Kongress das Ergebnis der »gestohlenen Wahl« vom 3. November 2020 korrigiere, andernfalls müssten die Geiseln mit »sehr ernsten Konsequenzen« rechnen. Die Gerüchte überschlagen sich. Hinrichtungen am Galgen, so heißt es, würden vorbereitet, mit Pelosi und Pence »ganz oben auf der Liste«. Pence hat den Zorn der Trump-Anhänger auf sich gezogen, weil er sich weigert, eine Anweisung des Präsidenten zu einem offenen Verfassungsbruch auszuführen. Pelosi hassen sie, weil die ebenso skrupellose wie erfolgreiche Demokratin für radikale Konservative in Amerika schon lange ein rotes Tuch ist.
Wie einfach das Kapitol gestürmt werden kann, erscheint grotesk. Trump hat die Menge mit einer aufrührerischen Rede vor dem Weißen Haus aufgepeitscht. Er gibt ihnen eine vielsagende Losung mit auf den Weg: »Wenn ihr nicht entschlossen kämpft, werdet ihr kein Heimatland mehr haben.« Er spornt sie auch später immer wieder an, als sie Polizeikordons gewaltsam durchbrechen, Fenster einschlagen und Türen aushebeln. Vor dem Fernseher sitzend, verspricht er ihnen über Twitter den unmittelbar bevorstehenden Sieg. Ein gutes Dutzend republikanische Abgeordnete und Senatoren haben sich mit den Besetzern solidarisiert. Sie heißen zwar nicht das gewaltsame Vorgehen gut, stellen sich aber hinter die Forderung nach einer »Korrektur« des Wahlergebnisses.
Die Sicherheitskräfte sind wie gelähmt. Die Befehlsketten sind unterbrochen, und wichtige Entscheidungsträger wagen es nicht, dem Präsidenten offen zu widersprechen oder hinter seinem Rücken die Niederschlagung des Aufstandes anzuordnen. Die amerikanischen Streitkräfte müssen sich zurückhalten, da sie im Inland nur unter eng definierten Umständen eingesetzt werden dürfen. Die Nationalgarde des Hauptstadtbezirks Washington, die direkt dem Präsidenten unterstellt ist, erhält von einem seiner engsten Berater den Befehl, ihre Kaserne nicht zu verlassen.
Dagegen mobilisieren die benachbarten Bundesstaaten Maryland und Virginia ihre jeweilige Nationalgarde und bringen Einheiten an der Grenze zur Hauptstadt, auf den Zufahrtsstraßen sowie an anderen neuralgischen Punkten in Stellung. Die beiden Gouverneure haben sich abgesprochen und versuchen, das Machtvakuum in Washington wenigstens teilweise zu füllen. Sie wollen den Zugang zur Hauptstadt hermetisch abriegeln, denn aus dem ganzen Land treffen Berichte ein, wonach Zehntausende von Menschen, die meisten von ihnen bewaffnet, in Fahrzeugkolonnen auf dem Weg seien, entweder um »die Patrioten im Kapitol zu unterstützen« oder um »die Demokratie gegen einen Putsch zu verteidigen«. Es soll bereits blutige Zusammenstöße zwischen solchen Gruppen geben.
In den Tagen des Chaos, die der Erstürmung des Kapitols folgen, läuft ein umfangreicher chinesischer Flottenverband Richtung Taiwan aus. Russland zieht Truppen an der Grenze der Ukraine und der baltischen Staaten zusammen. Die Welt hält den Atem an.
All das klingt zum Glück nur nach einem Albtraum oder einem Politthriller. Die tatsächlichen Ereignisse des Dreikönigstages 2021 waren zwar haarsträubend genug, aber sie stellten zu keiner Zeit eine akute Gefahr für die amerikanische Demokratie und keine unmittelbare Bedrohung für die amerikanisch geführten Verteidigungsbündnisse dar. Wir wissen nicht, wie weit Trump gegangen wäre, um im Weißen Haus bleiben zu können. Er ist gerissen genug, um sich in heiklen Situationen gern in eine vorsätzliche Mehrdeutigkeit zu flüchten.
Wir wissen, dass subalterne Mitglieder von Trumps Regierung und dubiose Einflüsterer von zweifelhafter juristischer Kompetenz ihn ermutigten, bis zum Letzten zu gehen und die Macht an sich zu reißen – natürlich alles zum Wohle des Landes. Wir wissen aber auch, dass es andere in Trumps Regierung gab, die sich im entscheidenden Moment daran erinnerten, dass sie ihren Eid auf die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika abgelegt hatten, nicht auf den Präsidenten. Und wir wissen auch, dass es sich dabei zum Teil um Personen handelte, die zuvor in manchmal schrillen Tönen beschimpft worden waren, sie hätten kein Rückgrat, würden ihre Amtspflicht verletzen und gleichsam das Vaterland verraten, nur um Trump zufriedenzustellen. Zu diesen Personen gehörten Mike Pence, der damalige Vizepräsident, und Justizminister William Barr. Beide besannen sich im entscheidenden Moment auf ihre Pflicht dem Land gegenüber. Viele andere, die namentlich nie bekannt wurden, taten dies ebenfalls. Sonst wäre Trumps Versuch, das Wahlergebnis umzustoßen, nicht derart schnell im Keim erstickt worden.
1.1. Ein Schock, der rasch überwunden wird
Der Spuk im Kapitol am 6. Januar 2021 erschien, als die Ereignisse noch im Fluss waren, wie eine kleine Ewigkeit. Im Rückblick – die Sache war nach knapp vier Stunden zu Ende – wirkt das alles sehr überschaubar. Doch diese vier Stunden stellen eine Zäsur dar, die nie mehr ungeschehen gemacht werden kann. Der Sturm auf das Kapitol strahlte ein Signal aus, das weltweit gehört wurde. Die Ereignisse in Brasilien fast genau zwei Jahre später zeigten es deutlich: Das Beispiel in Washington hatte Schule gemacht. In Brasilia drang am 8. Januar 2023 ebenfalls ein Mob von Anhängern des unterlegenen Präsidenten Jair Bolsonaro mit Gewalt in die Amtssitze des Präsidenten, des Parlaments und des Obersten Gerichts ein, um das Wahlergebnis noch zu drehen. Wie die Trump-Anhänger im Norden zwei Jahre zuvor, waren auch sie fest davon überzeugt, dass ihr Idol eine faire Wahl ganz einfach nicht verlieren könne. Es musste sich zweifellos um Betrug handeln, und der Aufstand dagegen war patriotische Pflicht.
Trumps Verhalten war ein Tabubruch, dessen Folgen noch nicht absehbar sind. Er versuchte zum ersten Mal in der bald 250 Jahre alten Geschichte der USA, den vielleicht wesentlichsten Mechanismus einer Demokratie auszuhebeln: die friedliche Übergabe der Macht. Die Tragweite dieses Vorfalls schien nicht wenige zu überfordern. Es wurde verharmlost, beschönigt, vor Dramatisierung gewarnt: Im Grunde sei doch bloß eine Demonstration von Unzufriedenen aus dem Ruder gelaufen. Andere munkelten, es seien wohl linksradikale Provokateure am Werk gewesen. Konservative würden schließlich Recht und Gesetz verteidigen. Wieder andere wunderten sich öffentlich wie merkwürdig es gewesen sei, dass die Sicherheitskräfte sich derart übertölpeln ließen. Wer sucht, der findet – auch eine passende Verschwörungstheorie.
Abgesehen davon, dass die Sicherheitskräfte tatsächlich in einem erschreckenden Maß unvorbereitet wirkten, waren solche Wortmeldungen reine Ablenkungsmanöver. Zu verharmlosen gab es nämlich gar nichts. Selbst in den höchsten Führungsgremien der Republikanischen Partei saß der Schock über den gewaltsamen Sturm auf das Kapitol zunächst tief. Kein Wunder, denn viele von ihnen hatten die Sache aus bedrohlicher Nähe mitverfolgt oder mussten sogar in äußerster Not evakuiert werden. Einige hatten in den chaotischen vier Stunden ihre Liebsten angerufen, um sich für den Fall der Fälle verabschiedet zu haben. All das passierte wirklich an diesem Tag, den Donald Trump später, im Mai 2023, vor den Kameras von CNN5 als »wunderschön« bezeichnen durfte.
Die Untersuchungen, die das Repräsentantenhaus unter demokratischer Führung über die Vorfälle des Dreikönigstags in die Wege leiteten, ergab in groben Strichen folgendes Bild: Angespornt von dubiosen juristischen Quacksalbern glaubte Trump, er könne mithilfe des Mobs und antiquierten Gesetzestexten das Wahlergebnis tatsächlich noch umstoßen und damit durchkommen. Die Horde war keineswegs nur ein Haufen empörter, fehlgeleiteter Anhänger des Präsidenten. Er bestand zum Teil aus gut organisierten und gewaltbereiten Gruppen, die in entscheidenden Momenten das Kommando übernahmen und den Verteidigungswall der Polizei durchbrachen. Es fällt rückblickend schwer, darin einen Zufall zu erkennen. Eine der beteiligten Truppen, die ohne jeden Zweifel einen Umsturz geplant hatte, waren die sogenannten Proud Boys, eine ultranationalistische Männermiliz mit Ablegern im ganzen Land. Sie hatten bereits im Wahlkampf von sich reden gemacht, weil sie Trump offensiv unterstützt hatten. In einer der Wahlkampfdebatten, die im Fernsehen direkt übertragen wurden, war Trump darauf angesprochen worden. Er wurde aufgefordert, sich von den Rechtsextremisten zu distanzieren. Doch Trump rief ihnen über den Äther zu: »Stand back, and stand by!« (»Haltet euch zurück, aber haltet euch bereit!«) Am Dreikönigstag waren die Proud Boys bereit, und sie waren nicht die Einzigen.
1.2. Neue Gipfel der Angstmacherei
Dass in den USA vor nationalen Wahlen düsterste Untergangsszenarien an die Wand gemalt werden, ist nicht neu. Das ist zweifellos eine Folge der außergewöhnlich starken Polarisierung, und diese wiederum mag mit dem Zweiparteiensystem zu tun haben, das in Amerika fest verankert ist. In anderen westlichen Demokratien trägt die Notwendigkeit, unter mehreren Parteien in Koalitionsverhandlungen wechselnde Mehrheiten zu schmieden, möglicherweise zu einer gewissen Mäßigung bei. Aber grundsätzlich gilt natürlich auch dort: Den Menschen Angst einzujagen wirkt als Wahlkampftaktik zu gut, als dass man darauf verzichten wollte. Das Kalkül zielt direkt auf die Emotionen und mobilisiert darum deutlich besser, als der Wählerschaft in nüchternen Analysen Vor- und Nachteile der einen oder der anderen Politik darzulegen.
2016 war es besonders hoch hergegangen. Der konservative Intellektuelle Michael Anton6 verglich in den letzten Monaten des amerikanischen Wahlkampfs die Wahl zwischen Trump und der Demokratin Hillary Clinton mit dem tragischen Schicksal des »Flugs Nummer 93«. Dabei handelte es sich um jenes vierte Flugzeug, das bei den Anschlägen vom 11. September 2001 von Terroristen entführt worden war und nach einem Aufstand der Passagiere in Pennsylvania abstürzte, statt ins Kapitol zu krachen. Auch bei der Präsidentenwahl seien radikale Maßnahmen nötig, argumentierte Anton. Denn nach acht Jahren unter dem linken Barack Obama würden weitere vier Jahre demokratischer Herrschaft unter einer Präsidentin Clinton dem konservativen Amerika mit Sicherheit den Todesstoß versetzen, genauso wie es der »Flug Nummer 93« nach den Plänen der Hijacker mit dem Kapitol hätte tun sollen. Clintons Sieg müsse um jeden Preis verhindert werden, mit der bedingungslosen Unterstützung ihres Gegners Trump. Dessen Wahl, so lautete Antons Botschaft, berge zwar auch erhebliche Risiken. Doch die Alternative sei, bildlich gesprochen, der sichere Tod.
Die Vorstellung, dass der Sieg des politischen Gegners fatale, apokalyptische Konsequenzen haben werde, ist Gift für den demokratischen Wettstreit. Aber die Horrorvision wird trotzdem immer wieder bewirtschaftet. Trump selbst bedient sich des Mittels besonders gern. Über den Jahreswechsel 2020/2021 befeuerte er Schreckensszenarien, als er das Wahlresultat per Verfassungsbruch umdrehen wollte. Und er kam bereits an seiner ersten Wahlveranstaltung für den laufenden Wahlkampf im Januar 2023 auf den »Kassenschlager« zurück: Eine erfolgreiche Wahl im November 2024, rief er gleich mehrfach aus, sei die letzte Gelegenheit, das Land vor dem Untergang zu retten.
Gleichzeitig hält er unverdrossen an der Legende fest, wonach er die Wahl von 2020 nicht etwa verloren habe, sondern dass er mit unlauteren Machenschaften um den Sieg betrogen worden sei. Den langen Schatten von mehreren Straf- und Zivilrechtsanklagen gegen ihn quittierte er mit dem Vorwurf, die Justizbehörden verfolgten ihn allein aus politischen Gründen. Sie seien zu Waffen des politischen Gegners geworden, für den erbärmlichen Versuch, seinen kommenden Sieg von 2024 zu torpedieren.
Mit diesen Elementen spann Trump bereits das Muster, das für jeden seiner Wahlkämpfe wesentlich ist. Die simple Botschaft lautet: Ohne ihn wird das Land vor die Hunde gehen. Mit ihm als Präsidenten kommen nicht nur bessere Zeiten auf Amerika zu. Er wird auch dafür sorgen, dass Vergeltung für erlittenes Unrecht geübt wird, was besonders bedrohlich klingt. Denn bereits zuvor hatte er klargemacht, dass er sich auf seiner Mission von Verfassung und Gesetz nicht zwingend einschränken lasse. Auf seinem eigens gegründeten Nachrichtenportal »Truth Social« meinte er, der »massive Wahlbetrug« von 2020 erlaube es, sämtliche Gesetze, Regeln und Artikel außer Kraft zu setzen, »selbst jene in der Verfassung«.7 Um das Land zu retten, sind alle Mittel erlaubt. Das passt zum Auftrag, den er seinen Anhängern vor dem Marsch auf das Kapitol am 6. Januar 2021 mitgegeben hatte. Im Dezember 2023 legte er im Gespräch mit seinem Leibmoderator Sean Hannity von Fox News nach, Diktator werde er »nur am ersten Tag« seiner neuen Amtszeit sein.8
Während er sich immer wieder als Bewahrer von Recht und Ordnung in Szene setzt, lässt Trump – wie der republikanische Politikstratege Karl Rove im »Wall Street Journal« meinte – zunehmend offen seinen »bösen Zwilling« durchscheinen,9 der Gewalt und Straftaten in Kauf nimmt und sogar Begnadigungen in Aussicht stellt, wenn sie in seinem Sinn oder unter seinem Namen verübt werden. An Wahlveranstaltungen lobt er die Aufrührer des 6. Januars und stellt ihnen für den Fall seines Wahlsiegs Straferlass in Aussicht. Das Publikum ist begeistert. Den Teilnehmern des Sturms auf das Kapitol kam ihr »Triumph« derweil teuer zu stehen. Zahlreiche Haftstrafen ergingen. Der ehemalige Anführer der Proud Boys, Enrique Tarrio, muss für 22 Jahre hinter Gitter.10
Als sich der Bezirksstaatsanwalt von New York, Alvin Bragg, im März 2023 bereit machte, Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels unter Anklage zu stellen, rief Trump bereits vorsorglich zu Protesten auf. Das klingt harmloser, als es ist. Im heutigen Amerika ist es unmöglich, sich Proteste von Trump-Anhängern vorzustellen, die friedlich und geordnet bleiben. Zu sehr haben sich die Eindrücke vom Dreikönigstag 2021 in das kollektive Gedächtnis gebrannt. Trump weiß das, und er spielt bewusst damit. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, Republikaner und mittlerweile ein Widersacher Trumps, brachte es auf den Punkt, als er in einer Fernsehdiskussion zu Trumps Aufruf meinte: »Der Zirkus geht weiter.«11 Trump profitiere von Chaos und Tumult, und deshalb sei er daran interessiert, genau solche Verhältnisse zu schaffen.
Im Nachgang zu diesem dunklen Fleck in der Geschichte der amerikanischen Demokratie erwiesen sich der Schock und die Empörung bei vielen Republikanern in Washington als erstaunlich kurzlebig. Kevin McCarthy, der 2023 für einige Monate Vorsitzender (Speaker) des Repräsentantenhauses wurde, gab die Richtung und das Tempo des Kurswechsels gleich persönlich vor. In den ersten Tagen nach dem Dreikönigstag 2021 hatte er dem Präsidenten noch öffentlich und unmissverständlich einen Teil der Verantwortung angelastet. McCarthy hatte selbst vor dem Mob fliehen müssen und den gewalttätigen Protest verurteilt. Er hatte auch eingeräumt, dass einige Demonstranten gut vorbereitet wirkten und unter anderem einen Galgen und einen Strick mit sich führten. Doch schon einige Wochen später, Ende Januar 2021, schwenkte McCarthy wieder auf die Trump-Linie ein: Er reiste zu Trump in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida, um die Scherben im Verhältnis zum ehemaligen Präsidenten zu kitten. Brav posierte McCarthy für ein gemeinsames Foto.12
Das politische Tagesgeschäft hatte die Republikaner wieder eingeholt. Sie waren wild entschlossen, den 6. Januar so rasch wie möglich hinter sich zu lassen. Sie waren sich bewusst, dass dieser schwarze Tag für immer mit einer unangenehmen Wahrheit verbunden sein würde: Die Partei und ihre Führung im Kongress waren auf den unberechenbaren Donald Trump bedeutend stärker angewiesen als dieser auf sie. Ohne seine Anhänger würde die Grand Old Party, wie die Republikanische Partei sich stolz nennt, in den nächsten Wahlzyklen ohne jede Aussicht auf einen Sieg antreten müssen. Wir werden im nächsten Kapitel noch genauer sehen, warum das so ist. Fest steht, dass nur wenige republikanische Kongressmitglieder die Reißleine zogen und sich von Trump abwandten. Alle waren sich bewusst, dass dieser Schritt ziemlich sicher das vorläufige Ende ihrer politischen Karriere bedeuten würde. Die große Mehrheit entschied sich aus diesem Grund, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und McCarthys Kehrtwende zu folgen. Einige, so wurde es in Washington kolportiert, taten dies auch ganz einfach aus Furcht vor Trumps Anhängern und möglichen Gewalttaten gegen sie oder ihre Familien.13
Seit dem Auftreten Trumps auf der nationalen politischen Bühne ist klar, dass unzählige republikanische Mandatsträger Loyalität gegenüber Trump vortäuschen, ihn in Wahrheit aber verachten. Dieses Verhalten mag ethisch fragwürdig sein, aber es ist durchaus rational. In der Politik werden die Verteilung und Ausübung von Macht organisiert. Es werden entscheidende Kontakte aufgebaut und gepflegt. Wer dabei mitmischen will, muss auf dem Spielfeld bleiben. »Relevant« bleiben, hatte es der republikanische Senator aus South Carolina, Lindsey Graham, bei seiner ersten 180-Grad-Drehung in Sachen Trump genannt.14