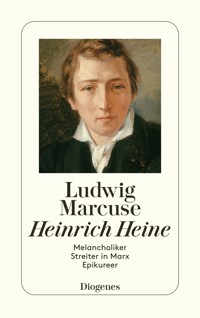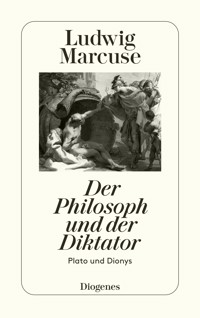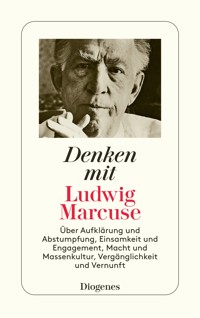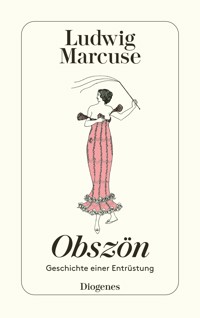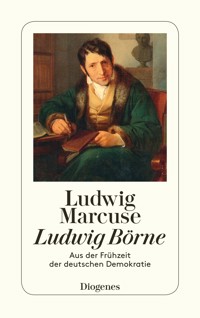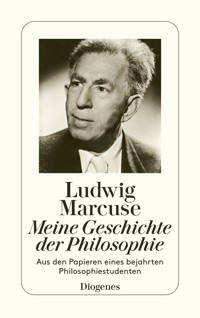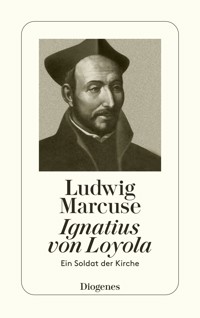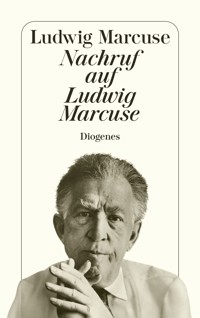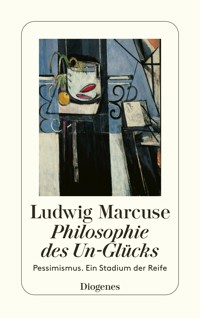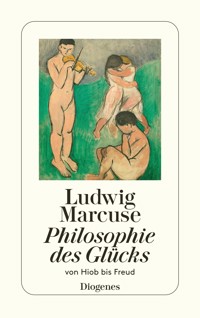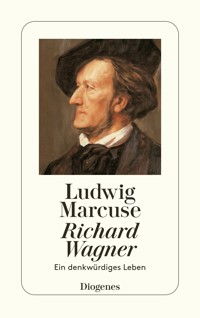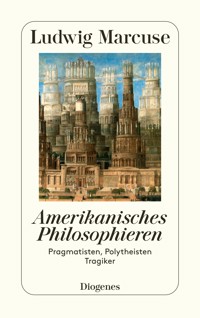
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Lösungen statt Erlösung; Einmischung statt Einsamkeit – so lauten einige der Formeln, auf die Marcuse amerikanisches Denken bringt. Ein aufschlußreiches, gut verständliches, elegant geschriebenes Buch über ›Amerikanisches Philosophieren‹ mit erstklassigen Portraits von Charles S. Peirce, William James, Henry Adams und John Dewey.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Amerikanisches Philosophieren
Pragmatisten, Polytheisten, Tragiker
Mit einem Nachwort von Dieter Lamping
Diogenes
I.GIBT ES EINE AMERIKANISCHE PHILOSOPHIE?
1.WAS IST AMERIKANISCH?
Es scheint so klar zu sein, was ‹amerikanisch› ist – wenn es nur auch wahr wäre. Eine Wendung wie ‹Der Mann ist eine Million wert› wird von allen gelernten und ungelernten Völker-Psychologen heute ohne Besinnen und mit höchster Sicherheit als charakteristisch amerikanisch diagnostiziert werden. Doch ist sie im achtzehnten Jahrhundert von KANT, im neunzehnten von HEINE als charakteristisch britisch bezeichnet worden. KANTS ‹Anthropologie in pragmatischer Hinsicht› enthält den Satz: ‹Der kaufmännische Geist zeigt auch gewisse Modifikationen seines Stolzes in der Verschiedenheit des Tuns und Großtuns. Der Engländer sagt: ‚Der Mann ist eine Million wert‘, der Franzose: ‚Er besitzt eine Million‘.› Zwei Generationen später schrieb HEINE (in der ‹Lutetia›) ähnlich: in England werde ‹das Verdienst eines Mannes nur nach seinem Einkommen abgeschätzt, und how much is he worth heißt buchstäblich: ‚wieviel Geld besitzt er‘›. Das Festland sah also im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert auf England, wie Europa im zwanzigsten auf Amerika sieht.
Das lehrt zweierlei. Einmal, daß dieses berüchtigte ‹Der Mann ist eine Million wert› weder eine englische noch eine amerikanische Eigenschaft verrät, sondern nur das Erstaunen der Anderen über diesen Satz, die Reaktion auf ein Anderssein; erst auf England, dann auf Amerika. Die unglückliche Neigung zur Verfestigung zeitlich begrenzter Reaktionen in Volks-Charaktere schuf zu einem guten Teil die Völker-Psychologie. Sie hat eine lange Tradition, die in den Theorien vom Volks-Geist (HEGEL) und der Kultur-Seele (SPENGLER) einen pseudo-wissenschaftlichen Ausdruck fand. Der Satz ‹Der Mann ist eine Million wert› zeigt dann aber noch mehr als die Verwandlung der Reaktion auf die Fremdheit in einen nationalen Zug des Fremden. England war im neunzehnten Jahrhundert dem europäischen Kontinent, Amerika im zwanzigsten dem ganzen Europa als industrielle Gesellschaft voraus – auch in der Entwicklung vieler Symptome in ihrem Gefolge. Man erkannte aber damals nicht und erkennt auch heute noch nicht, daß, was einst ‹britisch› genannt wurde und später ‹amerikanisch›, keine nationale Qualität anzeigt, sondern den Charakter einer bestimmten Entwicklungs-Stufe in einem übernationalen gemeinsamen Prozeß.
Die Psychologie ist dabei, die auf ein Subjekt aufgehefteten ewigen Eigenschaften aufzugeben. Die Völker-Psychologie ist resistenter. Sie ist nicht nur ein Produkt von Irrtümern, vor allem von Affekten; bisweilen ist gar nicht mehr aufzuklären, ob das Verkennen einen Haß oder der Haß ein Verkennen in die Welt gesetzt hat. Die Dogmen der Völker-Psychologie sind auch deshalb so zäh, weil sie das große Reservoir der Kriegs-Propaganda sind, wie sie zu einem guten Teil als Geschöpfe von Kriegs-Psychosen in die Welt kamen.
Die europäischen Deuter Amerikas haben es nun in dreihundert Jahren nicht immer nur mit einem Land zu tun gehabt, das industriell entwickelter war und außerdem behaftet mit allen Übeln, welche diese Entwicklung mit sich brachte. Es war davor, im siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, weniger entwikkelt, materiell und kulturell. So gewann dasselbe Wort ‹Barbarei› in der Anwendung auf Amerika eine zwiefache Bedeutung: erst koloniale, dann überzivilisierte Barbarei. Zuerst legte man dem Lande Amerika als barbarisch aus, was nur die Reaktion des entwickelten Mutterlandes auf die (abhängige, dann unabhängige) Kolonie war. Amerika war damals, von London und Paris aus gesehen, hinterwäldlerisch. Und man nannte, ahnungslos, das Hinterwäldlerische: amerikanisch.
Die Idee vom völligen Anderssein der Neuen Welt hielt sich dann mehr als anderthalb Jahrhunderte – auch bei denen, welche diese Vorstellung nicht zum Kriegsdienst einzogen. Der französische Staatsmann TARDIEU, ein Freund CLEMENCEAUS, erfaßte das unfaßbare Amerika in einem Zitat. 1805 hatte ein Berichterstatter über ‹die wilden Stämme am Missouri› die Sentenz geprägt: ‹Es scheint das herrschende Prinzip der Amerikaner zu sein, nichts so zu machen wie wir.› Das fand TARDIEU noch im Jahre 1927 bestätigt.
In der kriegerischen Völker-Psychologie wurde das Anderssein – zur Unkultur. Obwohl die Rückständigkeit im Beginn und das heutige technische Vorneweg-auf-dem-Weg-zur-Hölle einander entgegengesetzt sind, war die Anklage, die gegen das eine wie das andere erhoben wurde, fast die gleiche. Amerika war im Beginn das Chaos vor dem ersten Tag – und später so geplant, daß die Natur (die nicht-menschliche und die menschliche) aus der Welt heraus-geplant war. Zuerst und zuletzt: dieses Amerika ist unmenschlich.
Die Gehässigkeit, die neben dem Mißverständnis an diesen Verzeichnungen mitgewirkt hat, trieb die giftigsten völker-psychologischen Blüten. Den grellsten Ausdruck fand der Psychologe C.G. JUNG. Nach ihm sind die Amerikaner Europäer mit den Manieren von Negern und den Seelen von Indianern – kurz: keine Europäer, sondern undefinierbare Exoten. In unserer Zeit ging es immer weiter mit dem Willen zur Verfremdung. Der Amerika-Mythos des zwanzigsten Jahrhunderts lebte sich aus in Sätzen wie: ‹Die Vereinigten Staaten sind die Heimat des Zwanges, so wie die Büchse der Pandora die Heimat aller Übel ist.›
Die Motive, die mehr als zwei Jahrhunderte hindurch Europäer getrieben haben, das Bild vom völlig anderen Menschen, Amerikaner genannt, zu zeichnen, sind zahllos. Es lassen sich aber vier stets wiederkehrende Triebfedern aufzeigen: Amerika diente (erstens) als Sündenbock, (zweitens) als Projektion nationalen Selbst-Hasses; und manche Amerika-Karikatur war eine Reaktion auf (drittens) einen grotesken amerikanischen Narzißmus, (viertens) auf einen ahnungslos-verstiegenen europäischen Amerika-Enthusiasmus.
Als Sündenbock ist jeder Mitmensch, jedes Mit-Volk brauchbar – am brauchbarsten aber der Schwächste und der Stärkste: der, welcher sich nicht wehren kann; und der, gegen den man sich nicht wehren kann.
Amerika, das mächtige, glänzende, beneidete, ist als Sündenbock erst seit dem Ende des Ersten Weltkrieges so recht zu verwenden; und wurde um so verwendbarer, je größer die Macht-Differenz zwischen ihm und der übrigen Welt geworden ist. Der Sündenbock-Charakter zeigt sich vor allem in der Fratze, die das Wort ‹Amerikanismus› geworden ist; alle großen europäischen Übel werden auf die Infektion mit dem furchtbaren Bazillus Americanus zurückgeführt.
Verborgener ist ein zweiter seelischer Mechanismus, der das Amerika-Bild geschaffen hat: ein europäischer Selbst-Haß, der sich nach außen gegen das Nicht-Selbst Amerika richtet. Selbst-Haß ist nicht immer ein pathologisches Phänomen; wer in sich selbst Hassenswertes haßt, ist gerade besonders gesund. Man kann aber auch, im Haß gegen sich oder das eigene Volk, Entscheidendes verfehlen. Vielleicht haben die Deutschen den nationalen Selbst-Haß weiter getrieben als irgendeine Nation: zum Beispiel in HÖLDERLIN und NIETZSCHE. Wenn HÖLDERLIN am Ende des ‹Hyperion› den Deutschen vorwirft, sie seien keine Menschen, nur Fragmente – Tischler oder Professoren oder Soldaten –, so traf er damit nicht die Deutschen, sondern den Menschen im Beginn des Zeitalters der Spezialisierung … ein übernationales Schicksal.
Dieser patriotische Selbst-Haß wird ein falsches Bild vom eigenen Volk schaffen; aber es gibt nur wenige HÖLDERLINS und NIETZSCHES, die es aushalten, gegen die Heimat zu leben. Häufiger wird dem gehaßten Selbst ein gehaßter Fremder untergeschoben; der nationale Selbst-Haß pervertiert zum Haß gegen irgendein ‹verworfenes› Volk. ‹Amerika› ist so auch ein Angriff, ein sehr verhüllter, gegen die eigenen Sünden; eine feige – Selbstbezichtigung. Der Anti-Amerikanismus ist auch eine geheime europäische Anklage gegen sich – eine Ich-Spaltung, die vorgibt, der Richter und der Verurteilte seien zwei … und der Verurteilte wird ‹Amerika› genannt. Sie sind eins.
Es ist das schlechte Gewissen Europas, das sich im sogenannten amerikanischen Materialismus üppig auslebt. Nicht, als wäre es nicht wahr, daß die Amerikaner hinter dem Dollar herjagen. Nur soll diese Unterstreichung verdecken, daß die Europäer ebenso hinter dem Pfund, dem Franc und der Mark her sind.
Nicht weniger stark als die Suche nach dem Sündenbock und die Verwandlung des europäischen Selbst-Hasses in Amerika-Haß haben zwei Amerika-Idole das Anti-Amerika-Bild hervorgerufen. Die amerikanische Selbst-Stilisierung als das Erwählte Volk Gottes und eine europäische Ahnungslosigkeit, ja: ein europäischer Masochismus haben Amerika als Erlöser propagiert. Die Propaganda rief dann jene Reaktionen hervor, die nichts dagegenzusetzen wußten als Verteufelungen.
Die Europa-Müdigkeit kleidete sich immer wieder in Amerika-Begeisterung. Und wie die Hasser nicht sahen, daß die Kolonie selbstverständlich viele Errungenschaften noch nicht hat, die das Mutterland besitzt, so sahen die Amerika-Verliebten nicht, daß die Kolonie selbstverständlich viele angenehme Dinge noch hat, welche die entwickeltere Zivilisation bereits zerstören mußte; zum Beispiel die lockere Regierung eines Landes, das keine gefährlichen Feinde hatte und keine drückenden Steuern benötigte.
Die deutsche Romantik feierte Amerika, weil es da drüben noch kein Unbehagen in der Kultur gab; übrigens hat man bis heute noch keinen philosophischen Ausdruck dafür in Amerika gefunden. Und NIETZSCHES Preis auf das amerikanische Lachen war eine heimliche Attacke auf das SCHOPENHAUERsche und RICHARD WAGNERsche Weinen. Amerika war für die HEINES und NIETZSCHES, BYRONS und SHELLEYS die Anti-Dekadenz per se; Symbol für die Überwindung der heimatlichen Malaise.
Und schließlich war Amerika für alle politischen Liberalen das glückliche Land, das keinen Feudalismus erlitten hatte. Der deutsche Fortschrittler CARL SCHURZ, der nach Amerika ausgewandert war, einer der erfolgreichsten Emigranten, schrieb für alle seine Amerika-besessenen Mit-Streiter den Satz: ‹Ich war entschlossen, in allem Amerikanischen das Beste zu finden.› Sobald aber die Wirklichkeit mit einem Ideal verschmolzen wird, verdeckt es sie. Amerika wurde die Inkarnation der ‹Declaration of Independence›. Wen interessierte das wirkliche Amerika? Alle interessierte die Vorstellung von der realisierten Utopie. Im neunzehnten Jahrhundert war Amerika die Rolle zugefallen, die in unserem dann Rußland spielen sollte.
An diesen Poetisierungen und libidinösen Besetzungen setzte der Amerika-Haß ein. Er zeigte immer wieder: ‹Amerika ohne Maske›. Unter dieser Parole wurde ihm die ebenso alte Maske aufgesetzt, die vom Haß modellierte. Amerika ist aber ebensowenig die Erfüllung des Satzes: ‹daß alle Menschen als Gleiche geschaffen sind› – wie das Land BARNUMS, des Neger-Lynchens, der Atom-Bombe und MCCARTHYS. Es erscheint am unverfälschtesten in den Beschreibungen jener Männer, die ambivalent (nicht neutral) waren – in ihrer Haltung sowohl zum einen wie zum andern Kontinent. Sie kannten beide gleich gut und brachten sie deshalb nicht auf ärmliche Formeln, sondern zeichneten sie in vielen guten Beobachtungen. Man kann über beide Welten, die Alte und die Neue, viel erfahren, wenn man WILLIAM und HENRY JAMES und HENRY ADAMS liest, die nirgends zu Hause waren (oder hier und dort) und deshalb keine armselige Propaganda schufen. Sie malten das eine vor dem Hintergrund des andern, priesen beide und tadelten beide; und entgingen so in einem ungewöhnlichen Maße den stereotypen Klischees. WILLIAM JAMES schrieb von sich, er entwickle ‹ein besonderes Organ für die Erfahrung von nationalen Differenzen›. Er war auch so ‹deutsch›, daß sein Werk übersät ist mit deutschen Wendungen. Und bis zu diesem Tage sind die hellsten Stimmen im europäisch-amerikanischen Gespräch diejenigen, die es (wie die Mitglieder der Familie JAMES) immer zum andern Erdteil trieb … zu dem, an den sie sehnsüchtig zurückdachten. –
Was ist amerikanisch? wird auf verschiedenen Ebenen beantwortet. Vor allem in den zwei polemischen Sprachen, die jedes Volk besitzt: der unfeinen des unzubereiteten und der feineren des ‹wissenschaftlich› aufgeputzten Schimpfens. ‹Amerikanismus› wird in einem deutschen ‹Philosophischen Wörterbuch› also definiert:‹Oberflächlichkeit, hastiges Tempo, Überschätzung der materiellen Güter, hemmungsloses Streben nach Rekordleistungen, Neigung zum Sensationellen, Mechanisierung der Arbeit und des Lebens, rücksichtslose Ausbeutung der Natur und Menschenkraft.› Es ist dies eine List vieler Adjektiva, denen eins gemeinsam ist: daß sie tadeln. Was aber der Terminus ‹Amerikanismus› wirklich meint, sagte der Philosoph JOSIAH ROYCE einmal in der Sprache seines Meisters HEGEL: ‹der selbstentfremdete Geist› – ein Zustand also, der mit dem Nationalen nichts zu tun hat. ‹Amerikanismus› hat gleich Ausdrücken wie ‹Atheismus› und ‹Materialismus› längst alles Spezifische verloren; ist nichts als ein klobiges Zeichen der Ablehnung.
Denkende Amerikaner leugnen ihren ‹Materialismus› nicht, verwandeln aber die plumpe Schießbuden-Figur in ein sehr differenziertes Gesicht. Amerikanischer ‹Materialismus› ist (wie der Amerikaner JOSEPH WOOD KRUTCH definiert) ‹der Glaube, daß man alles Begehrenswerte haben kann, wenn man genug bezahlt›. Dieser materialistische Glaube ist übrigens bekannter als die spezifischere amerikanische Praxis, die in der Wendung ‹Generöser Materialismus› recht gut wiedergegeben ist. Der Engländer GORER und der Amerikaner KRUTCH stimmen darin überein, daß diesem Materialismus das Element des Geizes fehlt. Man ist hinter dem Dollar her, um ihn auszugeben – für sich, für andere, für die sogenannten materiellen Dinge, für Schulen, Bibliotheken und Studenten-Stipendien. Wenn man eines Tages die Vokabel ‹Materialismus› endlich verbraucht haben wird, wird man entdecken, daß das Kommerzielle ebenso im Dienste der Kultur stehen kann, wie sie ein schimmerndes Gewebe sein mag über der nackten Selbstsucht.
Die erlesene Variante des ‹Amerikanismus› ist der ‹Pragmatismus›. Auch diese vier Silben wurden zum Schimpfwort – unter Leuten, die sich den Anschein geben, daß sie sich nicht herablassen zu schimpfen. ‹Pragmatismus› wurde eine akademische Pöbelei, ein Wort der Verachtung (zum Beispiel innerhalb der deutschen Philosophie vor dem Ersten Weltkrieg). Ein deutscher Freund von WILLIAM JAMES, WILHELM JERUSALEM, klagte: ‹Der Pragmatismus verdient nicht die Verachtung, mit der man ihn in Deutschland so vielfach behandelt.› Und ein anderer deutscher Denker, MÜLLER-FREIENFELS, schrieb sarkastisch: die deutsche Philosophie stelle bewußt oder unbewußt ein häßliches Strohbild auf, das sie als Pragmatismus zeichne und unter großem Aufwand von Logik und Gepolter umwerfe. Pragmatismus und Amerikanismus wurden identisch, zwei beliebte Pfeile im literarischen Köcher – nicht nur von Europäern, sondern auch von Amerikanern.
Selbst BERTRAND RUSSELL, so gewappnet gegen viele gefräßige Gespenster der Zeit, konnte sich der primitiven Gleichung des Tages: Pragmatismus ist die Philosophie der Händler, nicht entziehen. Seine Theorien haben manches gemein mit der amerikanischen Lehre, er selbst betonte die Gemeinsamkeit – und schrieb dennoch: ‹Die Liebe zur Wahrheit ist in Amerika verdunkelt vom Geist des Kommerzes, dessen philosophischer Ausdruck der Pragmatismus ist.› JOHN DEWEY antwortete auf diese unwahrscheinlich simple Redensart mit einer völkerpsychologischen Satire: der britische Neo-Realismus sei ein ideologischer Überbau über dem aristokratischen Snobismus der Engländer; die Tendenz der französischen Philosophie zum Dualismus sei ein Ausdruck der gallischen Neigung, neben der Gattin noch eine Maitresse zu haben; der deutsche Idealismus sei eine Manifestation der Fähigkeit, Bier und Wurst mit BEETHOVEN und WAGNER zu synthetisieren …
Allerdings könnte RUSSELL erwidern, daß WILLIAM JAMES selbst in dem programmatischen Buch ‹Pragmatismus› seine Lehre einer ökonomisch-politischen Wirklichkeit, wenn auch freundlicher, zugeordnet hatte, nämlich der amerikanischen Demokratie. JAMES hatte argumentiert: wie der Höfling keine Existenzberechtigung mehr in der Republik habe oder der katholische Priester in protestantischen Landen, so sei auch der rationalistische Idealist ein Fossil in unserer Gesellschaft. Ihn nannte er ‹autoritär›, den theistischen Gott eine Art ‹Über-Monarch› – den Pragmatismus aber ‹demokratisch›. Ist RUSSELLS Gleichung: Pragmatismus gleich amerikanischer Kommerzialismus … nicht methodisch auf derselben Ebene?
Ja, das ganze Vokabular dieses Pragmatismus scheint die These zu rechtfertigen, daß hier ‹Wahrheit› nichts als ein Handelsartikel ist. WILLIAM JAMES redet von ihrem ‹cash value›, ihrem Wert in bar. Er sagt: die Wahrheit lebe vor allem vom ‹Kredit-System›. Er schreibt: alle Wahrheiten hätten eins gemein: ‹that they pay›, daß sie sich auszahlen. Ist das nicht deutlich genug, um die Behauptung zu stützen, daß der Pragmatismus der philosophische Ausdruck des Kommerzialismus sei? Darüber hinaus: es scheint nicht einmal schwer, diese Behauptung noch zu verallgemeinern und den rechnerischen Zug an der gesamten Geschichte der amerikanischen Philosophie wiederzufinden. Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts blühte in Amerika jenes Denken, das von KANT und GOETHE und FICHTE und der Romantik tief beeinflußt war und sich ‹Transzendentalismus› nannte. Der Namengeber dieser Richtung, THEODORE PARKER, bekannte einmal: ‹Ich mache mir nicht viel aus schönen Künsten, die verlangen, daß man in Häusern steckt. Sie interessieren mich überhaupt nicht soviel wie die unschönen Künste, die kleiden, behausen, bequemen. Ich möchte lieber ein Mann wie FRANKLIN sein als ein MICHELANGELO … lieber einen Sohn haben, der Nützlichkeit organisiert, als einen großen Maler wie RUBENS, der Schönheit nur nachahmt. Kurz, mir sagt eine Viehschau mehr als eine Bilderschau.› Aber jener plumpe Verächter MICHELANGELOS und RUBENS’ hinterließ eine Bibliothek von dreißigtausend Bänden; las Hebräisch, Griechisch, Lateinisch, Deutsch, Skandinavisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Und JAMES, der die Kaufmanns-Sprache in die Philosophie brachte, war einer der kultiviertesten Gelehrten um die Jahrhundert-Wende. Die Amerikaner gebrauchten die Alltags-Sprache – auch aus Protest gegen den Ästhetizismus des philosophischen Fach-Jargons. Er enthielt keine Synonyma für ‹auszahlen› – und viele für den ‹Weltgeist›. Vor allem die Deutschen sublimierten ihren Alltag so sehr, daß er nicht mehr zu erkennen war. HEGELS ‹alles, was ist, ist vernünftig› … ist die dezentere Variante vom amerikanischen: alles, was sich auszahlt, ist vernünftig; beides Rechtfertigungen des Erfolgs.
An ihrem Wortschatz sollt Ihr sie erkennen! ist eine gute Methode, wenn man sie nicht zu primitiv handhabt. Es könnte sich dann zeigen, daß HEGELS ‹Dialektik› und seine sehr subtile Analyse des Gegensatzes von Herr und Knecht mehr vom europäischen Klassenkampf erzählen als JAMES’ cash von der amerikanischen Wirtschaft. Alle Philosophen berichten auch – offener oder verborgener – von dem Schicksal der Gesellschaft, der sie angehören. Deshalb hat man ein Recht, von einer amerikanischen, deutschen, französischen Philosophie zu reden. Man kann also, wenn man will, die nationale Färbung zum Thema nehmen, neben der Beachtung des Beitrags zu den Jahrtausend-Themen. Aber dann erzählt der amerikanische ‹Transzendentalismus› viel mehr als vom ‹typischen› amerikanischen Interesse für Nützlichkeit … zum Beispiel vom ebenso ‹typischen› amerikanischen Interesse an der Materialisierung des Ideals. Und dann erzählt der ‹Pragmatismus› viel mehr als vom ‹typischen› amerikanischen Interesse daran, daß sich alles auszahle; zum Beispiel auch von dem ‹typischen› amerikanischen Interesse an der Befreiung der Welt aus den Klauen der geistreich erdachten metaphysischen Gespenster. Die feindliche Propaganda arbeitete immer mit einer unbeschreiblich plumpen Interpretation der subtilsten Philosophie-Sätze. Selbst der scharfe Denker BERTRAND RUSSELL fand in PLATONS Philosophen-Königen eine Vorwegnahme der Ideen des englischen Faschisten-Führers SIR OSWALD MOSLEY. Was aber NOVALIS und FICHTE und HEGEL oder gar NIETZSCHE in allen Ländern angetan’ wurde, ist unreparierbar. Dieselbe Behandlung wurde amerikanischen Philosophen zuteil, die man am liebsten unter der eingeführten Marke ‹Pragmatismus› zusammenbündelte … und zum Übrigen legte.
Es ist aber notwendig gewesen, diese Kampf-Interpretation, exekutiert an der amerikanischen Philosophie, ins Licht zu rücken, bevor man ernsthaft an die Frage geht: gibt es eine amerikanische Philosophie? und welches ist, von Europa aus gesehen, ihr wesentlicher Zug?
2.DIE EUROPÄISCHEN MÖNCHE UND DIE AMERIKANISCHEN FREILUFT-DENKER
1835 begann ein Werk zu erscheinen, das sich in den vergangenen mehr als hundert Jahren als das unsterblichste Amerika-Buch erwiesen hat: ALEXIS DE TOCQUEVILLES ‹Demokratie in Amerika›. Der Engländer HAROLD LASKI hielt es, wahrscheinlich, für das Beste, was je über ein Land von dem Bürger eines anderen Landes geschrieben worden ist; der große Amerikaner HENRY ADAMS nahm es sich zum ‹Vorbild›.
Der zweite Band, der 1840 herauskam, beginnt mit einem Kapitel, das überschrieben ist: ‹Die philosophische Methode der Amerikaner›. Als es noch keine amerikanische Philosophie gab, charakterisierte sie TOCQUEVILLE schon treffend, in großartiger Vorwegnahme.
Der Augenblick, in dem er diesen Abschnitt schrieb, war allerdings für solch ein Unternehmen denkbar ungünstig. Der erste Satz lautet: ‹Ich glaube, daß man in keinem anderen Land der Philosophie weniger Beachtung schenkt als in den Vereinigten Staaten.› Dies Urteil war gerade schon nicht mehr richtig. Am Ende jener dreißiger Jahre waren der deutsche philosophische Idealismus, der französische St. Simonismus und die romantische Spekulation Europas bereits im Abblühen. Die amerikanische Generation aber, die später als Kreis um EMERSON, als Gruppe der ‹Transzendentalisten›, berühmt werden sollte, war schon auf dem Weg; TOCQUEVILLE konnte es nicht wissen.
Auch der beste Beobachter – erst recht, wenn er ein Ausländer ist – überhört leicht das Wachsen des Grases. TOCQUEVILLE hatte ungewöhnliches Pech. Während er das Kapitel über die philosophische Methode der Amerikaner verfaßte, wuchs dies Gras besonders üppig. Er kannte nur die Älteren, die, noch tief eingebettet in kalvinistischer und unitaristischer Theologie, in KANT nichts sahen als ‹eine Masse von handfesten Absurditäten›; sie können, meinte man, nur zur Skepsis führen. Hingegen wußte er wohl nichts von der Geburtsstunde des ‹Klubs der Transzendentalisten›, der aus einer Zusammenkunft im Jahre 1836 entstand. Die Teilnehmer gehörten zu jener Generation, die, im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts geboren, jetzt um die Dreißig war. Sie hatten sich zusammengetan, den Katzenjammer nach der Zweihundertjahr-Feier der Harvard Universität zu überwinden. Ihnen schien ‹der gegenwärtige Geisteszustand recht unbefriedigend›. Einer von ihnen, EMERSON, erklärte in der zweiten Sitzung: ‹Schrecklich, daß auf diesem gewaltigen Kontinent, wo die Natur so gigantisch ist, das Genie so zahm vegetiert.› Der ‹Transzendentalismus› war auch eine Rebellion in Richtung auf das Genie – die größte Annäherung an die deutsche Früh-Romantik, die hier erreicht wurde; vor allem aber der Eintritt Amerikas in jenen philosophischen Orden, der zuerst in der Sprache KANTS, dann in der Sprache HEGELS dachte und schrieb.
Auch TOCQUEVILLES zweiter Satz wurde gerade falsch. Er hieß: ‹Sie haben keine philosophische Schule und kümmern sich nicht viel um die Richtungen, die in Europa miteinander in Zwist liegen.› Der ‹Transzendentalismus›, in Boston und Cambridge beheimatet, machte in jenen Tagen Neu-England für Jahrzehnte zum Vorort deutschen Spekulierens. Man erhielt die philosophischen Idealisten in der Interpretation von COLERIDGE und VICTOR COUSIN, CARLYLE vermittelte GOETHE und SCHILLER. Bald lehnten die Amerikaner es ab, ‹literarische Vasallen Englands› zu bleiben; übersetzten und interpretierten auf eigene Faust. KANT führte sie ‹zur Ablehnung der alten sensualistischen Ideen›, die sie von England erhalten hatten; eben so aber zur Zurückweisung des Supranaturalismus der Kalvinisten und des Rationalismus der Unitarier. Die vorbildlichen Theologen wurden HERDER und SCHLEIERMACHER. Man hatte nun denselben Kampf zu führen, der eine Generation früher in der Anklage gegen FICHTE auf Atheismus und gegen KANT auf Irreligiosität – nicht durchgeführt worden war. Die Frommen richteten vor EMERSON und den Seinen die Alternative auf: ‹Es gibt einen persönlichen Gott oder es gibt ihn nicht.› Und selbst der milde, tolerante Bischof CHANNING, Nährvater der christlichen Pantheisten um EMERSON, erklärte: ‹Diese Spiritualisten sind in Gefahr, ihre private Intuition als Christentum auszugeben.› ‹Der hartgesottene, unitarische Papst›, ANDREWS NORTON, sagte es bösartiger: ist der Mensch eine ‹Eintagsfliege› oder (wie EMERSON denkt) ‹ein neuentstandener Barde des Heiligen Geistes?› Der Streit war nicht spezifisch amerikanisch. Es wurde hier die Säkularisierung der Theologie nachgeholt.
TOCQUEVILLE kontrapunktierte seine negativen Feststellungen: daß man der Philosophie keine Beachtung schenke und sich für die europäischen philosophischen Kämpfe nicht interessiere … mit einer Beschreibung der besonderen ‹philosophischen Methode Amerikas›, welche die europäische Schul-Philosophie ersetze. Man sei frei von der ‹Gebundenheit durch das System›, frei von Familien-, Klassen- und nationalen Vorurteilen; man sei offen für Entdeckungen, die anderswo von einer Dogmatik verhindert würden. Er hätte auch sagen können: die Wurzeln, die in die Vergangenheit zurückreichen, sind hier so kurz, daß keine bis zu einer Scholastik führt, wie sie schwer auf dem europäischen Denken lastete. So pries er das ungefesselte amerikanische Philosophieren und spendete ihm das höchste Lob, das ein Franzose zu vergeben hat: diese Amerikaner seien zwar die letzten, die DESCARTES studierten, wendeten ihn aber doch sehr wirkungsvoll an in ihrem frischen, von keiner Denkgewohnheit gehemmten Zupacken. Als hätte er schon den EMERSON-Kreis gekannt, den er nicht erwähnt, die Transzendentalisten mit ihrer ‹extrovertierten› Philosophie – ja, als hätte er schon den Pragmatismus vorausgeahnt!
Das Bild, welches der schärfste Amerika-Porträtist Europas vom Denken in der Neuen Welt gab – noch bevor dieses Denken der theologischen Phase so recht entwachsen war, entspricht sehr genau dem Bild, in dem sich noch heute die Philosophen Amerikas abmalen. In einem Sammelband, der den Titel ‹Amerikanische Philosophie› trägt und sich auf die Gegenwart bezieht,1 ist auf dem Schutzumschlag folgendes zu lesen: ‹Die europäische Philosophie ist zum guten Teil Schreibtisch-, ja: Kloster-Philosophie. Die amerikanische ist ganz offensichtlich im Freien entstanden; das vielfältige Leben in den verschiedenen Bezirken hat sie zur Entfaltung gebracht.› Das ist haargenau, was TOCQUEVILLE bereits in der prähistorischen Zeit gespürt hatte. Man könnte es übersetzen, falls keine Parteinahme herausgehört wird: die europäische Philosophie ist das Gewächs eines Treibhauses, die amerikanische Naturwuchs. Tatsächlich gab es in den Staaten kein Port-Royal und kein klösterliches Tübinger Stift und keine Philosophie-Novizen wie HEGEL, HÖLDERLIN und SCHELLING, welche die Gedanken und inneren Erfahrungen der großen Denker in sehr frühen Jahren erbten und von Kindesbeinen an trainiert wurden in der Kunst diffizilster Begriffszerlegungen. Sie lebten zwar nicht mehr im Kloster, aber nicht viel anders; reflektierten, meditierten, wohnten in den herrlichsten Gedanken-Palästen und, wie KIERKEGAARD es von HEGEL sagte, als weniger spirituelle Wesen in einem Schweinekoben. Die Amerikaner bauten keine Paläste aus Begriffen – und wohnten etwas Palast-ähnlicher. Sie sind keine Schüler von Mönchen. Sie sind noch heute weniger Schüler als die Europäer.
Der ernsteste Einwand gegen die Bezeichnung der amerikanischen Philosophie als extrovertiert könnte sein, daß dieses Freiluft-Philosophieren eine contradictio in adjecto ist; daß es so etwas nicht gibt, daß schon das Wort Reflexion auf die Richtung jedes Denkens deutet. PLATONS Philosophen-Könige, könnte man sagen, waren keine Philosophen in der Gestaltung des Stadt-Staates und keine Könige in der Erfassung der Wahrheit. Trotzdem bleibt der Unterschied zwischen einem politisch-gerichteten Philosophieren und Reflexionen, deren Triebfeder eher der Wille zur Einsicht ist als eine Absicht. Das Motiv bestimmt die Richtung: auf Differenzierung oder Anwendbarkeit. Amerikanisches Denken ist (in der Regel) weniger subtil und weniger einsam als das europäische; man wird nicht in die Philosophie wie in eine Geheimlehre eingeweiht (außer dort, wo die Philosophie in eine Spezialwissenschaft verwandelt worden ist). Der homo philosophicus gehört nicht zu den großen amerikanischen Vorbildern.
Man sollte ihnen aber nicht ankreiden, daß es unter ihnen keinen ARISTOTELES und keinen SPINOZA gegeben hat. Auch Europa hat in der Zeit, in der auf amerikanischem Boden philosophiert wurde, keine Denker dieser Art hervorgebracht. Man kann nicht die Europäer der fernen Vergangenheit mit den Amerikanern der letzten hundert Jahre vergleichen. Betrachtet man aber auch nur die europäische Philosophie nach dem Tode HEGELS neben der amerikanischen seit der Geburt ihrer ersten Generation, so findet man immer wieder dieses Eindringen in die tiefsten Schächte dort, Erhellung von weit-abliegenden Hintergründen, hier aber das Dringen auf Umgestaltung. Die amerikanischen Philosophen-Könige sind mehr Könige als Philosophen. Allerdings ist diese kurze Formel, noch gültig für die EMERSON-Generation, zu kurz, um zu bezeichnen, was folgte. Einer der aktivsten Denker des heutigen Amerika, SIDNEY HOOK, sprach 1957 in einem Interview über die Art amerikanischen und europäischen Philosophierens. Er sagte: unsere Philosophien treiben uns nicht auf die Straße; unsere Studenten kämpfen nicht auf den Barrikaden für MARX oder den Existentialismus oder andere populäre Theorien. Wir sind mehr interessiert an Lösungen als an Erlösungen; wir sind gegen die verschlammten Abstraktionen. Das klingt zunächst geradezu wie die Umkehrung der Deutungen, die in den Amerikanern die Verwirklicher dessen sehen, was die Europäer nur dachten. Und seltsam ist die ablehnende Erwähnung von MARX; denn es liegt nahe, gerade ihn ‹amerikanisch› zu nennen – in seiner Zurückweisung der Interpretation zugunsten der Änderung, der Meditation zugunsten der Politik. Aber der Amerikaner scheint in MARX einen romantischen Kreuzzügler zu sehen. Änderungen unter dem Blickpunkt der Ewigkeit sind Denkern wie SIDNEY HOOK eher vergrübelte Exzesse als Praxis. Man kommt mit dem Wort Aktivismus hier nicht weit. MARX’ utopische Vision ist für die Amerikaner Mönchs-Philosophie, die zu den Waffen greifen läßt. Sie entdecken auch noch hinter der politischsten Philosophie Europas – den Schreibtisch-Denker.
Man könnte nun erwarten, daß den europäischen Erlösungen die amerikanischen Reformen entgegengesetzt werden. Tatsächlich aber wird von dem Philosophen HOOK nüchterne theoretische Arbeit propagiert. Das sieht abermals wie eine Zurückweisung der These vom zielstrebigen, politisch ausgerichteten amerikanischen Denken aus. Man kann diese überraschende Wendung also kommentieren. Es hat sich auch in Amerika eine Denk-Tradition gebildet, die es in ihrem erlesensten Repräsentanten, CHARLES S. PEIRCE, mit den subtilsten Leistungen der alten und neuen großartigen Scholastik (d.h. hier: Analyse des Begriffs) aufnehmen kann. Sie hat in ihrer modernen Form vor der Ahnin voraus, daß sie sich an die stets sich wandelnde Wissenschaft anhängt und so vor Erstarrung bewahrt bleibt. Der philosophische Scharfsinn wurde in den letzten Generationen auch in Amerika erblich. Und wie in Europa verstärkte sich auch hier die Tendenz, Logik und Erkenntnistheorie und Semantik in den Mittelpunkt zu rücken; vor allem aber jene Disziplin, welche unter vielen Namen die Grundlegungen der Wissenschaften umfaßt; in Amerika vielleicht noch stärker, weil die Überlieferung der prometheischen Philosophie fehlt. In einer kleinen Philosophie-Abteilung des amerikanischen Westens wurden in einem Semester jenen Fächern sechs Vorlesungen gewidmet; drei allein der Logik. Die Neigung, die Philosophie zur Magd der Wissenschaften zu machen – wie sie einmal Magd der Theologie war –, ist in Amerika noch stärker als in Europa. Noch deutlicher zeigt sich der Zug, Philosophie aufzulösen in eine Serie von Spezial-Wissenschaften. Auch in Europa ist die Metaphysik nicht mehr ein absoluter Monarch, nur noch induktiv erwählt – das heißt von Gnaden der zeitgenössischen Wissenschaften … eine Art von konstitutionell-dekorativer Monarchie im Reiche des Wissens. Aber immer noch ist das Bewußtsein lebendig, wenn auch matt: daß Philosophie eher mit der Sphinx verwandt ist als mit dem Laboratorium. In Amerika aber hat von allen philosophischen Strömungen Europas den größten Erfolg der Wiener Kreis, der Neo-Positivismus. Seine ‹Wissenschafts-Nähe› macht ihn ‹amerikanisch›. Die Differenz zwischen dem Philosophieren in Amerika und in Europa ist am besten illustriert in dem, was es in Amerika nicht gibt.
In Amerika wird der Mensch philosophisch kaum in Betracht gezogen; man sieht ihn nicht vor Wissenschaft und Gesellschaft. Er kommt in Europa immerhin doch zu Wort in einem philosophischen Bemühen, für das es keinen Namen in Amerika gibt: in der philosophischen Anthropologie. In den europäischen Existentialismen ist noch etwas von dem in unsere Tage hinübergerettet, was immer den Kern des Philosophierens ausgemacht hat: der Wille zur Überwindung theoretischer Unfaßbarkeiten und lebendiger Abgründe. Amerika hält es aber geradezu für ein Zeichen der ‹Reife›, daß diese Denk-Neigung ausstirbt. Man will eine ‹bescheidene› Philosophie. Die Frage ist: ob es so etwas gibt, ob Philosophie nicht immer Unbescheidenheit war. Hiob und Prometheus, die Urbilder des Philosophierens (Sokrates war nur eine gezähmte Variante), sind die Urbilder menschlicher Unbescheidenheit; ihre letzten Nachkommen waren KIERKEGAARD und NIETZSCHE. Aber JAMES und ADAMS, die ihnen leise ähneln, erlauben keine mythologischen Vergleiche mehr – ganz abgesehen davon, daß sie erratische Blöcke sind in der amerikanischen Landschaft.
Nichts ist bezeichnender für das verschiedene philosophische Klima in Amerika und Europa, als daß hier das Philosophieren der Mystik, der Romantik und SCHELLINGS noch mächtig nachwirkt, während in Amerika ihre modernen Nachfolger zwar importiert – aber nicht aufgenommen werden. Die klassische deutsche Philosophie wurde recht einflußreich; SCHELLING, SCHOPENHAUER und NIETZSCHE blieben Fremde. NIETZSCHE, der Anti-Philister, ist von MENCKEN und seinem Kreise gepriesen worden. NIETZSCHE, der ‹die blonde Bestie› gemeißelt hat, wurde in zwei Kriegen eine cause celèbre: der Vorläufer WILHELMSII. und HITLERS. Aber der Verfasser der ‹Geburt der Tragödie›, der erfolglose Kreuzfahrer gegen den Nihilismus, wird kaum geahnt in einem Land, in dem es nie ein ‹Ecce Homo› gegeben hat. Man hält die ‹Angst› für eine europäische Dekadenz und Exzentrizität, weil die Ideen der Aufklärung in Amerika immer noch so viel Kraft haben, daß sie eine ideologische Immunität darstellen. Ausländische Bücher über die Anarchie der Werte oder den Nihilismus oder die unerlösten tragischen Helden oder die Freiheit in Furcht und Zittern werden wohl auch in Amerika verkauft, aber kaum ernst genommen: man interessiert sich weniger für Grenz-Situationen als für das Normale, weniger für den ungemeinen Mann als für den gemeinen. SPENGLERS ‹Untergang› ist zwar sehr berühmt, aber nur in 20000 Exemplaren verkauft worden; man hielt ihn für pessimistisch und TOYNBEE für religiös-positiv … und zieht das Positive vor.
Amerika hatte immer die ‹Reife›, weder große System-Bauer noch pathetische Destrukteure hervorzubringen. Man kümmerte sich immer weniger um die tiefverschleierte Wahrheit als um das, was der amerikanische Philosoph 1957 die ‹Angelegenheiten des öffentlichen Interesses wie Erziehung und Justiz› nennt. Wie immer man auch über den Erfolg dieser Literatur denken mag, sie ist umfangreich. Man philosophierte (vom theologischen Beginn abgesehen und abgesehen von den zwei außerordentlichen Ausnahmen JAMES und ADAMS) kaum, um das Staunen zu befriedigen und die Verlorenheit zu befrieden. Die europäische Unrast hatte in Amerika kaum ein Echo, wenigstens nicht in der Philosophie. Amerika ist das konservativste und deshalb ideologisch geschützteste Land der westlichen Zivilisation; es lebt, trotz allem, immer noch weich gebettet im Glauben des achtzehnten Jahrhunderts … jedenfalls, soweit mit dem Wort ‹leben› Bewußtsein gemeint ist. Es gibt aber für dies Vertrauen nur ein einziges Wort; man kann es nicht umgehen, obwohl es das am stärksten abgenützte ist: ‹Demokratie›. Es ist das große Deckwort für die amerikanische Philosophie.
3.DIE SIEBEN AMERIKANISCHEN THESEN
Was unter dem Wort ‹Demokratie› in Amerika lebt, ist viel mehr als eine Summe von Institutionen und viel mehr als ein politisches Programm: eine Reihe von amerikanischen Selbstverständlichkeiten, die viel zu großspurig in Erscheinung treten, wenn man sie in die berühmten Abstrakta übersetzt. Alles, was in Büchern Ethik genannt wird oder Wert-Theorie oder Social Philosophy – geht, von einigen formalen Untersuchungen abgesehen, auf die ‹Präambel› zur Declaration of Independence zurück. Amerikanische Psychologen haben festgestellt, es sei eine nationale Eigentümlichkeit, sich anzulehnen – an Tische, Stühle, Wände … Darf man eine Parallele ziehen zu nicht-körperlichen Anlehnungen, so könnte man die ‹Präambel› zur Declaration of Independence den großen ideologischen Halt der Nation nennen. Sie wird zwar historisch eingeordnet, aber kaum in ihrer Problematik entfaltet. In Europa folgte den Ideen von 1789 die Kritik EDMUND BURKES und das Kommunistische Manifest; hundertfünfzig europäische Jahre entfalteten die Fragwürdigkeit der ‹Vernunft›. In Amerika wurde (mit der einen großartigen Ausnahme HENRY ADAMS) die Solidität jener Vorstellungen, welche in der Bibel von 1776 ihren biblischen Ausdruck gefunden haben, kaum untersucht.
Eine gute Illustration bieten Ausführungen des in Schlesien geborenen, als Fünfjährigen in die Staaten verpflanzten, heute fünfundsiebzigjährigen Philosophen HORACE M. KALLEN.1 Er geht ausdrücklich von den Sieben Thesen des Jahres 1776 aus, die man ‹amerikanisch› nennen darf, weil sie in Amerika die Interpretation von der Natur des Menschen beherrschen.
Wir halten diese Wahrheiten einer Begründung nicht für bedürftig:
daß alle Menschen von der Schöpfung her gleich sind;
daß sie von ihrem Schöpfer bestimmte unabdingbare Rechte mitbekommen haben;
unter ihnen Leben, Freiheit und das Trachten nach Glück;
daß es der Sinn einer Regierung ist, diese Rechte sicherzustellen;
daß die Regierungen ihre Berechtigung von der Zustimmung der Regierten herleiten;
daß, wenn immer eine Regierung dieses Ziel zunichte macht, das Volk berechtigt ist, sie zu ändern oder aufzulösen und eine neue zu bilden, deren Fundament auf solchen Prinzipien ruht und deren Macht so organisiert ist, daß sie ein Maximum von Sicherheit und Glück garantiert.
Professor KALLEN untersucht nicht die Vieldeutigkeit der tragenden Begriffe; konfrontiert sie nicht mit den amerikanischen Wirklichkeiten, die sich eher in die entgegengesetzte Richtung bewegt haben – um dann vielleicht tiefer einzudringen in die (von der Declaration deklarierte) ‹Natur› des Menschen.
Der Geist der Sieben Thesen wird in Gegensatz gesetzt (zum Beispiel) zur Vorstellung vom ‹Erwählten Volk›, wie sie sich bei Juden, Griechen, Deutschen und anderen Völkern gebildet hat – zum Beispiel auch (was nicht erwähnt wird) bei den ersten großen Patrioten Amerikas; gerade bei dem übrigens, der diese Thesen vor allem geschmiedet hat. Und es wird bei dieser demokratischen Ablehnung der Auserwähltheit übersehen, daß ihre Verkünder nicht immer Tyrannen waren, Ausbeuter anderer Nationen, sondern auch (wie die Propheten, wie JEFFERSON, wie FICHTE) Männer, die von ihrem Volke verlangten, daß es sich als auserwähltes – bewähre.
Tatsächlich ist solch ein (vom edelsten Überschwang getragenes) demokratisches Denken immer noch fixiert auf die Feinde der Aufklärung im achtzehnten Jahrhundert: auf die streitbare Kirche und die weltlichen Tyrannen. Sind sie heute wirklich die mächtigsten Gegner der Sieben Thesen? Das Christentum des ERASMUS und des JEFFERSON, das KALLEN gegen die Diktatur der Kirchen aufruft, hat sie nicht verwirklicht. JEFFERSONS, ‹Philosophie des Jesus Christus›, die Reduzierung der Evangelien auf ihre sozialen Inhalte, die Eliminierung von Tod und Auferstehung … dieses aufgeklärte Christentum hat sich nicht bewährt. Und die Tyrannei ist noch nicht tot, wo es keine weltlichen und geistlichen Diktatoren gibt. KALLEN zitiert JEFFERSONS ‹Bemerkungen über Virginia›: ‹Kein Mann kann anderen erlauben, ihm den Glauben vorzuschreiben.› Aber das geschieht doch nur noch in wenigen Ländern im alten klassischen Stil, den die ‹Declaration› vor Augen hatte. Wie aber ist es mit jenen anonymen, unsichtbaren und unhörbaren Tyrannen, die im Elternhaus, in der Schule, im Büro, in der Gesellschaft – in der unauffälligsten und unerbittlichsten Weise ‹den Glauben vorschreiben›?
Die dreißiger und vierziger Jahre unserer Tage haben das alte Anti-Tyrannos neu belebt. Aber das Problem der politischen Freiheit ist nicht gelöst mit dem Tod der farbenprächtigen Zaren. Der Demokrat KALLEN wirft den Früheren vor, die in der Vorzeit, also vor 1776, gelebt haben, daß sie, wenn sie vom unendlichen Wert des Einzelnen sprachen, es nicht so recht gemeint haben. Wer aber meint es so recht? Die Einschränkung der Natur des Menschen auf die Sieben Thesen macht alles, was sich hier nicht einfügt, zur Unnatur; unnatürliche Differenzen werden aber selbstverständlich nicht verteidigt. Die politische Philosophie Amerikas wurde, je älter sie wurde, um so – ‹mönchischer›; weniger in Kontakt mit der Wirklichkeit. ‹Es ist zu hoffen›, schreibt KALLEN, ‹daß sich die individuellen Dispositionen dem Gesetz anpassen.› Das ist schon viel kleinlauter als die Gewißheit der Ahnen. Es begann mit der Fraglosigkeit, es ist nun angekommen bei der Hoffnung – und es gibt schon demokratische amerikanische Denker, die bereits beim Nicht-Verzweifeln halten: einer Synthese aus Agnostizismus und stark lädierter Zuversicht.
Die Ideen von 1933 haben nicht wenig dazu beigetragen. In der Zeit von HITLER und MUSSOLINI, damals, als GENTILE die ‹heilige Gewalt› der faschistischen Wahrheit pries, wurde man auch in Amerika besonders darauf hingestoßen, daß diese endgültigen Wahrheiten vor allem auf individuellen Gewißheiten gegründet sind, auf sehr schwachen Fundamenten. Die neue Skepsis hatte ihre amerikanischen Vorläufer. Der Richter WENDELL HOLMES hatte Generationen zuvor gesagt: ‹Wahrheit ist bei der Majorität desjenigen Volkes, das alle anderen Völker schlagen kann.› Vorbereitet von solchen Einsichten, gab man auch in Amerika die demokratische Metaphysik preis. Man ging noch weiter im Zweifel: neben der realistischen und idealistischen Theorie lehnte man auch die pragmatische ab – mit der richtigen Begründung, daß, wenn Wahrheit das ist, was immer wieder neu verifiziert werden muß … sie nie da ist, immer nur Zukunft.
Auch Demokratie, folgerte deshalb ein amerikanischer Essay des Jahres 1937, ist nicht Ausdruck einer Wahrheit, sondern der toleranten Einsicht, daß die Wahrheit aller Kreuzzüge – keine gewesen sei. Auch des Kreuzzugs von 1776? Nun sind aber Politik und Toleranz schwer zu vereinen, weshalb solch eine demokratische Politik ein hölzernes Eisen ist, eine Verbindung von tierischer Begier und den Sehnsüchten der Sieben Thesen. Hier endet also, was so zuversichtlich begonnen hatte: das Ideal des großen Dokuments wird zwar lieb behalten; es wird aber bekannt, daß man wirklich demokratisch – nur noch in der Meditation sein kann. Der Politiker könne sich nie über die Zwänge erheben: über das Ökonomische, über die Bedürfnisse nach Sicherheit. Die Verschmelzung von Philosophie und Politik, welche die Vorfahren so selbstverständlich vorgenommen hatten, ist einer harten Scheidung gewichen. Professor T.V. SMITH1 sagt: ‹Politik hat es mit den Idealen als Träger der Aktion zu tun; Philosophie hat es zu tun mit den Idealen als Gegenstände der inneren Feier.› Für den Politiker sind sie Wegweiser, für den Philosophen Spender des Friedens, ‹Schöpfer einer inneren Heiterkeit›. PLATONS ‹Gesetz der Natur› wird zitiert: daß ‹Handeln der Wahrheit nie so nahe kommen kann wie theoretisches Schauen›. Überschwenglich wird diese ‹innere› Demokratie gepriesen: ‹jeder sein eigener Papst!›, ‹jeder sein eigener Logiker!› In der Philosophie allein werde die Grenze überschritten ‹von der Mittelmäßigkeit des Kompromisses zur Kompromißlosigkeit›. Selbstverständlich könne man nicht immer im Tempel der Weisheit bleiben. Man muß zurück in die Welt der Interessen. Aber man nimmt als unverlierbaren Schatz mit sich, was man in den Stunden der ungestörten Vertrautheit mit dem Ideal genossen hat Die Philosophen sind Priester, die nicht ändern, sondern erheben. Amerika hat, wenigstens in dieser Beziehung, Anschluß gefunden an das ‹mönchische› Philosophieren; allerdings nicht an das problematische.
Hier lebt nicht mehr die Gewißheit, daß der Kompromiß immer weniger kompromißhaft wird; die Ereignisse der dreißiger und vierziger Jahre lasten schwer auf diesen Gedanken. Dennoch wird immer noch nicht die Notwendigkeit gespürt, ein Ideal in Frage zu stellen, das nun weniger ein Wegweiser ist als eine Erbauung. Es liegt aber hier keine Elfenbeinturm-Ideologie vor, kein Sichzurückziehen in die philosophische Klause. Das gibt es kaum unter amerikanischen Denkern. Aber die Hoffnung auf die Zukunft spielt doch eine geringere Rolle als der Trost, den die Philosophie in der Gegenwart spendet. Das Bekenntnis zu den Sieben Grundsätzen entwickelte sich dort, wo man sie ernst nahm, von einem fraglosen Vertrauen zur Anhänglichkeit an eine Reliquie, an der man sich immer noch erbaut, der man aber keine Wunder mehr zutraut.
So ist, was sich in Amerika Ethik, Axiologie (Wertlehre), Sozial-Philosophie nennt, zum größten Teil immer noch eine abstrakte Variation und Rechtfertigung jener Axiome, die bis zum heutigen Tage das am wenigsten in Frage gestellte amerikanische Fundament bilden. Es war europäisch, bevor es amerikanisch wurde. Dreizehn Jahre, nachdem die Staaten es in die Konstitution aufnahmen, verkündete dann die Französische Revolution dieselben Glaubensartikel. Sie verloren ihre Aktualität nicht, sondern gewannen sie neu in den großen europäischen Untersuchungen, die in Freiheit und Gleichheit nicht mehr Atome, letzte Elemente der menschlichen Natur, sondern ganze Welten von Rätseln entdeckten. Auch in Amerika haben jene Göttinnen nicht mehr den Glanz der ersten Tage. Aber eher deshalb, weil man ermüdet ist vom Widerstand des Alltags, als weil man erkannt hat, daß er diese Begriffe zu einer differenzierteren Erfassung provoziert. Die monumentale Fraktur der enthusiastischen Schrift von 1776 enthält Wahrheiten, die heute nur deshalb nicht stimmen, weil sie zu wenig spezifische Züge der Gegenwart enthalten.
Im Lande JEFFERSONS ist manches Alte auch unter der Hand ausgewechselt worden, eher in Anpassung an müdere Tage als in Neuschöpfung. Man hat, in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts, im Gegensatz zu den Ahnen, ‹Gott› ins Pantheon der großen Ideen aufgenommen; zitiert hingegen weniger das ‹Glück›, das allein in der amerikanischen Heiligen Schrift den ihm zukommenden Rang erhalten hatte. Heute stellt der amerikanische Philosoph SHELDON1fest, daß dieses Glück ‹einen schlechten Ruf hat›, daß ‹es kaum einen Mann gibt, der sich zum Hedonismus bekennt›, daß das Glück als ‹Paria der Ethik› vegetiert. Das allein zeigt schon, wie geschwächt der Enthusiasmus ist, der in der ‹Declaration› monumentalisiert wurde. Ein noch stärkeres Zeichen ist, daß selbst dieser Verteidiger ‹die absolute Wahrheit des Hedonismus› in der beruhigenden These findet: ‹Hedonismus ist Altruismus.› Das ist sehr amerikanisch. Stärker als irgendein anderes Motiv herrscht der Wille zur Versöhnung: der ‹Pazifismus der philosophischen Vernunft›. Er stammt aus der Erwägung: ‹Theoretische Konflikte sind weitgehend eine Verschwendung der Energien des Intellekts.›