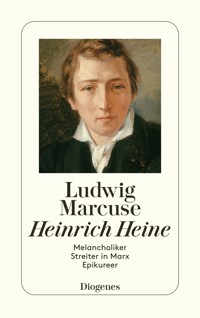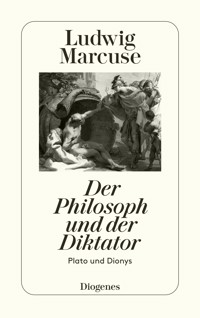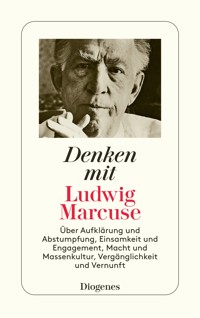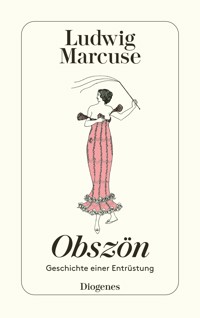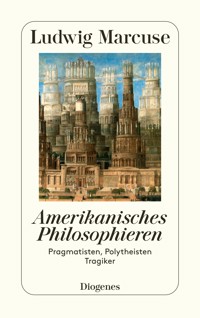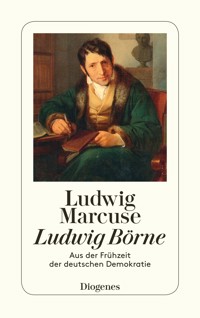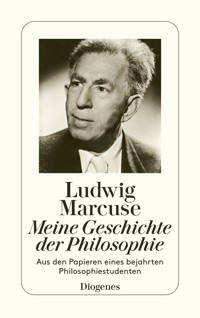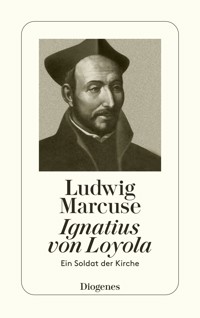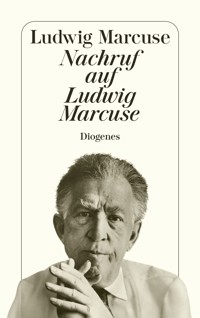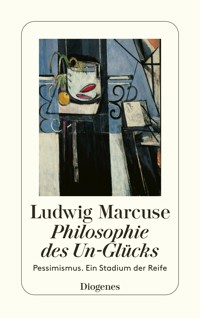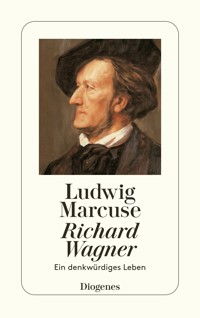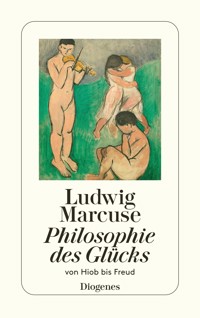
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die ›Philosophie des Glücks‹ gehört zu Marcuses leichten, unterhaltsamen Büchern; es will kein Rezept für Glück liefern, sondern zur eigenen Glückssuche ermuntern; es handelt von verschiedenen Formen des Glücks, von Hiob, Hans im Glück, Seneca, Tolstoi und Freud, von der ›Glücklichen Gesellschaft‹ der Frühsozialisten, vom Glück der modernen Epikuräer Heine, Büchner, Nietzsche…«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Philosophie des Glücks
Von Hiob bis Freud
Diogenes
Für Sascha
I. Was ist Glück?
Was der Leser zu erwarten hat – und was nicht
Es gibt Sehnsüchte, die nicht altern. Sie werden höchstens einmal, von Zeit zu Zeit, unmodern – und dann wieder, von Zeit zu Zeit, modern.
Zu diesen ewig jungen Uralten gehört das Glück. Babylonier, Juden, Inder, Griechen, Chinesen, Römer, Araber, Perser, Byzantiner und viele Glückliche und viele Unglückliche im Jahrtausend danach haben über das Glücklichsein nachgedacht. Und heute denkt wieder Einer nach. Und morgen wird wieder Einer nachdenken. Und nur die Gedankenlosen sagen: Glück – ist nichts als eine Vokabel.
Dieses Buch folgt jenen königlichen Wegen zum Glück, die einige große Vorfahren sich gebahnt haben. Da war zum Beispiel der biblische Hiob. Dreitausend Jahre bevor ›das Streben nach dem Glück‹ als ein Recht in die Konstitution des jungen Staates Amerika aufgenommen wurde, stritt Hiob für das Recht auf Glück, das von der Sinai-Konstitution garantiert worden war. Das ist der große Auftakt gewesen. Und noch Kant, Zerstörer aller Gottes-Beweise, konstruierte im Achtzehnten Jahrhundert einen Gott – aus der Voraussetzung heraus, daß da jemand existieren müsse, der dem Tugendhaften sein Glück verbürgt.
Als man dann – irgendwann nach Hiob – entdeckte, daß keine Macht des Himmels und der Erden für das Glück eines Menschen sorgt, kam man auf die Idee, dieses Glück unabhängig zu machen, sowohl vom Himmel als auch vom Lauf der Welt. Das deutsche Märchen ›Hans im Glück‹ schildert einen sehr jungen Mann, der die ungeheure Entdeckung machte: das Glück liegt in dir. Diese Einsicht hatte sehr große Folgen, die Hans allerdings noch nicht aussprach. Liegt das Glück in mir, so liegt es im Bezirk meiner Macht. Ergo: Jeder ist seines Glückes Schmied.
Dieser Märchen-Hans war also der Erste, der das Glück in die Reichweite des Einzelnen brachte. Das war sein Schritt über Hiob hinaus. Hans war nicht gerade der erste Ratgeber in der Angelegenheit: wie werde ich glücklich? – aber doch gewissermaßen der Ahnherr aller Ratgeber. Erst nach seiner Erfahrung: dieses Glück ist nicht ein Schatz irgendwo draußen, abhängig von einem himmlischen oder irdischen Mächtigen irgendwo draußen – dieses Glück wächst vielmehr in meiner eigenen Seele … wurde es sinnvoll, Anweisungen zum glücklichen Leben zu geben.
Der Klassiker des Glücks lebte dann in Griechenland, um dreihundert vor Christi Geburt. Es war der Grieche Epikur. In Leidenschaft entbrannt für das Glücklichsein, lehrte er seinen Freunden, was für ein großes Glück dieses Glück ist und aus wieviel verschiedenen Quellen man es schöpfen kann. Zugleich errichtete er einen hohen philosophischen Zaun um den Garten dieses Glücks. Denn er war sich bewußt, wie gefährdet es ist. Seit jener Zeit gibt es Epikuräer. Epikuräer sind Leute, welche einen unbändigen Enthusiasmus fürs Glück haben – und außerdem noch sehr auf der Hut sind gegen alle Gefahren, die ihnen drohen.
Der Größte unter den Epikuräern war nicht der berühmte Römer Horaz, der Wein und Weib in Oden und Episteln besang und sich zum Meister bekannte. Der Größte war jener mysteriöse Mann, den man Ecclesiastes zu nennen – und als den trübsten Griesgram der Weltgeschichte zu zitieren pflegt: »Alles ist eitel!« Er lebte, wahrscheinlich, einige Generationen nach Epikur, in Judäa – zur Zeit, da dieses Land überflutet wurde mit griechischen Ideen. Er war erfüllt vom Gedanken an die Nichtigkeit des Daseins – und pries daneben das unermeßliche Glück, da zu sein, pries es um so leidenschaftlicher, je deprimierter er in die Abgründe starrte, an deren Hängen es blüht. Seit Ecclesiastes sind die leidenschaftlichsten Epikuräer jene glückseligen Tragiker, die Trotzdem sagten. Nietzsche war einer von ihnen. Seine Autobiographie mit dem bleichen Titel ›Ecce Homo‹ beginnt mit den strahlenden Worten: »Das Glück meines Lebens …«
Dies also sind die ersten Etappen gewesen: Hiob verkündete, daß Gott, der göttlichen Konstitution gemäß, unter bestimmten Bedingungen den Menschen glücklich zu machen habe. Hans im Glück machte in einer gottlosen Zeit den Menschen unabhängig sowohl vom Schöpfer als auch von den Zufällen der Schöpfung – und verlegte das Glück in den Bereich des Innern; also in den Bereich des menschlichen Willens. Dies Innere erforschte Epikur, betete das Glück an als Quelle alles Guten – und suchte sorgsam, sie einzuhegen. Und der Epikuräer Ecclesiastes fand sogar noch in der düstersten Region der Seele – den Feuer-Strom des Glücks.
Aber der philosophische Zaun um den Garten des Epikur machte aus diesem Garten noch nicht eine uneinnehmbare Festung. Das epikuräische Glück war doch recht anfällig. So versuchte man, sich zu helfen, indem man aus dem glücklichen Alltag ausbrach – nicht in eine Garten-Oase, sondern in viel sicherere Regionen jenseits des Alltags. Man brach aus der Welt der Gebundenheit, wo man gebunden war an den Nexus von Wunsch und Befriedigung, aus in das Reich der Freiheit, wo man frei war, nichts mehr wünschen zu müssen. Da lebte im Ersten Jahrhundert nach Christi Geburt der Stoiker Seneca. Er fragte: »Hat der Mensch nicht die Kraft sich unabhängig zu machen von allem, was ihn feindlich treffen kann? Er braucht doch nur in Gleichgültigkeit, in Kälte gegen die Welt – nichts an sich kommen zu lassen.« Dies Erlebnis der Unabhängigkeit, der Freiheit, des Mir-kann-nichts-geschehen gab Seneca und den Seinen ihr Glück, dieses Stoiker-Glück: ein ungefährdeteres Glück, als Epikur es genossen hatte.
Auch ein römischer Schriftsteller aus Afrika, Augustinus, versuchte es im Vierten Jahrhundert nach Christi Geburt mit dem stoischen Glück. Er aber wurde nicht glücklich damit. Er fand, nach vielen Abenteuern, sein Glück erst – im Glauben an seinen Erlöser. Der schenkte ihm das Vertrauen, das er brauchte, um glücklich zu sein. Im Schutze Christi blühte in ihm jenes so sinnlich blühende Glück auf, das er dann aufzeichnete unter dem Titel ›Der Gottes-Staat‹. Jedoch ist eine solche Antizipation des Glücks nur für die ein Glück, die fähig sind, in einer vergegenwärtigten Zukunft zu leben.
Mancher – in jener Aera, in der man auf den Gottes-Staat wartete – wollte nicht verzichten auf diese Vor-Freu-de, doch ebensowenig auf das weniger große, aber realere Glück, welches die Gegenwart bisweilen und dann sofort zu vergeben hat. Es gab Menschen, die sich im Palast sehnten nach dem glücklichen Frieden des Klosters, und im Kloster nach den gar nicht friedlichen Freuden des Palastes. Ein solcher Mann war um das Jahr Elfhundert der glückliche Höfling und glückliche Mönch Psellus, den man wegen seiner enormen Gelehrsamkeit den Aristoteles von Byzanz nannte. Er näherte sich in seinem Leben auf zwei geradezu entgegengesetzten Wegen dem Glück – fand es hier und fand es da, fand es hier nicht ganz und fand es da nicht ganz. Und gehörte zu jenen, deren Leben uns lehrt, daß es einen Plural von Glück gibt – und daß diese Mehrzahl, die nach den Gesetzen der Logik bisweilen widerspruchsvoll ist, in Wirklichkeit ausgezeichnet zusammengehen kann.
Die großen Glücks-Chausseen sind allerdings schnurgerade. Schnurgerade sind die Bahnen des glücklichen Stoikers und des glücklichen Heiligen – und schnurgerade ist die Bahn des glücklichen Denkers. Niemand aber hat so vollendet wie Spinoza das Glücklichsein im Denken beschrieben. Niemand hat so klar wie er ausgesprochen, daß er nachdachte, um glücklich zu werden – und im Erkennen sein Glück fand. Und niemand hat dieses besondere Glücklichsein so klassisch vorgelebt: kein griechischer Denker und kein mittelalterlicher.
Im Achtzehnten Jahrhundert war dann – unter den englischen Moralisten, den französischen Enzyklopädisten, den deutschen Aufklärern, den amerikanischen Gründern der Republik – sehr viel die Rede vom Glücklichsein; fast ebensoviel, wie im Neunzehnten vom Unglücklichsein. Aber erst dem Neunzehnten Jahrhundert gehören jene zwei Männer an, welche im Zeitalter des Kapitalismus, der Technik, der Massen-Kultur und der ungestillten religiösen Sehnsucht riesenhafte Anstrengungen machten, glücklich zu werden und Glück zu verbreiten: der englische Fabrikant Robert Owen und der russische Glücks-Sucher Leo Tolstoi. Sie haben zwei große Möglichkeiten, zum Glück zu gelangen, exemplarisch vorgelebt: die politische, in der Etablierung einer Glücklichen Gesellschaft; und die moralische, in der Etablierung des inneren Reichs eines glücklichen Heiligen.
Am Anfang des Neunzehnten Jahrhunderts suchte der englische Fabrikant Robert Owen die Glückliche Gesellschaft zu gründen: zuerst in Schottland und dann in Amerika. Seine Experimente sind charakteristisch geworden für viele Versuche zur Verwirklichung des Glücks in den letzten hundertundfünfzig Jahren. Für Epikur, für Seneca, auch noch für Augustin ist das Glück sozusagen Privatsache gewesen; die eigenste Aufgabe und das eigenste Werk. Im Neunzehnten Jahrhundert wurde es öffentlichste Angelegenheit. Der Einzelne, fand man, kann nur im Schoß einer Glücklichen Gesellschaft zu seinem Glück gelangen. Owen war allerdings noch individualistisch genug, zu glauben: ein Einzelner könne diese Gesellschaft mit einem Handstreich in die Welt setzen.
Am Ende jenes Jahrhunderts jagte dann Tolstoi dem Glück nach – sowohl auf den gebahnten Wegen als auch durch viele dunkle Gründe. Das Wort Glück ist in seinen Werken, Tagebüchern, Briefen auf vielen, vielen Seiten. Er hielt nichts von der Glücklichen Gesellschaft, weil sie höchstens durch Gewalt herzustellen sei. Auch hielt er, der größte Künstler seiner Zeit, nichts von der Diktatur des Schönen Scheins, dem Wagner in Bayreuth gerade den üppigsten Tempel errichtet hatte. Der große Epiker konnte nicht glücklich werden im Schönen Schein, den er schuf. Er suchte das Glück im radikalen Gutsein. Der Glückliche Heilige, der auf keinen Himmel wartete, war sein Ziel.
Auf so vielen Wegen und Umwegen suchten sie glücklich zu werden.
Welchen Gewinn aber haben wir davon, diesen Wegen und Umwegen nachzugehen? Diese Trunkenen des Glücks, diese Propheten des Glücks, diese Pioniere zum Glück geben Schutz gegen die beiden berühmten Irrlehren, die seit je dem Menschen das Glück auszureden suchten. Die eine sagte immer: das Unglück ist das entscheidende Ereignis des Daseins. Das sogenannte Glück ist nichts als Eindämmung, vielleicht sogar Aufhebung des Unglücks. Schon der Platonische Sokrates entwickelte diese Theorie. Wer auf ein anderes Glück aus ist, sagten sie, wer die Illusion hegt, daß es ein positives Glück gibt, öffnet nur Tür und Tor dem Unglück. Ein glückliches Leben ist ein Leben, das frei ist – von dem hoffnungslosen Streben nach Glück.
Die Glücks-Rezepte, die auf diesem Boden wuchsen, rangieren von der milden Mahnung, nicht so viel vom Leben zu wollen – bis zum radikalen Befehl: die Beziehung zum Leben auf ein Minimum herabzusetzen. Vom indischen Dhammpada und einigen christlichen Kirchenvätern bis zu den englischen, deutschen, französischen Pessimisten des Neunzehnten und Zwanzigsten Jahrhunderts scheint dies Rezept in immer neuen Formeln verkündet worden zu sein.
Die andere, gemäßigtere Lehre gegen das Glück sagt immer: Glück und Unglück werden sehr überschätzt in ihrer Bedeutung für das Leben des Menschen … Vor allem waren es die idealistischen Philosophen, denen es nicht so sehr um Glück und Unglück zu tun war als: um die Erfüllung der sogenannten Bestimmung des Menschen. Nicht daß sie leugneten, es gäbe auch so etwas wie Glück. Aber sie hielten es für übertrieben, soviel davon herzumachen. Es gehöre nicht zu den ganz großen Dingen des Daseins, sagten sie. Empfinde man, sagten sie, beim Essen oder bei der Lösung eines Problems oder bei der Durchsetzung eines Gesetzes auch noch nebenbei Glück – um so besser. Man ist kein Kostverächter. Es ist eine ganz hübsche Beigabe, dieses Glück. Es ist eine freundliche Laune des Geschicks, uns auch noch Glück empfinden zu lassen – anläßlich der ernsten Unternehmungen, die wir als nahrungssuchende Wesen oder als Förderer der Wissenschaft oder als Wähler des Bezirks XVI in die Wege leiten. Aber dieses Glück ist eben nur – wie man sich im Zeitalter der Industrie am besten ausdrücken mag –:ein Nebenprodukt. –
Die Enthusiasten des Glücks, die in diesem Buch dargestellt werden, sind Zeugen gegen diese Irrlehren. Und nicht nur mit ihren Argumenten; vor allem mit ihrem Leben. Denn sie philosophierten über das Glück im Überschwang des Glücks – oder des Unglücks. Es kam ihnen nicht auf eine wissenschaftliche Untersuchung an. Es kam ihnen darauf an, ihr Glück herauszusingen oder ihr nach Glück sehnsüchtiges Herz zu befriedigen. Dabei kamen sie, in vielen verschiedenen Prägungen, zur Ablehnung aller anderen Götter neben dem Glück. Der englische Philosoph Priestley drückte dies einmal so aus, im Jahre 1768: Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit hätten in sich nichts Herrliches – wenn man von ihrer Beziehung zum Glück des Menschen absähe … Man kann hinzufügen: auch die Vernunft und die Freiheit und der Fortschritt und die Kultur haben in sich nichts Herrliches, wenn man von ihrer Beziehung zum Glück des Menschen absieht. Es ist erst dieses Glück, das allem Schönen und Guten seinen Wert verleiht.
Die Vertiefung in die Geschichte des Glücklichseins soll den Willen zum Glück aufhellen und kräftigen. Was aber fängt man an mit der glühendsten Begeisterung fürs Glück und mit dem profundesten Wissen ums Glück? Auch der leidenschaftlichste Wille, auch das umfassendste Wissen gibt uns kein Glück. Der Leser hält die Hand hin. Er will ein Rezept.
Der Leser, der vor einem Buch sitzt, kann mit seinem Widerspruch nicht an den Autor heran. Deshalb ist es die Pflicht des Autors, sich auch noch zum Vertreter seines ernstesten Opponenten zu machen. Ich sehe vor mir einen, der sagt: ich will gar nicht wissen, was irgendwelche mehr oder weniger uralten Asiaten und Europäer über das Glück gedacht haben. Wozu dieser Umweg, der dazu noch nirgendwohin führt? Mir ist es allein darum zu tun, wie ich noch in diesem Kalenderjahr glücklich werden kann. Ich will nicht Bildung, ich will ein Rezept. Für Bildungsgierige sind genug Enzyklopädien da. Bildung in einer solchen brennenden Frage führt immer nur zur vornehmen Verschleierung, daß der Autor auch keinen Rat weiß … Und an dieser erregten Rede ist etwas dran. Wie lautet das Rezept?
Es gibt ganz gewiß Mittel gegen das Unglücklichsein. Ein Fakir, zum Beispiel, falls er ein guter Pädagoge ist, kann Schüler trainieren zu Schmerzlosigkeit und Leidlosigkeit. Es gibt dann auch noch Rezepte für Glücks-Pillen, wie es Rezepte für Schlaf-Pillen gibt. Man kann das Glück ebenso gut zwingen wie den Schlaf. Und die Apotheke ist nicht unbekannt. Übrigens sind die chemischen Medikamente weniger in ihrer Wirkung vom Individuum abhängig und zuverlässiger als die psychologischen. Alkohol und Opium sind der Erfahrung nach genereller wirksam als der Film.
Aber dies Glück meint der Leser nicht, der sein Rezept will. Ihm schwebt (wenn auch noch so unklar) ein Glück vor, das den grauen Alltag durchdringt, ihn auflöst in Helle; während jedem verschriebenen Glück, jedem Glück, das die Nerven kurzfristig vergewaltigt, nach dem Rausch ein nur noch glückloserer Alltag folgt.
Kurz: der Leser sucht jenes berühmte Glück, welches die Philosophen immer meinten, wenn sie von ihm sprachen. Was ist das für ein Glück? Was ist Glück?
Definitionen, die Konfessionen sind
Der römische Denker Seneca, der Lehrer des Kaisers Nero, schrieb im Ersten Jahrhundert nach Christi Geburt an seinen Bruder einen dreißig Druckseiten langen Brief über ›Das Leben im Glück‹. Das Schreiben begann mit dem Satz: »Glücklich zu leben, Bruder Gallio, ist der Wunsch aller Menschen.« Seneca hielt diesen Wunsch geradezu für ein ›natürliches Verlangen‹.
Zugleich sah er aber auch, daß die Befriedigung dieses natürlichen Verlangens höchst problematisch ist. Denn es ›fehlt die Einsicht, wodurch man glücklich wird‹. Das ist die Meinung vieler Doktoren des Glücks gewesen. Sie hielten die Unwissenheit über den Weg zum Glück für fast ebenso verbreitet wie den Wunsch, glücklich zu werden.
So schrieb zum Beispiel (sechzehnhundert Jahre nach Seneca) der Denker Spinoza am Ende seines Hauptwerks, der ›Ethik‹, einen Absatz, in dem wieder von dieser Unwissenheit der Menge über den rechten Zugang zum Glück die Rede ist. »Wie wäre es möglich«, heißt es dort, »daß das Glück von allen vernachlässigt wird, wenn es offen vor uns läge und ohne Mühe gefunden werden könnte.« Natürlich möchten alle glücklich leben. Nur sind sie nicht fähig oder machen sich nicht die Mühe, das Glück zu finden. Spinoza hingegen bemühte sich sehr.
Diese Mühe ist seit je die eigentliche Mission der Philosophen gewesen – auch wenn sie das nicht immer anerkannt haben. Ja, oft haben sie diesen Anspruch ganz ausdrücklich abgewiesen. Und viele, die heute den erlauchten Namen ›Philosoph‹ tragen, halten es geradezu für unseriös, jenen vagen Begriff Glück, wie sie sagen, jene sentimentale Überschwenglichkeit Glück, wie sie sagen, ernst zu nehmen. Aber die Umwandlung der Philosophie in Geschichte der Philosophie oder Erkenntnistheorie oder Soziologie ist nichts als ein Zeichen für die Abwesenheit von Philosophie.
Wo es Philosophen gab, gab es auch das rätselhafte Glück. Oft genug versicherten sie allerdings: die Frage, die es stellt, sei bereits gelöst; und es läge nur an den unbelehrbaren Menschen, daß sie noch nicht glücklich seien. Die Menge, hieß es, ist nicht nur zu dumm, das Glück zu finden. Sie ist sogar zu dumm, das von den Philosophen Gefundene in Empfang zu nehmen. Deshalb ermahnte Seneca seine Mitmenschen immer wieder: sich doch auf der Reise zum Glück ›nicht ohne Kundigen‹ zu entscheiden, ›wohin man wolle – und auf welchem Wege‹.
Aber wie, wenn jeder ›Kundige‹ etwas anderes kündet? Die Unphilosophischen können sich gegen den Vorwurf der Philosophen sehr leicht verteidigen – mit dem Hinweis auf jedes Lexikon der Philosophie. Dort ist nachzulesen, was alles schon einmal als ›Glück‹ definiert worden ist. Der gebildete Römer Marcus Terentius Varro rechnete aus, daß zu seiner Zeit 288 verschiedene Lehrmeinungen über das Glück existierten. Und das ist bereits zweitausend Jahre her. Es liegt also ganz gewiß nicht an der sogenannten blöden Masse, daß man das Glück nicht zu finden weiß.
Liegt es an den Philosophen, die sich nie einigen konnten? Das Wort Glück hat in allen Sprachen etwas Vieldeutiges. Es ist wie eine Sonne, die eine Schar von Wort-Trabanten um sich herum hat: Behagen, Vergnügen, Lust, Zufriedenheit, Freude, Seligkeit, Heil. Jede dieser und ähnlicher Vokabeln hat dann und wann schon einmal die Sonne gespielt, das Wort Glück vertreten – stand aber auch dann und wann schon einmal im heftigsten Gegensatz zum Glück. So ist das ›Glück‹ mit Bedeutungen schwer beladen. Propheten, Poeten, Denker haben ihre Theorien und Visionen vom Menschen und seinem Glück diesem Wort aufgeprägt – bisweilen auch noch den Widerspruch gegen die Glücks-Theorie ihrer Gegner. Manchmal versteht man dies Wort überhaupt nur, wenn man weiß, gegen wen es gemünzt worden ist. Ich kannte einen alten Gelehrten, der den griechischen Ausdruck für Glück (Hedone) nicht aussprechen konnte, ohne daß sich sein Gesicht vor Ekel verzerrte.
So ist das Wort Glück ein Ablade-Platz für die Ideen und Wertungen von Jahrhunderten geworden. Man vergleicht solch ein Wort am besten uraltem, verwittertem und bemoostem Gestein – diesem Ablade-Platz für tausendjährige chemische Prozesse. Zwar wird an jedem Tag von neuem und leichtsinnig der Versuch gemacht, es säuberlich zu definieren. Doch diese kleinen definitorischen Sätzchen, die so duftig und adrett antworten auf die Frage: was ist Glück?, decken sie nur mit ärmlichen Antworten zu. Sie setzen hinter eine lange Geschichte des Nachdenkens – eine kurze Gedankenlosigkeit. Weshalb aber hat niemand die große, abschließende Antwort gegeben – obwohl es so viele Antworten gibt?
Man kann mit dem Finger hinweisen auf dieses Glück. Es ist nicht nur zu fühlen, es ist auch zu sehen und zu hören. Es erscheint in den Augen eines Menschen, in seiner Stimme, an der Nasenspitze, um den Mund herum, in der Haltung. So haben es die Künstler aller Zeiten beschrieben, abgebildet, in Musik gesetzt. Weshalb ist es nicht zu definieren, wo es doch mit den Händen zu greifen, mit den Augen zu sehen, mit den Ohren zu hören ist?
Aus demselben Grund, aus dem (zum Beispiel) das ›Christentum‹ nicht zu definieren ist. Man lese nacheinander: die Worte Christi, die Briefe des Paulus, die Poesie des Franciscus, die Exercitien des Loyola, die Schriften des Meister Eckhardt, die Traktate Kierkegaards, die Aphorismen Nietzsches – und mache den Versuch, alle diese hervorragenden Äußerungen in eine Definition zu pressen: Christentum ist …
Ganz ebenso ist es mit der langen Reihe der Definitionen: Glück ist … Sie zeigt: was alles schon einmal Glück gewesen ist; was alles schon einmal jemand glücklich gemacht hat; wie vielfältig der Mensch Glück hervorgebracht hat. Das eine Glück erhält seine vielen Gesichter von den zahllosen Ursprüngen, aus denen es wuchs. Das große Glück ist wahrscheinlich kein Plural; aber seine Herkunft ist plural. Und alle herrischen, beschränkenden, beschränkten Definitionen: ›Glück ist …‹, stammten aus dem Irrtum, daß Glück nur auf einem einzigen Wege entstehen kann. Dieser Irrtum aber geht darauf zurück, daß der oder jener wirklich nur auf diesem oder jenem Wege Glück produzieren konnte. Ein einzelner hatte infolge seiner begrenzten Anlagen fürs Glüddichsein (seine körperliche, charakterliche, soziale, weltgeschichtliche Beschränktheit begrenzte ihn) nur diesen einen Weg, glücklich zu werden. So definierte er das Glück auf der Grundlage seiner spezifischen Möglichkeit, es zu erlangen. Jeder Einzelne ist ein spezifisches Glücks-Potential.
Einer ist besonders begabt für körperliches Glück, ein anderer für geistiges. Einer hat Talent nur für das Glück, das der Gaumen und das Geschlecht gibt; ein Talentierterer entdeckt, daß selbst die traditionellen Fünf Sinne nur eine winzige Auswahl der Pforten sind, durch die das Glück in einen einziehen kann. Einer fand im Denken alles Glück und einer im Weg-Denken. Die Geschichte des Glücklichseins ist lang und reich. Nur die ganze Geschichte, nicht eine ihrer Episoden kann das Glück definieren.
Das Glück war nicht fertig am Siebenten Tage – ebensowenig wie der Himalaya und das Mittelmeer. Adam und Eva im Paradies erlebten wahrscheinlich noch nicht das Glück eines Sonnen-Aufgangs in der Wüste. Epikur erlebte wahrscheinlich noch nicht das Liebes-Glück Romeos und Julias – und Seneca noch nicht das Spinozasche Glück der intellektuellen Liebe zu Gott. Die Geschichte der Kultur ist ganz gewiß auch eine Geschichte des immer differenzierteren und abgründigeren Unglücklichseins. Sie ist aber daneben ebenso eine Geschichte des immer umfänglicheren Glücklichseins. Und diese Geschichte hat noch eine Zukunft. Man kann die Vergangenheit nicht aufsummieren in ein: ›Glück ist …‹ Und man kann die Zukunft nicht abschneiden mit einem: ›Glück ist …‹
Definitionen des Glücks waren also stets: kleine Gedankenlosigkeiten oder große Konfessionen. Einer bekannte, was ihn glücklich machte. Wenn er sagte: »Glück ist …«, so meinte er (auch wenn er es nicht wußte): ›Mein Glück ist …‹ Die Geschichte des Glücklichseins ist die Geschichte jener Menschen, die ihr Glück suchten und fanden. Deshalb geben wir dem Leser, der eine Definition will, nicht, was er will. Ja, er sei ausdrücklich davor gewarnt, sich mit einem Vorbild zu identifizieren. Das ist meist Selbst-Betrug. Man lebt sich ein in fremdes Glück – und versäumt dabei sein eigenes.
Doch ist dies vorbildliche Glück nicht gleichgültig. Die Menschheit hat, im Lauf eines langen und breiten Lebens, viel Glück durchlebt und durchdacht. Das geschah auch für Dich und für Mich. Was da in mehreren tausend Jahren an den verschiedensten Punkten der Erde – in Jerusalem und Athen und Rom und Byzanz und Amsterdam und Moskau – erarbeitet worden ist, kann nicht schlicht übersehen werden. Der Blick auf jene große leuchtende Reihe von Epikur bis Nietzsche schenkt zwar kein Rezept, nicht einmal eine Definition. Aber macht Mut zum eigenen Glück; nährt das eigene Talent zum Glück. Und belehrt mich über die Wege, die gangbar, und die Wege, die nicht gangbar sind – zu Meinem Glück.
Mein Glück – das kann nur meine Schöpfung sein, die niemand mir abnehmen kann. Glücklichsein ist eine Kunst, wie man seit je weiß. Um ein Künstler zu werden, braucht man Begabung, Fleiß und Vorbilder. Um ein Glücklicher zu werden, braucht man dasselbe. Wer ein Glücks-Rezept verlangt, ähnelt einem Mann, der ein Dicht-Rezept verlangt. Begabung und Bemühung muß jeder von sich aus beibringen. Doch kann er deshalb noch nicht auf die Vorbilder verzichten. –
Wer aber auf das Glücklichsein verzichtet, erfüllt sein Dasein nicht. Denn Jeder ist – der Anlage nach: eine neue Variante des Glücks. –
II. Hiobs Recht auf Glück
Im Alten Testament werden die Freuden des Daseins oft und gern gepriesen. Es ist in hohem Maße ein Testament der Fröhlichkeit.
Im Talmud wird ein Weiser zitiert, der im Leben ein Hochzeits-Fest sah. Einer seiner Zeitgenossen verkündete sogar: Gott wird die zur Rechenschaft ziehen, welche die guten Dinge des Daseins nicht genossen haben. Und ein anderer lehrte: »Die ganze Welt ist geschaffen worden, damit der Mensch sein Vergnügen finden kann.«
Das Glück der biblischen Welt fließt aus dem guten Einvernehmen zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf. In einer Atmosphäre von Vertrauen genießt man froh alle guten Dinge. Man gehorcht seinem Herrn, baut auf ihn – und es ist sein Wille, daß sein gehorsam-gläubiges Kind glücklich ist. Gott dienen und das Dasein genießen, ist nicht von einander zu trennen. Frömmigkeit und Glück gehören zusammen. Gott liebt einen vergnügten Gottesdienst. Die religiösen Festtage sind zugleich Tage gesteigerter Lebensfreude. »Du sollst fröhlich sein vor dem Herrn.«
Nun erlebte das Volk des Alten Testaments im Sechsten Jahrhundert vor Christi Geburt das Unglück des nationalen Zusammenbruchs und der Babylonischen Verbannung. Und es waren genug Schriftsteller da, die nachwiesen, daß dieses Unglück wohlverdient war. (Das läßt sich immer nachweisen.) Aber da war mindestens Einer, der zweifelte die Gleichung von Frömmigkeit und Glück, von Unglück und Gottlosigkeit radikal an. Dieser Eine hieß Hiob.
Das Fundament jener Juden, die (wie Hiob vor seinem Unglück) im Glauben an den Sinai-Bund lebten, war: das Recht des Menschen auf Wohlergehen, falls er selbst seinen Teil des Bündnisses mit Gott erfüllt. Dieses (bedingte) Recht auf die Freuden des Daseins, garantiert vom Schöpfer und Regenten der Welt, ist eine tiefe Überzeugung gewesen, die nicht nur im Jahrtausend vor Christi Geburt und nicht nur an einer einzigen Stelle der Erde herrschte. (Und sie herrscht hier und da noch heute.)
Hiob aber wurde der große Ahnherr, der diesen Glauben erschütterte. Und alle späteren Ratgeber in der Frage: wie man zum Glück kommen kann, wurden erst notwendig, nachdem Hiob gezeigt hatte: daß Glück nicht die Belohnung für ein frommes Leben ist, verbürgt von einer konstitutionellen göttlichen Welt-Regierung.
Die ungeheuerliche Geschichte eines siebzigjährigen frommen Mannes
Vor dreitausend Jahren (oder noch einige Jahrhunderte früher) lebte im Norden Arabiens ein mächtiger Scheich, dem siebzig Jahre lang alles gedieh – und dem es dann plötzlich sehr schlecht ging. Und da diese Wendung vom Glück zum Unglück schnell und schroff war, stellte der Mann, der so schrecklich betroffen wurde, höchst ausschweifende Fragen. Das Leben wurde ihm ungemein fragwürdig. Von einer Stunde zur andern merkte er, daß das Glück und das Unglück ein ganz schweres Problem sind.
Dieser denkwürdige Mann, Hiob, existierte zu seiner Zeit in einer Gegend mit dem Namen Uz – und in den Zeiten seitdem, bis zum heutigen Tag, im Gedächtnis der Menschheit. Vielleicht existierte er auch gar nicht; und er ist nur die Erfindung eines jüdischen Schriftstellers gewesen oder eines jüdischen Schriftsteller-Kollektivs, etwa aus dem Fünften Jahrhundert vor Christus. Auch weiß man nicht, wer der Biograph oder der Dichter dieses Hiob gewesen ist. War er ein Réfugié, der von Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt war? Oder der Enkel eines solchen Mannes?
Diese unbeantwortbaren Fragen sind jedoch nicht so wichtig wie andere, die man eher beantworten kann: woher stammt, Hiobs Meinung nach, das Unglück? Und kann man sich sein Wohlergehen verdienen?
Hiob war ein mächtiger Großgrundbesitzer. Er besaß 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder, 500 Eselinnen, 7 Söhne, 3 Töchter und reichlich Gesinde. Er nahm also ziemlich viel Platz auf der Welt ein. Weit und breit war niemand so glänzend wie er.
Die Stammesgenossen waren geblendet von so viel Glanz. Die Jungen gingen aus Ehrerbietung beiseite, wenn sie seiner ansichtig wurden. Die Spitzen der Behörden legten sich die Hand auf den Mund, sobald er in eine ihrer Beratungen zu kommen geruhte. Wenn er gesprochen hatte, wurde nichts mehr hinzugefügt. Einer Rede von ihm folgte das Schweigen der Andacht – das in unserer Welt kaum noch bekannt ist.
Gott ging mit ihm um, wie Herren mit ihrem besten Knecht umzugehen pflegen. Der hohe Herr war sehr zufrieden und sah auf ihn, wie man auf ein Prunkstück sieht. Man konnte Staat mit ihm machen. Er war ein Vorbild an Tugend. Er beschützte die Witwen, die Waisen und die Armen, die Blinden und die Lahmen. Den Ungerechten zerbrach er die Backzähne und riß ihnen den Raub wieder aus dem Maul. So war er prächtig von innen und von außen; und fühlte sich so. Er war im Einklang mit sich, mit den Mitmenschen und mit seinem Gott. Die Zukunft war ebenso licht wie die Gegenwart. Hiob war glücklich.
Da geschah das Folgende. Eines Tages trat ein Bote bei ihm ein und meldete eine peinliche Geschichte. Eine Nomaden-Bande war von Saba her eingebrochen, hatte Hiobs Rinder, die gerade pflügten, weggefangen, hatte auch Hiobs Eselinnen, die auf der Weide waren, mitgenommen und Hiobs Knechte getötet. Nur der Bote dieser Hiobs-Post war entkommen.
Hiob hatte noch keine Zeit gehabt, die schlechte Nachricht zu verdauen, als ihm der Verlust seiner sämtlichen Schafe und Hirten gemeldet wurde. Ein Feuer hatte sie weggefressen. Und schon war ein dritter Unglücks-Bote da; das Unglück trat offenbar mit verteilten Rollen auf. Der Dritte erzählte von drei Haufen chaldäischer Männer, welche die Kamele gestohlen und die Kamel-Treiber hingemacht hatten. So ging Stück für Stück des mächtigen Besitzes vor die Hunde.
Der letzte Kurier, der den vorletzten wie aufs Stichwort ablöste, brachte die schlimmste Neuigkeit. Hiobs Ältester hatte an diesem Tag seine Brüder und Schwestern zu einem guten Essen geladen. Man tafelte recht vergnügt, als es plötzlich sehr stürmisch wurde. Schließlich packte der Wind das Haus und deckte mit ihm Hiobs Nachkommenschaft so gründlich zu, daß niemand von ihr die Sonne wieder sah. (Übrigens, als der reiche Mann so viel, ja alles verlor – behielt er immer noch sein Weib. Wollte der Autor, der doch einen gründlichen Bankrott zu schildern hatte, damit sagen: daß der Verlust der Ehefrau nicht so beträchtlich ist?)
Schließlich traf ihn noch ein Schlag, ganz ohne Boten. Heute würde man das so darstellen: die furchtbaren Aufregungen, die der alte Mann hatte durchmachen müssen, kamen in einer Hautkrankheit an die Oberfläche. Aber wie auch der ursächliche Zusammenhang gewesen sein mag: Hiob war plötzlich von Kopf bis Fuß mit stinkenden Geschwüren übersät.
Da saß nun der glänzende Agrarier, ganz ohne Glanz – und war gar nicht mehr Er. Was früher einmal sein Antlitz gewesen war, war nun aufgeschwemmt und häßlich gefleckt. Die Zähne standen kahl herum in der Einöde eines schattenhaften Gesichtes. Und so schattenhaft war der ganze Mann. Er fiel vom Fleisch und glich einem traurigen Geist, der zum Zeichen der Trauer Haut und Knochen angelegt hatte. (Moderne Diagnostiker sind der Ansicht, daß Hiob Elefantiasis gehabt hat.)
Natürlich benahm sich die Umgebung gegen ihn nicht mehr wie gegen Hiob. Die Gattin konnte den Gestank nicht aushalten. Das Personal hatte vor so einem Herrn nicht den leisesten Respekt. Man antwortete nicht einmal mehr, wenn er schellte. Selbst jenes verachtete, gottlose Gesindel, das man irgendwann wegen irgendeines Vergehens aus dem Lande herausgejagt hatte, sang nun Spottlieder auf die einstige Zierde von Uz.
Trotzdem verlor Hiob den Kopf nicht; er blieb sich noch eine ganze Weile treu. Das heißt: er blieb noch eine ganze Weile dem alten Hiob treu. Gewiß, er zerriß sein Kleid, er raufte sich das Haar. Und laut posaunte er seinen Bankrott in die Welt: »Ich bin nacket von meiner Mutter Leibe kommen, nacket werde ich wieder dahinfahren.« Das fällt einem Menschen meist erst dann ein, wenn er keine guten Kleider mehr anzuziehen hat. Aber Hiob sah doch auf seine gar nicht erbauliche Nacktheit immer noch mit den frommen Augen des Besitzers von einst – und sagte, ganz friedlich: »Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen; der Name des Herrn sei gelobt.« (Die Weltanschauung eines Menschen hält sich oft noch – auch wenn er schon gar keinen Grund mehr für sie hat.)
Frau Hiob – die ihren Mann vielleicht loswerden wollte, vielleicht meinte sie es aber auch wirklich gut – redete ihm heftig zu, sich das Leben zu nehmen. Da wurde er geradezu unhöflich – und nicht nur zu ihr, sondern zum ganzen weiblichen Geschlecht; er flüsterte etwas von närrischen Weibern. Er war ganz und gar gegen Selbstmord. Und er hatte auch schon eine Theorie dafür – ebenso, wie sein Zeitgenosse, der indische Buddha, und wie Buddhas später Nachfahr, der Deutsche Schopenhauer. Selbst Pessimisten gehen ungern so weit. Hiobs Theorie gegen den Selbstmord lautete: haben wir Gutes empfangen von Gott, so dürfen wir nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn es einmal nicht so gut ist.
Er konnte also schon eine ganze Portion vertragen. Bis dann das Schlimmste eintrat: einige gute Freunde machten ihm einen Kondolenz-Besuch. Und was zu viel ist, ist zu viel. Dieser Besuch bewirkte, was die härtesten Schläge vorher nicht bewirkt hatten: er brachte den Hiob aus dem Gleichgewicht. Dabei waren diese Freunde von der besten Absicht beseelt. Sie hatten einen weiten Weg gemacht, um ihren von Gott so hart geprüften Freund zu trösten. Sie trafen einige Wochen nach der Katastrophe ein und erkannten ihn kaum wieder. Das erschütterte sie sehr. Sie weinten ganz bitterlich. Sie zerrissen ihre Kleider, bedeckten ihren Schädel mit Erde und saßen sieben Tage und sieben Nächte neben dem Elenden in schweigender Trauer auf der nackten Erde. Und solange der Fall nicht diskutiert wurde, ging auch alles recht gut. Dem Hiob wurde wahrscheinlich etwas leichter ums Herz; und so machte er diesem Herzen Luft, indem er ganz gewaltig übertrieb – was immer sehr gut tut. Er schrie zum Beispiel: »Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen, und das Leben den betrübten Herzen?«
Ebenso heilsam wie das Übertreiben ist das Verallgemeinern, eine versteckte Art von Übertreiben. So klagte Hiob, verallgemeinernd: »Muß nicht der Mensch immer im Streit sein auf Erden, und sind seine Tage nicht wie eines Taglöhners?« Hiob hatte offenbar ganz vergessen, daß seine Tage durchaus nicht die Tage eines Taglöhners gewesen waren.
Die Freunde vernahmen solche pessimistischen Sätze gar nicht gern. Das war ihnen viel zu subversiv. Sie hätten lieber etwas Erbauliches aus dem Munde ihres Freundes gehört, etwas Aufbauendes. Man will schließlich die Früchte seines Mitleids sehen. Man kann schließlich nicht in alle Ewigkeit neben Unglücklichen sitzen und trauern. Bei aller Freundschaft, es waren schließlich nicht ihre Rinder und nicht ihre Söhne, die dahin waren. Sie mußten den Fall Hiob nun endlich zu einem befriedigenden Abschluß bringen, um sich mit gutem Gewissen wieder den eigenen Geschäften zuwenden zu können.
So trösteten sie. So gaben sie gute Ratschläge. Trost und Rat ist oft die Abwehr des Nicht-Betroffenen gegen das Leid des Betroffenen. Trost und Rat sind – neben anderem – auch eine Maske der Distanz. Als nun Hiob diese billigen Predigten hörte, die sein Leid überhaupt nicht in Betracht zogen, wurde er sehr ungemütlich. Wahrscheinlich merkte er erst bei dieser Gelegenheit, daß er gar nicht so ein perfekter Dulder war, wie er sich selbst noch vor kurzem eingebildet hatte. Der Sturz von oben nach unten hat oft sehr revolutionäre Effekte. Man macht eine Generalabrechnung, wo man es früher gar nicht so genau wissen wollte. Und Hiob legte nun – angestachelt durch die Salbadereien der drei Freunde, die keinen Haut-Ausschlag hatten und nicht bankrott waren – ganz fürchterlich los. Er sagte ganz laut, was er von dieser so gefeierten Welt-Regierung eigentlich halte: nämlich gar nichts. Die Freunde, mit ihren kindischen Tröstereien, hatten ihm überhaupt erst ein Licht aufgesteckt, was ihm und der ganzen Menschheit angetan wird.
Es ist sehr oft so: wenn einer erst aus dem Gleichgewicht kommt, dann fällt er auch gründlich. Plötzlich fällt diesem Grundbesitzer gründlich ein, was er schließlich immer gewußt hat: »Wer in die Hölle hinunterfährt, kommt nicht wieder herauf.« Wem aber so etwas erst einmal aufgeht, dem ist nur noch schwer der Mund zu verbieten. Und alles, was er sich selbst bisher verwehrt hatte, zu sagen, kam nun, in der Angst seines Herzens, ans Licht. Den drei Herren, die zu Besuch gekommen waren, war diese Wendung schrecklich peinlich. Sie sagten sich: wohin würden wir kommen, wenn wir diese Ordnung des Lebens, in der es uns gut geht, in Frage stellten? Und da ihnen die Reden des Hiob geradezu umstürzlerisch klangen, riß ihnen die Geduld. Und sie zogen andere Saiten auf. Dieser außer Rand und Band geratene Bankrotteur mußte endlich zur Raison gebradit werden. So kam es, daß die Freunde, die zu ganz anderen Zwecken hergekommen waren, sich als Hüter der Ordnung aufspielten, die vom höchsten Herrn dieser Ordnung direkte Informationen erhalten. Sie kanzelten den Unglücklichen ab wie einen ungezogenen, dummen Schuljungen. Was den Geprügelten natürlich nur noch radikaler machte.
Die Freunde sind nun schon lange keine Freunde mehr. Sie sind Anwälte des Zustands der Dinge, in dem es ihnen gut geht. Und sie triefen vor Selbstgerechtigkeit. Sie glaubten mit rhetorischen Fragen beweisen zu können, was Hiob mit tieferlebten Fragen anzweifelt. Hiob schreit: »Warum leben denn die Gottlosen, werden alt, und nehmen zu mit Gütern? Sie jauchzen mit Pauken und Harfen, und sind fröhlich mit Flöten.« Die Freunde haben darauf nichts zu antworten als: »Wo ist ein Unschuldiger umgekommen?« »Wo sind die Gerechten je vertilget?« »Meinst du, daß der Allmächtige je das Recht verkehre?«… Gerade das meinte Hiob. Sie aber antworteten auf die ernstesten Fragen, indem sie die abgestandensten Phrasen bis zum Überdruß wiederholten.
Sie wollten ihn mit ihrem Geschwätz mundtot machen. So schmetterten sie eine Kalender-Weisheit nach der andern in die Luft. Glück hat, wer es verdient – prahlten sie. Unglück hat, wer es verdient. Man wird glücklich, indem man hübsch befolgt, was einem in der Schule und im Religions-Unterricht gelehrt wurde. Denn da existiert Jemand, hoch oben, der für Tugend – Glück zahlt … Wenn also Hiob jetzt unglücklich ist, so folgern sie, so muß er einiges auf dem Kerbholz haben. Woher sonst die Geschwüre?
Bisweilen sind die Freunde sogar nicht einmal ganz abgeneigt, ihm zu glauben, wenn er so leidenschaftlich seine Unschuld beteuert. Da haben sie dann ein neues Argument zur Rechtfertigung des Erfolgs und des Mißerfolgs. »Meinst du wohl«, philosophieren sie, »daß du wissest, was Gott weiß?« Und sie erfinden Sünden, die er nie begangen hat – nur um zu beweisen, daß der Welt-Regent ein guter Richter ist. Grundsätzlich behaupten sie, so oder so: der Unglückliche muß auch schlecht sein; denn sonst stimmt die ganze Rechnung nicht. Falls aber Hiob dennoch gut sein sollte – die Freunde scheinen auch schon skeptisch angefressen zu sein – haben sie noch diese Reserve-Lösung bereit: »Wie mag ein Mensch gerecht sein vor Gott?« – Das aber, liebe Freunde, ist ein sehr gefährlicher Satz. Da könnte leicht einer zu der Folgerung kommen: also kann man sich die ganzen Tugenden schenken, wenn man sowieso nicht gerecht sein kann.
Den Freunden ist offenbar bei all dieser Selbstgerechtigkeit nicht sehr wohl. So haben sie noch ein drittes Argument zur Rechtfertigung dieses Unglücks auf Lager – das ihrem Freund Hiob vielleicht etwas schmeicheln soll. Sie sagen: »Selig ist der Mensch, den Gott strafet.« Sie sagen: »Der Mensch wird zum Unglück geboren, um (wie die Vögel) empor zu schweben.« Und wenn auch diese Freunde bestimmt keine Lust hatten, mit stinkenden Geschwüren zu schweben – so hatte ihre gute Idee doch eine große Zukunft. Sie wuchs sich aus zu dem Satz des deutschen Philosophen Hegel: »Die Strafe ist die Ehre des Verbrechers.« – Aber dieses leise Entgegenkommen der Freunde war nur sehr leise und ganz folgenlos. Im Wesentlichen blieben sie dabei: es wird schon einen moralischen Grund haben, lieber Hiob, daß du so arm und so krank bist.
Am selbstgefälligsten benimmt sich ein vierter Freund, der erst sehr spät auftaucht. Er ist der Jüngste im Kreise, was er dadurch zu kompensieren sucht, daß er etwas Rüdes gegen die Alten sagt. Es ist eine geläufige Vorstellung, daß die Jugend immer progressiv ist. Das ist falsch; sie ist nur immer – vital. Und man kann das Rückwärts ebenso vitalisieren wie das Vorwärts. Dieser Jüngste ist nun solch ein quicklebendiger Rückwärtser. Er macht den drei Freunden des Hiob die bittersten Vorwürfe, daß sie zu milde mit diesem Sünder umgehen. Er ist sehr empört darüber, daß dieser Habenichts es wagt, zu seinen durch die Geschwüre bezeugten Sünden nun auch noch den Frevel des Lästerns hinzuzufügen. Dieser Jüngste ist in der hier versammelten Gesellschaft von Erfolgs-Anbetern der massivste Ideologe des Erfolgs: Gott ›vergilt dem Menschen, danach er verdient hat‹. Und er gibt zum besten, was er tun würde, wenn er in einem solchen Elend wie dieser Hiob säße: er würde den Kampf gegen die herrschende Macht aufgeben. Wenn du gehorchst, lieber Hiob, dann wirst du gute Tage haben und mit Lust leben und alt werden. –
Hiob sagt zu dem ganzen, vierfältigen Gerede schlicht, laut und vernehmlich: Nein! Alle diese schönen Redensarten gleiten an ihm ab und entlocken ihm nur eine ebenso dezidierte wie karge Antwort: »Es sei ferne von mir, daß ich Euch recht gebe.« Das ist nicht allzu höflich, aber klar.
Er streitet nicht mit den Phrasendreschern. Aber er teilt ihnen in aller Ausführlichkeit mit, was er von ihnen hält. Und da Hiob ein guter Psychologe ist, entlarvt er recht gründlich ihre ordinäre Art. Sie benutzen also sein Unglück, um sich aufs hohe Roß zu schwingen. Weil es ihm schlecht geht, tun sie sich dicke. »Wollt Ihr wahrlich Euch über mich erheben und meine Schmach mir beweisen?« fragt er sie höhnisch. Er läßt sich nicht einreden, daß er schlechter ist, weil es ihm schlechter geht. Ach, er versteht sie zu gut. Und natürlich dünken sie sich nicht nur besser, sondern auch klüger. Aber auf ihn macht diese Klugheit nicht den geringsten Eindruck. Allen ihren weitschweifigen Weisheiten setzt er die kurze Verachtung entgegen: »Was Ihr wißt, das weiß ich auch.« Eure Gescheitheiten nützen mir nicht die Bohne. Glaubt Ihr nicht, daß ich genau so klug und von oben herab zu Euch sprechen könnte – wenn Ihr in meiner Lage wäret? Ihr meint doch nicht im Ernst, daß mein Schmerz von Eurer Trösterei und von Eurem Tadel aus der Welt geschafft wird? Im Gegenteil! Deshalb verschont mich bitte.
Ihr könntet mir allerdings helfen, wenn Ihr eine Weile den Mund hieltet und mir aufmerksam zuhörtet. Legt doch einmal meine Leiden in die Waagschale. Aber dazu seid Ihr ja viel zu feige. Ihr habt ja Furcht vor meinem Unglück. Deshalb strengt Ihr Euch so an, meine dringende Frage mit Eurem kindischen Geschwätz zuzudecken …
Das Recht auf Glück
Ein Psalm lautet: »Ich bin jung gewesen, und alt worden, und habe noch nie gesehen den Gerechten verlassen, oder seinen Samen nach Brot gehen.« Die Frage, die Hiob auf dem Herzen hatte, lautete: wie konnte es passieren, daß ich, der ›Gerechte‹, in solch ein Unglück geriet? Und weshalb antwortet mir nicht der Herr der Welt auf meine Frage? Ich stelle ihn vor das Gericht, das er selbst eingerichtet hat. Ich klage: »Gott weigert mir mein Recht.«
Ein deutscher Dichter, Heinrich von Kleist, schrieb die Geschichte des Michael Kohlhaas, der sein Recht wollte und sonst nichts. Hiob war ein biblischer Kohlhaas. Er kämpfte nicht für seine Kamele und nicht für seine glatte Haut. Er kämpfte für sein Recht. Er verlangte ein Urteil, auf das er nach der Konstitution (dem Sinai-Bund) Anspruch hatte. Es glaubten damals vielleicht noch nicht alle Juden an diesen Vertrag. Die Herrschaft des Einen Gottes und seiner Rechtsordnung war wohl auch im Fünften Jahrhundert noch nicht völlig anerkannt. Hiob aber hatte ganz offenbar in diesem Glauben siebzig Jahre zugebracht. Und er pochte jetzt auf den Schein, den Moses seinerzeit in Empfang genommen hatte. Hiob stellte sich auf die Hinterbeine und sagte: »Von dem Recht, das mir zusteht, werde ich nicht lassen.«
Was stand ihm zu? Zu Horeb hatte Gott einen Kontrakt geschlossen mit den Hebräern. Solange Jahve nur ein jüdischer Lokal-Gott gewesen war, ist die Gruppe sein Kontrahent gewesen. Zur Zeit des Hiob aber (vielmehr: zur Zeit seines Biographen) war Gott bereits ein universaler Richter, der dem Einzelnen nach dem Gesetze sein Glück und sein Unglück zuteilte. Jedes Individuum, das sich zu ihm bekannte, war sein Kontrahent – also auch Hiob. Der hatte sich verpflichtet, die Zehn und viele andere Gebote zu halten. Dafür hatte sich der Herr verpflichtet: daß Hiob lange leben werde, und daß es ihm wohl ergehen werde auf Erden. Hiob hatte seine Verpflichtungen gehalten – wie von allerhöchster Stelle anerkannt wird. Und trotzdem geht es ihm so miserabel? Andere halten gar nichts. Und trotzdem geht es ihnen hervorragend? Gott ist kontraktbrüchig geworden. Die Tafeln vom Sinai, die für Gehorsam – Glück versprechen, sind nur ein Fetzen Papier. Der himmlische Rechts-Partner möge sich stellen und diesen Zustand der Dinge rechtfertigen … Keiner der Freunde des Hiob ging auf dies Plädoyer ein. Es waren samt und sonders Drückeberger und hatten viele Nachfolger in der Geschichte der Religion und Philosophie.
Hiob aber kämpfte wie rasend für ein ordentliches Gerichts-Verfahren: er kämpfte für das ihm zustehende Wohlergehen. Doch war seine Position recht schwach; die Rechts-Sprechung und die Exekutive waren offenbar in einer einzigen Hand. Vergeblich wandte er sich an den obersten Beamten – mit der Bitte, einen allerhöchsten Gerichtshof zuzulassen, der unabhängig sei. Ach, Hiob war kein Feind der Konstitution, kein Anarchist. Er wollte nicht die Welt-Regierung stürzen. Warum ›hältst du mich für deinen Feind?‹ fragte er sehr rührend seinen Gegner Gott. Hiob war nicht hochfahrend wie Prometheus. Hiob wollte keine Macht-Probe, nur ein Schieds-Gericht; nur sein Recht – gemäß der Verfassung, der sie beide, der Gott vom Sinai und er, unterstanden. Das allerdings wollte er, unter allen Umständen.
Und er sprach mit einem herrlichen Mut, in der Richtung gegen den Himmel: »Sieh, ich bin zum Rechts-Streit gerüstet; ich weiß, daß ich Recht behalten werde.« Doch was nützte ihm alle Zuversicht, daß er Recht behalten werde. Er bekam nicht das Gericht, um das er bat. Resigniert machte er Bilanz: »Es ist zwischen uns kein Schiedsmann, der seine Hand auf uns beide legte.« Man kann das auch so übersetzen: Du bist, mein lieber Gott, ein großer Diktator.
Da nun sinnt Hiob auf Rache – der Ausweg aller Ohnmächtigen. Wenn man ihn so seiner konstitutionellen Rechte beraubt, dann soll man wenigstens in alle Ewigkeit wissen, wie Hiob über eine solche Wirtschaft gedacht hat. Und er hatte einen sehr rachsüchtigen Wunschtraum. »Ach, daß meine Reden geschrieben würden! Ach, daß sie in ein Buch gestellt würden! Mit einem eisernen Griffel aus Blei zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen würden!« Dieser Wunsch ist ihm in Erfüllung gegangen. Jüdische Schriftsteller haben seine Anklagen verewigt.
Und der alte Prozeß Hiob gegen Gott hat für diesen Gott enorme Konsequenzen gehabt. Eine hat schon Hiob selbst gezogen. Und von diesem Prestige-Verlust hat sich Hiobs Gegner nie wieder erholt. Als nämlich Hiob sein Urteil nicht bekommen konnte, entschied er, der Ankläger, selbst den Streit – und verurteilte den Welt-Regenten in absentia wegen Vertrags-Bruchs. Das heißt: er nahm dem Herrn des Himmels und der Erden das Adjektiv ›gerecht‹ – und entlarvte ihn vor aller Welt als einen ungezügelten Despoten. Denn ein Wesen, das, dank seiner Macht, die von ihm eingegangenen Kontrakte außer Kraft setzt, ist ein Despot.
»Er macht, wie er’s will«, hat Hiob in diesen Urteils-Spruch hineingeschrieben; »er breitet ein Volk aus, und treibt’s wieder weg.« Hiob hat noch viele andere vernichtende Sätze gegen diese Willkür-Herrschaft hinzugefügt. »Wer will den Donner seiner Macht verstehen?« So fragten wohl viele Sklaven orientalischer Despoten. Um ihn ist ein ›schrecklicher Glanz‹, so daß man vor Glanz nicht sehen kann. Übrigens ist das wohl die Funktion alles Glanzes gewesen, mit dem hohe Herrschaften sich zu umgeben pflegten: die Niederen werden geblendet, um nicht so genau hinschauen zu können. Und wie man ihn nicht sehen kann und nicht hören kann – diesen unzugänglichen Gestrengen, so kann man ihn auch nicht erreichen mit der menschlichen Stimme. »Oh, hätte ich einen, der mich anhört«, jammerte Hiob. Aber der Tyrann zeichnet sich immer dadurch aus, daß er keine Ohren hat; und Hiobs Freunde taten es – wie alle Gleichgeschalteten – dem hohen Herrn nach. Auch sie hatten keine Ohren.
Schließlich trat der Herr der Heerscharen noch persönlich auf und bewies, wie porträt-ähnlich Hiob ihn gezeichnet hatte. Er war ganz genau so, wie der getretene Knecht in seiner Verzweiflung und Rachsucht ihn sich vorgestellt hatte. Der Allmächtige dachte gar nicht daran, sich zu rechtfertigen. Er wies nur auf sein mächtiges irdisches Empire hin und meinte, recht hochmütig: »Wo wärest du, da ich die Erde gründete?« Als ob das ein Einwand gegen das Halten von Verträgen ist. Dann fragte er noch: »Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit?« Natürlich konnte Hiob das nicht. Und er bestand auch nicht die weitere Examens-Frage: »Kannst du mit gleicher Stimme donnern?« Hiobs majestätischer Gegner stellte sich ganz schlicht auf den Macht-Standpunkt.
Aber Hiob hielt es eben nicht für das Thema des Streits: ob er genauso gut donnern kann? Die Frage war seiner Ansicht nach: wer hat sich an die Abmachung gehalten? Doch der Allmächtige, als habe er nie etwas vom Sinai gehört, erklärte kurz und bündig: »Es ist mein, was unter allen Himmeln ist.« Das sagt jeder Großmächtige, der die Macht dazu hat.
Happy End und Happy Beginning
Vielleicht war es ein Schriftsteller, welchem dieser Ausgang zu gefährlich schien – der dann ein Happy End hinzufügte. Vielleicht aber haben auch jene Gelehrten recht, die in dem versöhnlichen Schluß, den die Geschichte dann noch erhielt, einen Versuch der jüdischen Orthodoxie sehen, die Rebellion des Hiob aufzufangen. Jedenfalls hat wohl erst das fromme Finale dem Buch Hiob die Chance gegeben, in jene Kollektion von Schriften aufgenommen zu werden, die man die Bibel nennt.
Das Ende der Geschichte ist voll von ungetrübtem unproblematischem Glück; nur ist es nicht ein Ende, das zur vorangehenden Geschichte paßt. Plötzlich, ganz unerwartet, ohne die geringste Veranlassung unterwirft sich der aufrührerische Hiob. Er macht nicht einmal eine Philosophie dazu. Er sagt, als wäre gar nichts geschehen – ganz rücksichtslos gegen die Neugierde der Mitwelt und der Nachwelt: »Siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen.« Und er verspricht, wie ein kleinlauter Schüler, der schon immer mit schlechtem Gewissen die Schule geschwänzt hat: »Zum andern Mal will ich’s nicht mehr tun.« Hiob ist abermals nicht mehr Hiob.
Sein Gott allerdings hält die Rolle großzügiger Willkür weiter durch. Er ist so angetan von der Nachgiebigkeit des störrischen Knechts, daß er sofort Stellung nimmt – gegen die Freunde des Hiob, die doch für Ihn und gegen den Rebellen gestanden hatten. Und das ist erst der Anfang. Hiobs Haut heilt ab, ganz ohne vorhergehende Bestrahlungen. Die Brüder und Schwestern des wieder in Gnade Aufgenommenen kommen angelaufen, mit Geld-Geschenken und Schmuck. Und der Herr gibt Hiob das Doppelte von dem, was er verloren hat; so daß er an diesem unerfreulichen Zwischenfall immerhin hundert Prozent verdient. Er lebte noch 140 Jahre; und hatte nun statt der 7 verstorbenen 14 neue Söhne. Das alles bekam er als Gegengabe für blinden Gehorsam. Der Verzicht auf die Frage: ›Warum?‹ wird belohnt – das ist die Moral von der Geschicht’.
Die traurige Geschichte des Hiob hat nicht nur ein Happy End – sie hat auch (wahrscheinlich ebenfalls eine nachträgliche Zutat) ein Happy Beginning. Gott wird (zu Beginn) ein verständliches, sehr humanes Motiv für seine schreckliche Behandlung des frommen Knechts Hiob unterlegt. Weshalb ist Gott so häßlich gegen diese fromme Kreatur? Das wird sehr psychologisch begründet. Man kennt doch die reichen Jungen und Mädchen, die sich in Ärmere verlieben – und von ihnen wiedergeliebt werden. Und eines Tages flüstert dann ein teuflischer Nachbar oder eine ebenso höllische Stimme ihm oder ihr ins Ohr: bist Du auch ganz sicher, daß Du nur um Deiner selbst willen geliebt wirst? – und nicht, weil Dein Name in der Zeitung steht? und nicht, weil Du eine reiche Erbin bist?
So flüsterte zu Beginn ein sehr seltsamer Satan, ein extremer Idealist, dem Jehova ins Ohr: vielleicht ist Dein Liebling Hiob nur deshalb so gehorsam-fromm, weil Du ihm so viel Gutes beschert hast. Wollen wir doch einmal die Probe aufs Exempel machen: wie er sich, nach Verlust aller dieser schönen Gaben, gegen Dich benehmen wird. Da nun Jeder gern um seiner Selbst willen geliebt werden will, auch dieser Gott – ging er, wenn auch mit sehr schlechtem Gewissen, was ihn ehrt, auf das teuflisch-idealistische Experiment ein. Das heißt: er ruiniert Hiob, um seine Anhänglichkeit messen zu können. Jener Gott benahm sich also wie ein Vorläufer des strengen Kant, der später so rigoros die Unterscheidung zwischen einer moralischen Handlung um ihrer selbst willen und einer moralischen Handlung um der Belohnung willen unterschied. Bei dieser göttlich-teuflischen Prüfung versagte dann Hiob völlig. Er blieb unerschütterlich dabei: er habe ein Recht auf das gute Leben, das er bisher führte. Trotzdem, trotz seiner Hartköpfigkeit wird er am Schluß belohnt – nur weil er (weiß der Teufel: weshalb) nachgibt. Die Geschichte, wie sie in der Bibel erzählt ist, hat keinen Zusammenhang. Aber sie hat den sehr ergreifenden, sehr wesentlichen Kern: die Frage – verdienen wir unser Unglück? verdienen wir unser Glück?
Diese große Frage taucht immer erst im Unglück auf. Wer erfolgreich ist, pflegt zu glauben, daß es ihm zukommt. Solange Hiob im Glück war, zweifelte er wahrscheinlich nicht eine Sekunde daran. Ganz gewiß, er war ein gottesfürchtiger Mann gewesen: hatte die Gefallenen aufgerichtet, ›die bebenden Knie‹ gekräftigt. Aber er hatte sich offenbar nie gefragt: sind die Leute, denen es schlechter geht als mir – wirklich auch schlechter? Und wenn sie schlechter sind – sind sie es nicht vielleicht deshalb, weil es ihnen schlechter geht? Als es aber an ihn kam, erkannte er diese Art von Trost, den er in guten Tagen wahrscheinlich selbst reichlich gespendet hatte, nicht an. Er rebellierte. Er schrie, im Tiefsten seiner Seele tief verwundet: fromm und gut sein hat überhaupt nichts zu tun mit glücklich sein. Der Mut zu dieser Entdeckung, das Leiden an dieser Entdeckung gab ihm seinen Platz in der Reihe menschlicher Helden und Dulder. Aber – in welche Richtung ging seine Rebellion? Zurück in eine überlebte Vorstellungs-Welt!
Er sagt sich nämlich nicht: vielleicht standen mir diese 7000 Schafe und 3000 Kamele damals gar nicht zu; vielleicht standen sie anderen, die sie nicht hatten, ebenso zu wie mir. Er sagte sich nämlich nicht: offensichtlich besteht gar kein Bund zwischen dem Herrn der Heerscharen und meinem Volk, zwischen dem Herrn der Heerscharen und mir; und ich habe mir das nur eingebildet, um in Ordnung zu finden, daß es mir so außerordentlich gut ging. Das alles sagte er sich nicht. Er suchte den Fehler nicht in seinem Glauben an einen ›gerechten‹ Gott. Sondern er tat, was in den Jahrtausenden viele Menschen taten, wenn sie ins Unglück gerieten: er prügelte die Personifikation seines Vor-Urteils. Hiob prügelte den ›gerechten‹ Gott, den er 70 Jahre lang für gerecht gehalten hatte, weil er ihm alles beschert hatte, was gut und teuer ist.
Hiob – oder der Philosoph, der ihn erfunden hat – ist weder ein frommer Mann gewesen (im Sinne des idealistischen Satan) noch ein revolutionärer Illusions-Zerstörer. Er war ein Mensch, dem das Schicksal mit harten Streichen bewiesen hatte, daß die Gleichung von frommem Gehorsam und Glück nicht stimmt – und der den Gott seines Vor-Urteils dafür verantwortlich machte. So verirrte er sich, da er die Existenz eines Welt-Regenten nicht bezweifelte, in eine Sackgasse: da thronte ein böser Dämon, der’s mit den Menschen treibt, wie’s ihm beliebt. Das Glück des Menschen