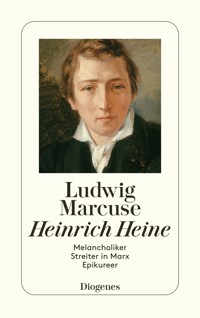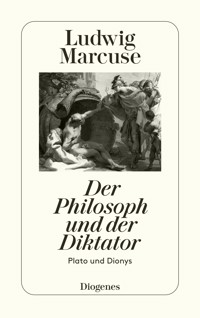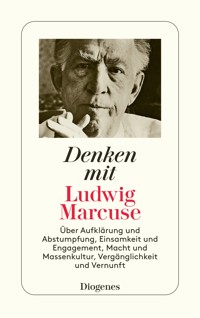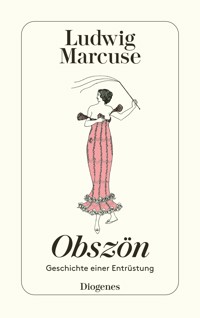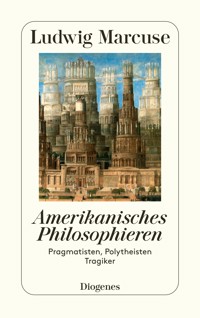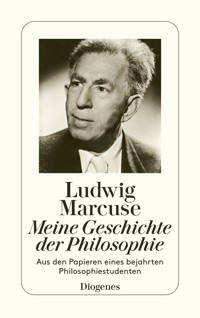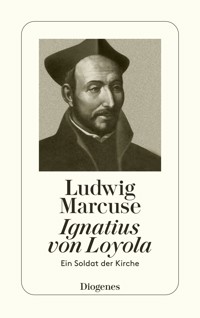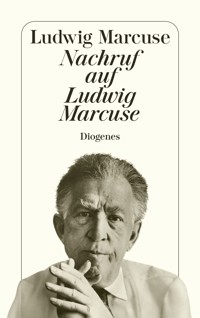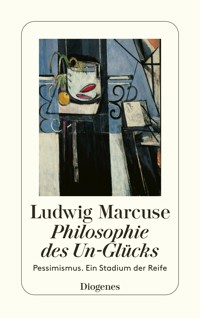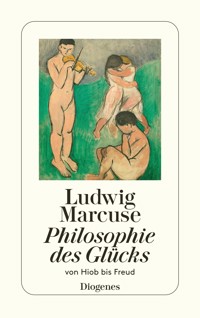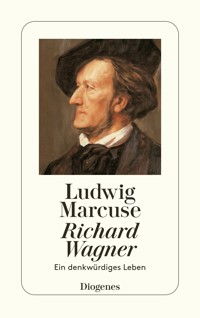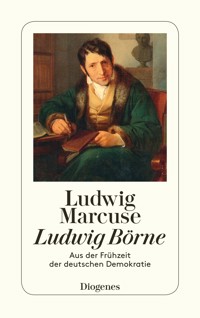
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er war einer der Stammväter des Journalismus, ein universaler Geist, ein Vorkämpfer für geistige und soziale Freiheit und ein glänzender Stilist – der Wegbereiter der literarischen Kritik Ludwig Börne (1786 - 1837). Ludwig Marcuse widmet ihm und seinem bewegten Leben eine sachliche und zugleich romanhaft spannende Biographie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ludwig Marcuse
Ludwig Börne
Aus der Frühzeit der deutschen Demokratie
Diogenes
»Aufrichtig zu sein, kann ich versprechen, unparteiisch zu sein aber nicht.«
Goethe
I. Einer aus dem Frankfurter Ghetto
Roman der Bosheit
»Unsere Narren, die Päpste, Bischöfe, Sophisten und Mönche, die groben Eselsköpfe, haben bisher also mit den Jüden gefahren, daß, wer ein guter Christ wäre gewesen, hätte wohl möcht ein Jude werden. Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätten solche Tölpel und Knebel den Christenglauben regiert, so wäre ich lieber eine Sau worden, denn ein Christ.«
Martin Luther
Wer vom Frankfurter Wollgraben, im Osten der Stadt über den Main nach Sachsenhausen ging, las noch zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts unter dem Brückenturm der Stadt-Seite linker Hand diese Worte: »Am grünen Donnerstag marterten die Juden ein Knäblein, Simon genannt, seines Alters zweieinhalb Jahr.« Die Illustration unter dem Text: ein Knabe mit vielen Wunden, in denen neun Schusters-Pfriemen stecken. Darunter ein neuer Satz: »Au weih Rabbi Anschel; au, au Mauschl au weih, au, au.« Der Chronist schildert weiter: »Dann sitzet ein Jud mit seinem Schabbes-Deckel, Brüll auf der Nase, Kragen und Mantel und an diesem ein gelbes Ringlein, rücklings auf einem großen Schwein, und hält den in die Höhe gezogenen Schwantz, anstatt eines Zaums in der rechten Hand, unter diesem Schwein ligt ein junger Jud, der die Zitzen saugt, hinter der Sau ligt ein alter Jud auf den Knie und läßt die Sau den Urin und anderes aus dem Affter ihm ins Maul lauffen, hinter diesem Jud stehet der Teufel mit Hörnern, und hält ihn an beyden Achseln; am Kopff des Schweines, welches Menschen-Koth von der Erde frisset, neben demselbigen stehet eine Jüdin, nach dem Teufel zugewand in ihrem völligen Staat, nemlich mit dem eckigten Schleyer, krausen Kragen am Halß und Mantel umgehenkt, hält die Hörner eines großen Bocks mit der linken Hand …«
Sebold hieß der Maler. Er hatte diesen Haß-Mythos einst auf Befehl des Magistrats gemalt. »Zur öffentlichen Beschimpfung, zum Verdruß für die Juden.« Weil man ihnen einen Ritual-Mord vorwarf? Nur aus Vorsicht, »um die Juden daselbst von dergleichen Schelmstücken desto eher abzuhalten«. In der zweiten Hälfte des siebzehnten, dann zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts wurde das Bild aufgefrischt – gegen die flehentlichen Bitten der Juden. Farben verblassen, Steine verwittern – aber der Haß dauert.
Dieses öffentliche Bekenntnis der Stadt Frankfurt am Main verschwand erst mit dem Abbruch des Brückenturms 1801, zwanzig Jahre nach Erscheinen der ›Kritik der reinen Vernunft‹; erst zwölf Jahre nach dem Ausbruch der französischen Revolution; erst im zweiundfünfzigsten Lebensjahr des Frankfurter Dichters Wolfgang von Goethe. Und vielleicht verschwand dieses Plakat der Niedertracht damals auch nur deshalb, weil der Brückenturm verschwand. Denn noch fünf Jahre länger, bis 1806, galt die fast zwei Jahrhunderte regierende Ausnahme-Ordnung für die letzte, tiefste Paria-Kaste im Gemeinwesen – für die Juden. Börne nannte diese Juden-Gesetze: den »Roman der Bosheit«.
Die vom Beginn des siebzehnten Jahrhunderts herrührende »Stättigkeit« war schon ein Glück: wenigstens eine Sicherheit; ein Vertrag, in dem der Jude Partner, nicht mehr Ungeziefer war. Sie stand am Ende einer Kette von Willkür-Akten. Sie war die erste unaufhebbare Abmachung, während die früheren Abmachungen immer nur für drei Jahre galten. Wer da dem Rat nicht genehm war, dem wurde das Niederlassungsrecht entzogen. Zwar durften auch die Juden nach einmonatiger Aufkündigung der »Stättigkeit« auswandern, durften »fahren und fließen mit ihrem Leibe und Gute«, wohin sie wollten – Leibeigene waren sie nicht mehr. Die Zeit war vorbei, in der sie ein kaiserliches Regal waren wie Bergwerke und Zölle, ein Finanzobjekt unter andern. Aber sie standen immer unter der Drohung, wieder zum Nomaden-Schicksal verurteilt zu werden. Ursprünglich kaiserliche Kammerknechte, Zinshörige der jeweiligen römischen Kaiser, wurden sie später an getreue Vasallen verpfändet. Als Haupteigentümer fungierten trotzdem weiter: der Kaiser und der Kurfürst von Mainz, der als Erzkanzler des Reiches Inhaber des zehnten Teiles aller deutschen Juden-Einkünfte war. Der Kaiser überließ dann seine Juden mit Leib und Gut erst pfandweise, später käuflich (und zwar auf Wiederkauf) der Stadt; sie durfte weitere Juden aufnehmen und mit ihnen einen jährlichen Wohnzins ausmachen. Auch das Mainzer Erzstift versetzte seine Juden nach dem Vorbild des Kaisers. Aber erst am Ende des siebzehnten Jahrhunderts verzichtete ein Leopold für 20000 Gulden endgültig auf das Wiederkaufsrecht, mit der Versicherung: daß »die sämtlich in Frankfurt vorhandenen Juden …, sie seien vom römischen Kaiser erkauft oder jure Status aufgenommen, oder sonst in anderm Wege an die Stadt gekommen, der genannten gemeinen Stadt Frankfurt unablässig und unansprüchig Eigentum und als Leibsangehörige Hindersassen sein und bleiben sollen«. Dafür, daß der Rat sie aufgekauft, mußten die Juden einen Teil der Kaufsumme aufbringen: das Kaufobjekt zahlte einen Teil seines Preises.
Mitte des dreizehnten Jahrhunderts fand die erste (historisch nachweisbare) Frankfurter Juden-Schlacht statt. Die Juden hatten innerhalb der Gesellschaft die Funktion des Haß-Ableiters. Zogen Gewitter am Himmel der Gemeinschaft zusammen, Hungersnöte oder Krankheiten oder andere Mißhelligkeiten, so entluden sie sich über den Juden. Bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts lebten die Frankfurter Juden zerstreut unter der übrigen Bevölkerung, meist zwischen Dom und Mainufer. Ein Wohnungszwang, der sie in einen bestimmten Bezirk verwies, bestand damals noch nicht. Man nannte ihr Viertel schon »strata Iudeorum sive vicus Iudeorum«, aber Ende des vierzehnten Jahrhunderts wohnte sogar der Bürgermeister noch unter ihnen. Nach der zweiten Juden-Schlacht, in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, legte man nach italienischem Vorbild eine Judengasse an. Auf dem ehemaligen Stadtgraben, dem Wollgraben – zwischen Fahr- und Allerheiligengasse, Predigergasse und dem Fischerfelde –, wurden die Juden für drei Jahrhunderte interniert; vom Ende des fünfzehnten bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Drei Tore – das Bornheimer Tor, das Judenbrückchentor, das Wollgrabentor – riegelten dieses »Neu-Ägypten« ab. Es war eine doppelte Schutz-Haft: Schutz der Juden, und Schutz vor den Juden. Die Juden wehrten sich; Kaiser und Papst (und die Frankfurter Bürger, welche die Konkurrenten aus der guten Geschäftsgegend gern entfernten) wollten es. Begründung: Die Juden wohnten zu nah der Kirche; die Juden könnten die kirchlichen Handlungen hören und sehen; die Juden könnten durch ihre eigenen Zeremonien den christlichen Gottesdienst stören. So mußten die Frankfurter Juden ins Frankfurter Exil. Nur wenige Häuser zogen sich zuerst an dem alten Stadtgraben hin: unter ihnen eine Synagoge, ein Bad, ein Tanzhaus, ein Hospital auf dem Friedhof. Die hundert Menschen, die zuerst hier wohnten, hatten wenigstens, was ihren Nachkommen fehlte: Platz, Luft und Licht. Weshalb man sie nicht auswies? Der junge Börne gab die lapidare Lösung: »Man hat trotz dem Hasse, den man immer gegen Juden hatte, sich doch nie entschließen können, sie gänzlich aus dem Lande zu vertreiben. Denn die Habsucht, die von ihrem Reichtum Nutzen ziehen wollte, war stärker noch als der Haß.«
Die Menschen, die diesen Kerker im Lauf der Jahrhunderte übervölkerten, gehörten zum Gemeinwesen der Stadt nur so wie ein Fremdkörper, der mit Erfolg in einen Organismus eindringt, zu diesem Organismus – gehört. Jahrhundertelang kämpften Organismus Stadt und Fremdkörper Judenschaft miteinander. Der Fremdkörper wuchs, nährte sich vom Wirtkörper – und gab an ihn Kräfte ab. Man hatte mit Hilfe des Ghettos versucht, das Fremde durch Einkapselung unschädlich zu machen; denn es war nicht mehr auszustoßen, schon hatte es seine Funktionen im Stadt-Organismus. Aber diese Einkapselung wurde mehr und mehr zum leeren Zeichen. Man verschloß zwar die Tore der Judengasse in der Nacht, an Sonn- und Feiertagen, aber an den Werktagen war ein reges Hin und Her zwischen Stadt und Judengasse. Diese Stadt in der Stadt war keine tote Enklave, denn da die Juden »einzig und allein ihre Geisteskraft auf den Erwerb ihres Unterhalts richteten«, mußten sie bald ›die Aristokraten des Handelsstands‹ werden. Hatte man den Juden diese und jene und eine dritte Tätigkeit verboten, so hatten sie sich mit um so größerer Energie auf jenes Geschäft geworfen, das allein ihnen ursprünglich freigegeben war: den Geldverleih, der den Christen von der Kirche verboten war und der in einer Meßstadt besondere Bedeutung hatte, da die Meßhändler die unverkauften Handelsgüter bis zur nächsten Messe versetzen mußten, um Bargeld zum Einkauf neuer Waren zu erhalten. Von diesem eng begrenzten Ort innerhalb des Wirtschaftskörpers aus eroberten die Juden in Jahrhunderten trotz einer rigorosen Einschnürung ihrer wirtschaftenden Kräfte Position auf Position und brachten es schließlich dahin, daß die Sklaven die Herren wurden, daß Könige und Fürsten und Städte finanziell vom Kerker ›Judengasse‹ abhängig wurden. Börne formulierte in seiner ersten Streitschrift gegen die Judenversklavung das psychologische Gesetz zu diesem historischen Prozeß: »Die Kraft ermattet bald, wo ihr Spielraum unendlich ist, da hingegen jede Schranke und jeder Gegendruck nur die Tätigkeit erhöht.« Tausend Schranken hemmten sie, wenn sie von ihrer zentralen Position her, dem Geldverleih und dem Verkauf der bei ihnen versetzten Pfänder, in das Wirtschaftsleben tiefer eindringen wollten. Es war ihnen jede Konkurrenz mit Handwerkern und Kleinhändlern verboten: also auch die Veränderung und Zerteilung der verfallenen Pfänder. Aber zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts waren sie doch in fast alle Branchen des Handels hineingewachsen: sie hatten das Wechselgeschäft erobert, das man ihnen lange vorenthalten hatte; sie handelten mit Tuch, Leinwand, Kleidern; mit Pelzwerk, Spitzen, Knöpfen, Bändern, Schnüren, Seide, Kattun, Fischbein; mit Häuten und Fellen; mit hebräischen Büchern und Kalendern; mit Fackeln und Papier; mit Nadeln und Strümpfen; mit Juwelen, Gold, Silber, Kupfer und Zinn; mit Brot, Wein, Bier, Branntwein, Käse, Fett und Tabak. Die Judengasse hatte sich differenziert in arm und reich, in Oberschicht und Unterschicht, in Rentiers und Händler und die ganze Stufenleiter der Händler: vom armen Hausierer bis zum »Residenten«, bis zum »kaiserlichen Komissarius«, der den Regierenden Geld beschaffte und Heeresbedarf, Proviant, Munition und Ausrüstung lieferte. Meyer Amschel Rothschild wurde 1769 Fürstlich-Hessen-Hanauscher Hoflieferant. Aber auch als Abnehmer spielten die Juden schon eine Rolle: die Schneider fertigten für sie Kleider an, die von den Passanten der Judengasse gekauft wurden. Und als um 1700 die »Baumeister«, die Vorsteher der Gemeinde, in Abwehr der Konkurrenz christlicher Buchhändler den Gemeindemitgliedern verboten, ihre hebräischen Bücher in Frankfurt drucken und einbinden zu lassen, erhoben die christlichen Drucker und Buchbinder Beschwerde wegen dieses erheblichen Kunden Verlustes: seit mehr als hundert Jahren hatten sie die Gebetbücher der Juden hergestellt; manche Drucker hatten für Tausende hebräische Schrift gießen lassen. Die Gesetze der Wirtschaft sind weder pro- noch antisemitisch.
So war zusammengewachsen, was getrennt bleiben sollte; und wie Luft und Licht immer wieder die Farben der Gemeinheit am Frankfurter Brückenturm ausgelöscht hatten, so wob auch das Naturgesetz des Zusammenwirtschaftens Faden um Faden zwischen denen, welche das Kunstgesetz der Borniertheit und Gemeinheit am liebsten durch Siriusfernen gegeneinander isoliert hätte – oder wenigstens nach dem ewigen Rezept der Turnväter Jahn durch einen kleinen Urwald gegeneinander verdeckt hätte. Aber nur sehr langsam folgte in Frankfurt der gesellschaftliche Ausdruck dem wirtschaftlichen Tatbestand. In einer Eingabe an den Rat vom neunundzwanzigsten August 1769 klagten die Juden schwer: »Es mag wohl kein Ort in Deutschland sein, wo den Schutzjuden der Genuß der freien Luft und der reinen Straße so eingeschränkt wird, als uns seit einiger Zeit von den wachehabenden Offizieren an den Toren. In Wien kann ein Jude ungestört die gemeinen Spaziergänge benutzen. In Mainz, in Mannheim stehen die Favorite offen, im benachbarten Hanau der Kesselstädter Garten. Auch sonst ist überall den Juden der Zutritt in die Spaziergänge verstattet, nur uns soll der Gang um die Tore verboten sein …« In dieser bescheidenen Petition sah das Frankfurter Bauamt einen neuen Beweis »von dem grenzenlosen Hochmut dieses Volkes, das alle Mühe anwende, um sich bei jeder Gelegenheit den christlichen Einwohnern gleich zu setzen«. Und es schilderte die furchtbaren Folgen, die – würde man nachgeben – einträten: jeder würde durch das Tabakrauchen der haufenweise sich herumtreibenden Judenhorden belästigt werden, Bäume und Hecken wären in Gefahr, und die vornehmen Leute würden eine schlechte Meinung von der Polizei bekommen – wenn sie mit diesen schmutzigen und stinkenden Individuen zusammenträfen. Und während die Großväter schon Anerkennungsschreiben der ersten europäischen Höfe erhielten, wuchsen im Jahrhundert Voltaires die Enkel noch auf in der übervölkerten, düsteren, muffigen, schmutzigen Gasse, unter den Gesetzen, die das beginnende siebzehnte Jahrhundert gegeben hatte. Noch wurde die von Kaiser Matthias genehmigte »Stättigkeit« alle Jahre in der Synagoge von Ratschreibern öffentlich verlesen: die Juden durften sich nicht Frankfurter Bürger nennen (in Börnes Paß stand: juif de Francfort), nicht mehr als fünfhundert Familien durften eingeschrieben werden, nur zwölf Paare durften jährlich heiraten, nur sechs Personen durften jährlich aufgenommen werden – mit der Verpflichtung, nur einen Angehörigen dieser Gasse zu heiraten. Nur zu zweit durften sie die »Reichsstadt«, vor allem den »Römer« betreten; nur längs der Häuser seiner Ostseite durften sie auf den Römerberg oder auf den Platz vor dem Rathaus kommen, und auch nur zur Messezeit. Ausnahme: wenn sie das aus Gewürz bestehende Neujahrsgeschenk brachten. Wenn die Juden zahlten, waren sie rein. Nachts oder an Sonn- und Feiertagen durfte nur der die Gasse verlassen, der zum Arzt oder zum Apotheker wollte. Und als ihnen 1784 der Sonntagsausgang nach fünf Uhr nachmittags gestattet wurde, dankte der Gemeindevorsteher überschwenglich für diesen »tief zu verehrenden Beweis der Gnade und der Menschenliebe, welche sie und ihre Nachkommen bis in die spätesten Geschlechter rühmen und preisen wollten«. Fußwege und Promenaden – »wo ein grüner Raum, kein Jude« – waren ihnen verboten; sie durften nur auf der Fahrstraße gehen. Von öffentlichen Festlichkeiten waren sie ausgeschlossen, und während sie bei den Kaiserkrönungen in ihrer Synagoge heiße Gebete für das Wohlergehen des neuen Herrn zum jüdischen Gott sandten, bewachte das Militär des Christengottes die Ghettotore: damit kein Jude die festliche Stadt entstelle. Wenn ein Jude eine dieser Vorschriften verletzte, so konnte ihm der erste beste, der erste schlechteste den Hut vom Kopf schlagen: »Mach Mores, Jud’.« Auch der junge Meyer Amschel Rothschild mußte noch Mores machen – bevor er der Herr seiner Herren wurde. »Mach Mores, Jud’«: das war der Steinwurf, mit dem man den Hund Jude wegjagte.
Sie waren leicht zu erkennen. Nachdem der Zwang zun Tragen der zwei auf den Rock genähten, unbedeckten, konzentrischen gelben Ringe, der spitzen grauen Hüte und des blaugestreiften Schleiers für Judenweiber aufgehoben war, bildeten sich spezifische Juden-Trachten heraus: die Männer trugen schwarze Mäntel, schwarze Hüte, Kleider von dunklen Farben und einen übergeschlagenen Kragen von weißer Leinwand. Die Reicheren einen weißleinenen Faltenkragen nebst einem Hut von schwarzem Tuch zur Synagoge, den sogenannten Schabbes-Deckel. Die Frauen hatten am Sabbath einen steif gestärkten blauen Schleier von Leinwand, Witwen ein weißes, hinten herabhängendes, eine Elle langes Leinentuch. Immer neue Kleider-Ordnungen regelten das Einzelne: vor allem den Schmuck, den sie tragen durften. Aber eins war schlimmer als das Kleider-Diktat, als der Hausarrest bei Krönungen, als der begrenzte Ausgang, als der numerus clausus für Ehen – das war die Juden-Stadt, die ein Gäßchen war: und dieses Gäßchen war eine Pfütze.
Auch nach den großen Bränden bewilligte der Rat nicht mehr Boden für die übervölkerte Judengasse: so wurde immer wieder das alte Elend neu aufgebaut. Die weit hervorragenden Überhänge der vier bis fünf Stockwerk hohen, schmalbrüstigen, ineinander verschachtelten zweihundert Häuser, »die Käfige der beschnittenen Vögel«, verfinsterten noch diesen finsteren Schlauch. In die eine Häuserreihe drangen von der Rückseite her Abtritte und Turm des Dominikanerklosters, der sogenannte Mönchsturm, ein. So beschrieb die Gasse ein Reisender am Ende des achtzehnten Jahrhunderts: »Stellen Sie sich eine lange Straße vor, welche über eine halbe Viertelstunde lang und von Häusern eingeschlossen ist, die fünf bis sechs Etagen hoch sind. Denken Sie sich diese Häuser mit Hinterhäusern und diese womöglich nochmals mit Hinterhäusern, die kaum soviel Hofraum haben, daß das Tageslicht hineinfallen kann; alle Winkel bis an das Dach hinauf voll enger Stuben und Kammern, in diesen 3000 Menschen zusammengeschichtet, welche sich glücklich schätzen, wenn sie ihre Höhlen verlassen und auf ihrer schmutzigen und feuchten Straße Luft schöpfen können.« Selbst die christlichen Nachbarbewohner der Allerheiligengasse kamen um Beseitigung der die Gasse einschließenden ehemaligen Stadtmauern ein, die dem Ghetto wohl ein besonders abstoßend-graues Gepräge gaben: »Hinter einer 30 Fuß hohen, alten, schwarzen Mauer ragen die Dachgiebel von 8–10 Fuß breiten Hinterhäusern vor. Die Dächer sind mit einer Menge von Schornsteinen besetzt. Nachtgeschirre, schmutzige Bettungen und dergleichen prangen aus den Gauplöchern und oberen Fenstern heraus, oder wo diese mangeln, zeigen sich zerbrochene Fensterscheiben, die das Ziel der mutwilligen Jugend sind.« Viele Häuser waren ohne Klosetts. Die Nachtstühle, die sie ersetzten, wurden von eigens zu diesem Zweck angestellten Weibern ausgeleert. Die Abzugskanäle lagen zum Teil offen da. Ein Argument, mit dem der Rat die Überwölbung ablehnte: diese Jauche »mache beim Löschen von Bränden den besten Effekt«. Die Spülung war unzureichend. Die Folge schilderte der Reisende: »Beim Eintritt in die Gasse brodelte mir ein Quell von Gestank entgegen, der meinen Geruchswerkzeugen vorher noch ein ganz unbekanntes Phänomen war. So bedurfte es keiner weiteren Überzeugung, daß ich mich in der Judengasse befand.« Und die Menschen trugen die Farben ihrer Gasse: »Es wäre nicht nötig, sie zu zwingen, daß sie sich durch ihre kurzen schwarzen Mäntel und Krägen von anderen unterscheiden sollten; ihr totenblasses Angesicht zeichnet sie auf eine betrübte Weise von allen anderen Einwohnern aus.«
Die Innenarchitektur der Häuser glich der Straßenfassade. In manchem Haus führte die Treppe nicht bis zum Dachstuhl; stattdessen gab es eine Leiter, die man bei Verfolgungen hinaufziehen konnte, eine primitive Zugbrücke. Die Keller der Nachbarhäuser waren zum Teil durch verdeckte Türen verbunden – für den Notfall der Flucht. Die isolierten Dachstühle und die Keller-Katakomben demonstrierten den Charakter der Ghettohäuser, defensive Innenarchitektur. Aber sie bestimmte nicht allein die Eingeweide der Judengasse. An einem Sabbath-Vormittag, elf Uhr, geht der zehnjährige Börne durch seine Heimat. Am Eingang der Gasse: ein Adler-Monument, Dank der Juden an den Kaiser für Schutz gegen die Wut der Frankfurter Bürgerschaft. Nur wenig Himmel ist sichtbar, daß die Sonnenscheibe gerade noch ganz zu sehen ist. Es riecht nach Fäulnis. Er watet durch Dreck. Nur behutsam geht er vorwärts, um nicht auf Kinder zu treten. Diese Kinder – ohne Hof, ohne Garten, in dem sie spielen könnten – plantschen in der Gasse herum. Börnes Cousine sieht aus dem Fenster. Er will zu ihr. Er muß sich bücken, um ins Haus zu kommen. Innen ist alles dunkel, eine ägyptische Finsternis. Er schlägt sich den Kopf an den Wänden. Er klettert die Stiege unzählige Stufen hinauf. Er geht in ein Zimmer, das verfinstert wird vom Rauch des gegenüberliegenden Hauses. Falsch! Das Zimmer der Cousine gehört zu dem Nachbarhaus. So sehr sind die Häuser ineinander verheddert, daß eine Tür unmittelbar senkrecht unter einem Fenster liegen kann – das zu einem zwanzig Schritt entfernt liegenden Haus gehört: die Folge davon, daß man oft eine oder mehrere Stuben des einen Hauses an Bewohner des Nachbarhauses verkauft und die Scheidewand durchbrochen hatte. Dieses Erlebnis des jungen Börne gehört dem Jahre 1796 an – in welchem Jahr Goethe und Schiller sich über die Grundfragen der Kunst, Fichte über die ›Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre‹ verbreiteten, fünf Jahre, nachdem die Konstituierende Nationalversammlung in Frankreich die jüdische Bevölkerung der christlichen gleichgestellt hatte, vierzehn Jahre, nachdem der fortschrittliche Joseph 11. das Toleranzpatent erlassen, das ihm unter anderem eine enthusiastische Klopstock-Ode eingetragen hatte, weil er den Juden »die rostige, eng angelegte Fessel vom wunden Arm gelöst«. Und die Judengasse, »wohin das hochgepriesene Licht des achtzehnten Jahrhunderts noch nicht hat dringen können«, stank … Kurz darauf brannten französische Kugeln bei einem Bombardement einen Teil dieser Gasse herunter. Die Mauer, welche die Juden »von des Lebens Freuden trennte, ward nicht ganz niedergerissen, aber doch durchlöchert, und die gefangenen Tiere schlüpften jubelnd hindurch, um nach vielen hundert Jahren zum erstenmal des Himmels freie Lüfte einzuatmen. Man mußte den Abgebrannten die Erlaubnis geben, sich in der Christenstadt Wohnungen zu mieten.« Die Ideen der französischen Revolution waren auch durch die verschlossenen Tore gedrungen, hatten geharnischte, auf die Menschenrechte pochende Eingaben an den Rat, hatten eine Spaltung zwischen konservativ-reaktionärer und fortschrittlich-humaner Juden-Partei gezeitigt. Aber erst die Kugeln der französischen Revolution rissen die Tore auf.
Börne hatte seine Judengasse nicht nur pathetisch-anklägerisch, oft genug als Humorist geschildert. Als er nach den ersten Trennungen »die finstere Behausung« wiedersah, tat es ihm wohl: daß ihm »noch so viel Herzlichkeit und jüdischer Sinn übriggeblieben war«, um »bei einem Anblick, der lächerlich ist«, nur gutmütig »zu lächeln«. Was war selbst für einen wohlwollenden Beobachter an dieser Judengasse »lächerlich«? Ihre öffentliche Intimität, die Ausschüttung ihres Innen nach Außen, die Verschmelzung von Straße und Haus. Man betrachtete diese Gasse als einen großen Familiensaal, in dem man alles tun und lassen darf, was man in seinem Hause zu tun und zu lassen gewohnt ist. Da waren »die Töchter Abrahams … im nachlässigsten Morgengewande, halb sitzend, halb liegend« zu sehen: die Herren spazierten »im Schlafrock und Pantoffel, die Damen in ihren Nachthauben« herum. »Die jungen Frauenzimmer zeigten sich in Negligés, als wären sie in ihren Schlafstuben. Sie saßen auf Bänken vor ihren Häusern und deklamierten Schillers Gedichte. Sie nahmen daselbst ganz ungeniert die Besuche ihrer Liebhaber an. Man trank auf der Straße seinen Kaffee, man rauchte, man zankte, man küßte sich; kurz, man tat wie zu Hause.« Die Männer schwatzten soviel, daß der einundzwanzigjährige Gast bemerkte: »Das mosaische Gesetz spricht: Am siebenten Tag sollst Du Deinen Knecht ruhen lassen und Deine Magd; aber sind sie denn Herr ihrer Zunge?« In dieser öffentlich-intimen großen Judenstube entsteht plötzlich ein Lärm. Einer schreit: O Kartoffelsuppe, o Zwiebelsuppe, o Sauerkraut! Alles läuft zusammen. Auch der junge Gast Börne mischt sich in den Tumult. Was ist? Die Köchin hatte einige Töpfe mit Speisen aus dem Gemeinde-Backhaus geholt. Sie hatte auf jeden Topf ein Kartenblatt gelegt, um ihre Töpfe kenntlich zu machen. Es ist Ostern. Zu Ostern dürfen die Juden nichts Gesäuertes essen. Die Kartenblatt-Pappe hat durch ihre Berührung mit dem Topf die Speisen verunreinigt. Der Rabbiner entscheidet: lagen die Karten mit den Bildseiten auf den Töpfen, so stellen diese Bildseiten Farbenmauern zwischen Kleister und Speise dar; im andern Fall ist die Speise verunreinigt worden. Die ›theologische Chemie‹ einer durch Abschnürung, durch künstliche Isolierung in Marotten geflüchteten Menschengruppe.
Das Börne-Lächeln über ihre Gasseninterieurs, über ihre Ritusspielerei, geboren aus einer intimen Distanz, entstammte seinem Humor. Der hasserische Sarkasmus gegen ihren Materialismus, geboren aus einer absoluten Fremdheit gegenüber wirtschaftlichen Interessen, entstammte seinem Moralismus. Und da er mehr Moralist war als Humorist, mehr Gestrenger als Lächler, mehr Richter als Weiser, wurde er weniger der Mark Twain als der Swift dieser Judengasse. Er fand: während jeder Christ eine Zentralsonne setzt, deren Trabant er ist (Landesfürst oder Staat oder etwas Drittes), ist jeder Jude, noch der geringste, sein eigener Mittelpunkt. Aus dieser Entdeckung wuchsen zwei große Angriffe seines Lebens: gegen die Deutschen, weil sie immer dienten; gegen die Juden, weil sie immer schacherten. So stilisierte der deutsche Jude Börne die beiden großen Gegner seines Lebens: die Deutschen wollte er aus dem Ghetto ihrer Sklavenart, die Juden aus dem Ghetto ihrer Geldgier befreien. Börne sah auch die unsichtbaren Ghettos.
Sein pathetisches Eintreten für die Judengasse, sein humoristisches Abzeichnen ihrer Gewächse, sein hasserisch-sarkastisches Fixieren ihrer menschlichen Unzulänglichkeit – diese drei Einstellungen des Größten, den diese Gasse hervorgebracht, spiegelt dreimal ihr Schicksal: ihre Tragödie, ihre Komödie, ihre unheroische Existenz.
Familie Baruch und Sohn Löw
»Liebe, Ehre, Gewinnsucht, alles, was sonst die Menschen zur Tätigkeit antreibt, macht mich nur matt, weil ich schon zu viele innere Reize habe.«
Börne
Nummer 118 wohnte die Patrizierfamilie Baruch. Sie war wohlhabend und angesehen in der Frankfurter Judenschaft. Der Großvater, der in Bonn lebte, Finanzagent am ehemaligen Kurfürstl. Köllnischen Hofe und ein »feiner Mann«, ehrerbietig von Kindern und Enkeln begrüßt, wenn er im Frankfurter Gasthof zum Weißen Schwan einkehrte, hatte Maria Theresia verpflichtet, und Maria Theresia hatte ihm in einer Urkunde jede Hilfe versprochen, falls er oder eins seiner Kinder sich in Österreich niederlassen würde. Börne wäre später fast ein Opfer dieser kaiserlichen Huld geworden.
Vater Jakob, »Handelsjude in Wechselgeschäften«, hat im Frankfurter Stadtarchiv folgende Aktencharakteristik: »… hat Verstand, ist ein Hofmann, bald altgläubig, bald Neolog, wie eine Wetterfahne.« Börne schilderte ihn als »weltklug«, als einen »Mann des Korrekten«. Jakob Baruch war ein strenger, verschlossener Mann. Patriarchalisch erzogen, war er auch in seinem Hause ganz pater familiae. Er hatte seine großen Anlagen, die Gabe der schnellen Auffassung und der schnellen Anpassung, nicht fortentwickeln können. Seinem Vater zuliebe wurde er ein Honoratior der jüdischen Gemeinde, Inhaber ihrer Ehrenstellen, Repräsentant ihrer Politik – und Diener des Ansehens, das er genoß; ein unfreier Mann, der sich bei den höchsten Herrschaften größter Beliebtheit erfreute. Der Geheimrat von Götz beglückwünschte die jüdische Gemeinde zu ihrem Wiener Kongreß-Delegierten Jakob Baruch: »Dabei kommt ihm seine Bildung, welche er an den Höfen und dem Umgange mit Menschen vom besten Charakter erhalten, seine Menschenkenntnis, sein angenehmer und reiner Vortrag und sein Phlegma vorzüglich zu statten, und diese tugendhaften Eigenschaften verschaffen ihm auch überall Eingang, gute Aufnahme und gefällige Rücksicht auf das, was er für seine Gemeinde kurz, bündig und lichtvoll anbringt.« Ein typischer Ghetto-Jude: er beherrschte die Situation mit dem Verstand und ordnete sich ihr unter mit dem Rücken. Er war über den Dingen durch seinen Kopf; und unterwarf sich, weil er die Stellung seines Volkes kannte. »Er hatte zu viel Verstand für seine Stellung«, so urteilte Börne. Aber er hatte auch den Verstand seiner Stellung, das »zu viel Verstand« nicht in Erscheinung treten zu lassen. Er war ein konservativer Revolutionär: Revolutionär durch die geraden Konsequenzen seiner Gedanken, konservativ durch die praktische Klugheit seiner Lebensführung. Bis ins Letzte enthüllte ihn sein Verhältnis zu seinem Sohn Börne. »Ich lese gern, was in seinen Schriften steht, aber ich wünschte nicht, daß es mein Sohn geschrieben.« In dieser Mischung von theoretischem Liberalismus und praktischem Opportunismus kennzeichnete sich die jüdische Situation, aus der Börne kam, die Börne überwand: der sprengte die Gasse nicht durch die Einsichten, die wohl schon Gemeingut ihrer hellsten Köpfe waren, sondern durch den Mut, diese Einsichten mit der ganzen Rücksichtslosigkeit einer ungehemmten Leidenschaft in den europäischen Gesellschaftsbau hineinzuschießen. Vater Jakob las gern die Schriften des Sohns Ludwig: hier stand vieles schwarz auf weiß, was ihm auch schon eingefallen war als klugem Beobachter der Welt-Händel und der Frankfurter Angelegenheiten. Der Sohn notierte wohl manche Erfahrung des Vaters. Und doch hätte der Vater gewünscht, es wäre nicht gerade sein Sohn, durch den Ärgernis kommt in die Welt. So sehr ihn erfreuen mußte, daß tausend stumme Gedanken einen Mund, tausend gestaute Wünsche einen Arm bekommen hatten, so sehr zitterte doch sein gebeugter Rücken über die Gradheit neben ihm – über die Gradheit eines Juden. Und dieser Jude war sein Sohn.
Dieser Sohn Juda Löw Baruch wurde im Todesjahr von Lessings Freund Moses Mendelssohn, der das Judentum in die deutsche Literatur eingeführt hatte, am sechsten Mai 1786 als drittes Kind der Ehe Jakobs mit Julie Grumpertz geboren. Er war im Verhältnis zu seinen beiden Brüdern und seiner Schwester körperlich dürftig. »Sorle war meine Amme, ein kleines, schwarzes Wesen mit feurigen Augen, ganz Nerv, ohne Fleisch und Knochen. Woher Fleisch und Knochen? Das ganze Jahr nichts Kräftiges zu essen, und die ganze Woche mit mir eingesperrt in der Judengasse und am Sonntag nicht weiter als auf die Zeil.« Späte Erinnerungen beim Anblick einer Muster-Amme in Ems an die verewigte Sorle: »Sooft ich nun diese köstliche Amme sehe, seufze ich: Ach, wäre deine Sorle eine Hochländerin gewesen, dann brauchtest du nicht alle Jahre nach Ems zu reisen, dich zu flicken.« Im Haus war noch ein Majordomus: die alte Köchin Elle, die Hauspolizei. Sie neckte den schwächlichen, unansehnlichen Knaben und setzte ihn gegen seine Geschwister zurück. So war er unter Parias noch einmal ein Paria. Gegen diesen letzten Druck auf das winzigste Element im Bau der bürgerlichen Gesellschaft, auf den häßlichen kleinen Juddebub Löw wendete schon der Knirps die Waffe, mit der später der klassische Polemiker die mächtigen Bollwerke europäischer Niederträchtigkeiten stürmte: den aggressiven Witz. Trat sie ihn: »Wirst du Rabbi, so läßt sich die ganze Gemeinde taufen«, dann parierte er: »Nun, so bleibe ich der einzige Jude und verderbe deinen beiden Söhnen ihren Handel.« Schlug sie zu: »Du kommst gewiß in die Hölle«, dann fing er den Schlag auf: »Das tut mir leid, so hab ich auch im Jenseits keine Ruhe vor dir.« Man gab ihm den Spitznamen »Katev«, das heißt: Witzbold. Löw hatte den Witz des Unterdrückten, den schlagenden Witz, der verteidigend angreift. Sein Witz war sublimierter Gegenschlag. Sein Witz war Verschiebung des Kampfes in eine Ebene, in der auch Löw Waffen hatte, in der Ludwig europäischer Sieger werden sollte: in die Ebene der kämpfenden Vernunft, der ratio militans. Am Beginn steht der Katev Löw Baruch. Am Ende steht Ludwig Börne, dessen Witz europäische Wirklichkeiten unterhöhlte.
Löw Baruch zeigte das Merkmal aller selbständigen Naturen: er hatte nicht viel Interesse für den Lernstoff, ging aber mit um so größerer Zähigkeit den Fragen nach, die auf dem Weg seiner Gedanken lagen. Sein erster Lehrer, Jakob Sachs, hatte für diesen Jungen den Vorzug, daß er selbst noch tastete, und daß er von den aus Berlin strömenden Reform-Ideen Mendelssohns und Friedländers aufgelockert war. Löw stürzte sich mit jener Logik, welche die Leidenschaft des Verstandes ist, in das Gestrüpp konfessioneller Problematik: »Sie lehrten mich immer, die Christen hielten auch etwas aufs Alte Testament; aber steht denn nicht im Alten Testament: Du sollst den Fremden nicht kränken, denn einst warst Du auch ein Fremder im Lande Ägypten?« Myriaden solcher Fragen werden immer wieder von denen gestellt, die frisch die Augen aufschlagen und in tausend Rätsel blicken. Aber diese Fragensteller sind bald stumpf vor der Fülle der Fragen, und nur die Wenigen halten durch bis zur Zeit, wo sie auch antworten können. Der junge Löw teilte mit vielen aufgeweckten Kindern die Gabe, viel fragen zu müssen, aber nur mit wenigen Auserwählten die wichtigere Gabe, später zu bündigen Antworten zu kommen. Ein Löw Baruch fragte – der Ludwig Börne antwortete. Der Knabe zeigte schon, daß einmal ein Antworter aus ihm werden würde. Denn Mut zur Konsequenz ist die Vorbedingung jeder großen Antwort. Von Sachs erfuhr er, daß außer den Juden noch andere Gruppen des Gemeinwesens unter Ausnahmegesetzen stünden; zum Beispiel die Katholiken. War nicht auch der Kaiser Katholik? Und Löw führte diesen Zustand zu seiner zwingenden logischen Folge: »Kaum haben sie ihn kürzlich mit großem Gepränge gekrönt und, wollte er hier bleiben und in Frankfurt ansässig werden, könnte er nicht einmal Torschreiber werden.« So taucht hier in den ersten Umrissen eine seiner zu größter Meisterschaft ausgebildeten Kampfmethoden auf: die logische Konsequenz einer realen, aber sinnlosen Situation so zu ziehen, daß in der entstehenden Paradoxie das vorher latente Prinzip offenkundig lächerlich wird. Tausende nahmen es für selbstverständlich hin, daß Katholiken nicht Torschreiber werden können. Erst das Paradox, daß in Konsequenz dieser Selbstverständlichkeit auch ein katholischer Kaiser nicht Torschreiber werden kann, stößt die Gleichgültigen, die Vernunft-Blinden mit der Nase auf einen Zustand, den ihre abgehärteten Schleimhäute nur bei dieser ungewöhnlichen Reizung wirklich erriechen können.
An der Paradoxie der Konsequenzen sollt ihr den Unsinn erkennen: das war Börnes pädagogisches Mittel schon zu einer Zeit, als er selbst noch Schüler war. Er machte mit seinem Lehrer einen Spaziergang um die Tore Frankfurts. Es regnete stark. Der Fahrweg war völlig aufgeweicht. Löw wollte zum Fußweg. Der Lehrer erinnerte ihn an die Stättigkeitsvorschrift, die den Juden Fußwege sperrte. Löw wendete ein: »Es sieht’s ja niemand.« Sachs moralisierte über die Heiligkeit der Gesetze. Und Löw erwiderte mit einem Argument, das gegen alle geschriebenen Gesetze für die gesetzgebende Kraft der in den individuellen Fall eindringenden Vernunft plädierte: »Ein dummes Gesetz! Wenn es nun dem Bürgermeister beikäme, daß wir Winters kein Feuer machen dürften, würden wir da nicht erfrieren?« Das Zu-Ende-Denken, das Konsequenz-Denken ist der Sieg des Lebens über das Gewordene. Schon der junge Börne war ein Sieger.
Und noch durch ein zweites Merkmal unterschied sich Löw Baruch von anderen, vor allem auch von der Art des Vaters. Er gehörte nicht zur verbreiteten Rasse derer, die gesondert denken und handeln, sondern er zeigte sofort den Sinn seiner Existenz, der war: Kontakt zwischen Idee und Realität. Als er damals von zwei Bettelknaben angesprochen wurde, gab er dem christlichen den Vorzug. Sein Lehrer Sachs fragte nach dem Motiv, und Baruch-Börne antwortete: »Haben wir gestern nicht in den Sprüchen Salomonis gelesen: ›Du sollst glühende Kohlen auf das Haupt Deines Feindes sammeln‹?« Wie artistenhaft-talmudistisch wirkt gegenüber dieser vitalen, wirklichkeitssüchtigen Logik der magisterhaft-spitzfindige Einwand des Lehrers: die Christen wären nicht die Feinde der Juden. Vernebelung einer strahlenden Logik.
Löw hatte noch andere Lehrer. Er ging in die Stadt zum Schreiblehrer Ernst. Er wurde – ohne viel Erfolg – im Klavierspielen und Flöteblasen unterrichtet. So lernte er Christen aus eigener Anschauung kennen, zum Beispiel seinen Französischlehrer, den Abbé Marx aus Nancy. Der Abbé entsprach nicht seinem Begriff von einem Christen, und da die jungen Adepten der Idee beim Konflikt zwischen Begriff und Wirklichkeit geneigt sind, den Begriff zu verteidigen gegen die Wirklichkeit, fand Löw den Ausweg: »Herr Marx ist ein Franzose, und die Franzosen sind keine Christen mehr.« Doch immer näher rückte an den Ghetto-Juden die christliche Realität heran. Da war der Pfarrer Hufnagel, ein sympathischer Mann, von großer Loyalität gegen die Juden. Also konnte ein Christ doch liebenswert sein? Und Löw fand den letzten Ausweg: »Nun, er ist auch kein Frankfurter.« Noch einmal rettete der Ghetto-Jude seinen Ghetto-Begriff vom Christen.
Vielleicht war es diese geistige Regsamkeit, die den Vater bestimmte, Löw zum Studium vorzubereiten, und die ihr zugleich immer wieder abhielt, den Knaben in öffentliche Lehranstalten zu schicken, in denen seine orthodoxe Erziehung untergraben werden könnte. Der Vater wußte, daß die Knaben die gefährdetsten sind, die zu selbständigem Denken neigen. So ließ er ihn vom Gymnasialrektor Professor Mosche privaten Lateinunterricht geben und schickte den Vierzehnjährigen dann nach Gießen in das Pensionat des Orientalisten Hetzel. Für Gießen sprach außer der Nähe noch, daß Löw hier bei entfernten Verwandten rituell essen konnte. Von diesen Verwandten hat er in den zwei Jahren seines Gießener Aufenthaltes kaum Gebrauch gemacht. Er war selig über den Milieuwechsel. Er fühlte sich im Hetzel-Haus wohl.
Damals gab es für die Juden nur einen einzigen akademischen Beruf, der Chancen hatte: die Medizin. Löw sollte Mediziner werden. Wieder suchte der Vater einen Weg, den Jungen ausbilden zu lassen, ohne ihn den Gefahren einer öffentlichen Bildungs-Anstalt auszusetzen: er gab ihn zu dem berühmten Arzt und Philosophen Dr. Marcus Herz nach Berlin in Pension. Herz, der in Königsberg studiert hatte, war einer der angesehensten Ärzte und philosophischen Schriftsteller seiner Zeit. Kant hatte ihn einst beim Antritt seiner Professur zum Respondenten gewählt. Marcus Herz mußte auf den berühmten Vortrag ›De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis‹ antworten. Herz war mit Arbeiten überlastet. Neben seiner ärztlichen Tätigkeit hielt er in dem Berlin, das noch keine Universität hatte, stark besuchte populär-philosophische Vorträge. Kants Protektor, der Staatsminister von Zedlitz, der bei Herz hörte, machte ihn zum Professor der Philosophie mit einer lebenslänglichen Rente; eine Ehrung, die noch keinem Juden zuteil geworden war. Herz hatte auf Löw kaum Einfluß: einmal, weil er zu beschäftigt war, um sich dem blutjungen Medizin-Adepten wirklich widmen zu können, dann auch, weil er schon ein Sechziger war, zu entfernt diesem beginnenden Leben, vor allem aber, weil er ein von Kantischem und Lessingschem Geist geprägter Rationalist war, kaum geeignet, einen verschlossenen kleinen Frankfurter Ghetto-Juden in den Pubertätsjahren vorsichtig zu öffnen. Seine Frau, die berühmte Henriette Herz, schilderte in ihren ›Erinnerungen‹ Marcus’ geistige Haltung: »Mein Mann (älter als ich), mit Lessing persönlich befreundet, in diesem nicht nur den größten Kritiker der Deutschen, sondern, in Widerspruch mit Lessings eigener Ansicht, einen großen Dichter achtend, wies selbst in der schönen Literatur alles zurück, was nicht mit Lessingscher Klarheit und Durchsichtigkeit geschrieben war. Er teilte diesen Sinn mit mehreren seiner Freunde, unter anderen mit David Friedländer. Als dieser eines Tages mit der Bitte, ihm eine dunkle Stelle in einem Goetheschen Gedicht zu erklären und die stille Hoffnung im Herzen, er werde es nicht vermögen, zu ihm kam, wies er ihn mit den Worten an mich: ›Gehen Sie zu meiner Frau; die versteht die Kunst, Unsinn zu erklären …‹ Mit dem Auftauchen der romantischen Schule steigerten sich nun vollends meine ästhetischen Leiden. Hier war für Herz alles unwahr oder unverständlich. Aber den Höhepunkt erreichten sie mit Novalis. Für die Mystik hat freilich die bloße Wissenschaftlichkeit kein Organ. Und dazu kam, daß auch mir allerdings in den Schriften dieses Dichters manches unverständlich blieb, wenngleich ich seinen Geist und Streben im Ganzen wohl begriff. Herz, der eben in Novalis’ Schriften nur blätterte, um seinen Witz an ihnen zu üben, wußte meisterlich eben solche Stellen aufzufinden.« Wäre Baruch schon Börne gewesen, Aufrührer gegen das deutsche Ghetto, dann hätte er wohl in Marcus Herz den Mittelsmann zu den beiden mächtigsten deutschen Revolutionären dieser Epoche verehrt, dann hätte er gesehen, wie er, Ludwig Börne, in unmittelbarer Deszendenz Kants und Lessings Erbe angetreten hatte. Kant hatte den sittlichen Menschen ins Zentrum des Alls gestellt; Lessing hatte den Fortschritt des sittlichen Menschen ins Zentrum der Menschen-Geschichte gestellt; Börne verkündete nicht mehr den Adel der Menschheit, sondern exekutierte Kants und Lessings Verkündung, indem er diesen Adel zur Existenz zu bringen suchte. Aus dem großen ethischen Pathos erwachsen, vollzog Börne die intime Durchführung in der Härte der Wirklichkeit. Kant und Lessing waren der Generalstab der deutschen Aufklärung, Börne ihr Kriegsminister. Auch Lessing verließ schon ab und zu das rote Haus des reinen Planens und lieferte der Wirklichkeit eine Schlacht, aber erst Börne wandte sich mit seiner ganzen Kraft von der Gesetzfindung zur Exekutive. Sein Werk ist das Schlachtfeld geworden, auf dem Ideen Wirklichkeiten verwundeten, Wirklichkeiten töteten.
Als er im Haus des Aufklärer-Gelehrten Marcus Herz war, wußte er noch nicht, daß eine späte geistesgeschichtliche Topographie ihn zum Erben und Mehrer des Geistes machen würde, der hier herrschte. Er war sechzehn Jahre und sah nicht Marcus, sondern Henriette. Die »tragische Muse«, die »schöne Tscherkessin« war eine majestätische Gestalt mit einem kleinen, zierlichen, vollendet schönen Kopf. Wilhelm von Humboldt, Mirabeau, Schleiermacher, mit dem sie eine romantisch-empfindsame Freundschaft verband, beteten sie an. Die geistreich-anempfindlerische Jüdin stand im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses und Klatsches. Die zeitgenössische Karikatur, in der sie den unansehnlichen Schleiermacher wie einen Schirm in der Hand trägt, erzählt etwas von den Affären um sie. Sie war damals achtunddreißig. Sie hatte einen berühmten Salon, von dem sie »ohne Übertreibung sagen« konnte, »daß er in nicht langer Zeit einer der angesehensten und gesuchtesten Berlins wurde«. Es gab damals keinen Mann und keine Frau, »die sich später irgendwie auszeichneten, welche nicht längere oder kürzere Zeit, je nachdem es ihre Lebensstellung erlaubte, diesem Kreise angehörten«. So: Wilhelm von Humboldt, Schleiermacher, Mirabeau, Gentz, August Wilhelm Schlegel, Johannes von Müller. Löw sah nicht Marcus, nur Henriette: er verliebte sich. Und gestand ihr, als Marcus ein Jahr nach Löws Ankunft starb, seine Liebe. Sie erklärte ihm, »seine Liebe zu nichts brauchen zu können«. Löw-Werther schrieb aufs Papier: »Ich bin ein Mensch – Sie haben mein Urteil gesprochen. Ich kann nicht bestehen. Sie gossen öl zu der Flamme, es verzehrt mir mein Herz. Ich muß zugrunde gehen, wenn ich noch länger in Ihrer Nähe bleibe. Ich will fort von hier, das will ich meinem Vater schreiben. Ihre Vernunft wird mich tadeln, Ihr Herz mich bedauern! Lachen Sie? – So möge Sie in Ihrer Todesstunde das Gedächtnis verlassen, daß Sie sich dieses Vergehens nicht erinnern. Mir zittert die Hand, mir klopft ängstlich das Herz. Ich konnte nicht länger an mir halten. Das Haus steht in Flammen, ich muß mich retten, sonst gehe ich zugrunde.« Eine Kinderkrankheit. Aber nicht auf die Krankheit, sondern auf den Kranken kommt es an, und Löw gehörte zu denen, die zugrunde gehen können. Seine Aufzeichnungen über diese Liebesleidenschaft waren keine Empfindsamkeits-Posen, sondern Niederschläge einer ernsten Krise. Henriette Herz, der diese Jungen-Leidenschaft schmeichelte, die von dieser Jungen-Leidenschaft erschreckt wurde, schilderte in ihren »Erinnerungen« die ganze Gefahr der Situation: »Er war nicht lange bei uns, als mein Mann starb, aber er bat mich so dringend, ihm ferner den Aufenthalt in meinem Hause zu gönnen, daß ich, die ich füglich seine Mutter hätte sein können, ganz arglos seinen Bitten nachgab. Ich wurde zuerst aus meiner Unbefangenheit aufgeschreckt, als mir eines Tages, da ich mich eben bei meiner Mutter befand, von einem meiner Dienstmädchen ein von ihm an den Apotheker Lezius in der Königsstraße gerichteter Zettel gebracht wurde, in welchem er diesem unter Beifügung von zehn Friedrichsdor, als Zahlung seiner Rechnung, welche bedeutend weniger betrug, bat, ihm durch Überbringerin eine Dosis Arsenik zu schicken, weil er in seinem Zimmer sehr von Ratten und Mäusen geplagt sei und seine Abwesenheit während einer vorhabenden kurzen Reise zur Vertilgung derselben durch dieses Mittel benutzt werden solle. Dem Mädchen war jedoch sowohl der Inhalt des – offenen – Zettels, als das Benehmen des Absenders aufgefallen, und dies war der Grund, weshalb sie das Papier statt zu dem Apotheker zu mir brachte. Ich erschrak so heftig, daß es mir unmöglich war, sogleich nach Hause zu gehen, schickte jedoch sogleich meine Schwester Brenna zu dem jungen Menschen. Und durch sie wurde mir denn zu meiner großen Betrübnis zuerst die Gewißheit, daß er andere Empfindungen für mich hege, als die für eine mütterliche Freundin. Aber sie glaubte ihn zur Vernunft zurückgebracht zu haben.« Kurze Zeit darauf fand das Stubenmädchen einen Zettel, in dem Löw der Henriette erklärte, er werde sie in diesem Leben nicht mehr wiedersehen. Löw konnte also nicht länger in ihrem Haus bleiben. Sie schrieb an seinen Vater und schickte ihn mit des Vaters Einwilligung zu Professor Reil nach Halle. Das Haus Herz war nur eine Episode, nur irgendeine Passage seines Lebens.
Im Hochsommer 1803