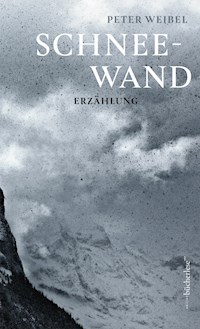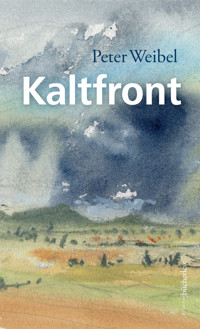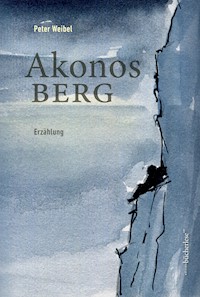Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann geht immer wieder zum Bahnhof, immer wieder zu den Geleisen, um vielleicht zufällig Hannah wiederzusehen, mit der er eine Familie hätte gründen können. Gregor findet sich am Berg, im Reich der Steine, von Schemen seiner Vergangenheit umgeben. Joshua will noch einmal ans Meer, bevor alles zu Ende geht. An den Rändern – der Gesellschaft, des Lebens – bröckeln die Gewissheiten. Zugleich öffnen sich andere Perspektiven. Peter Weibels neue Erzählungen handeln von Menschen, die sich abhandengekommen oder in Institutionen verloren gegangen sind, von Menschen, die bald gehen werden und von jenen, die zurückgeblieben sind. Es sind Geschichten von Widerstand und Hoffnung, erzählt mit grosser Wärme und Sensibilität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Weibel
An den Rändern
Erzählungen
BRANDUNG
HERZVERSAGEN
AN DEN RÄNDERN
ALLE ERSCHÜTTERUNGEN
KOCHERPARK
VERGESSEN
REICH DER STEINE
HANNAH
WAS WIR WISSEN
STEINTAL
GRENZEN
ALTERN
ENTWÜRFE
MAHNMAL
TESCHUWA
AISHA
WEGMARKEN
SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
LICHT
Für Linda
Wir können einen anderen Menschen nicht verstehen,solange wir nicht seinen Schmerz und sein Leiden verstehen.
OLGA TOKARCZUK
BRANDUNG
Portofino nicht, Laigueglia nicht, auch Nizza nicht. Aber Stresa, vielleicht Stresa. Wenn überhaupt. Während Wochen schieben wir die Fragen hin und her, manchmal überhören wir sie, es kann sein, dass wir Joshuas Fragen überhören wollen. Bis wir wieder seinen Blick sehen. Joshuas verlorenen und verletzlichen Blick, der tief unter die Haut zieht. Vielleicht Stresa, drei oder vier Stunden Fahrt, es wäre nicht unmöglich. Für Martha ist es unmöglich. Sie hört nie hin, wenn wir Pläne in die Luft werfen, um wieder an ihnen zu zweifeln, um sie zu verwerfen, aber vielleicht hört sie auch ganz genau hin und lässt uns einfach reden. Nur einmal sagt sie streng: Stresa nicht und überhaupt nirgendwohin, wisst ihr denn nicht, was das bedeuten würde? Martha weiss, was es bedeutet. Sie hört jede Nacht Joshuas schleppenden, seinen rasselnden Atem, seit sie es nicht mehr ausgehalten hat, im Nebenzimmer zu schlafen, seit sie ihr Bett ganz nahe an seines geschoben hat. Das laute Rasseln, das oft während Stunden nicht aufhört, reisst wie schweres Bohrgeräusch durch Marthas Schlaf, bis sie verstört aufschreckt, manchmal fünfmal in der Nacht oder mehr, bis sie den Sauerstoffschlauch holen muss.
Joshua liegt nur noch wie ein dünner Strich im Bett, seit die Lähmung auch die linke Körperseite befallen hat, man kann ihn wie Leichtgepäck aufheben. Wenn er, selten genug, einmal redet, reicht die Kraft noch für einen, vielleicht zwei Sätze, dann sind die Batterien leer, die Stimme wird tonlos, nur an seinen Lippen hängen noch Zeichen, stumme Sprachzeichen für etwas, was er will oder auch nicht will. Eigentlich will Joshua gar nichts mehr, nur eines will er noch. Er will noch einmal ans Meer, an eine Brandung, noch ein einziges und letztes Mal im Leben.
Überhaupt nirgendwohin, sagt Martha, nie mehr. Sie wendet sich ab und sieht uns an, als hätten wir jedes Mass verloren, wenn wir das Unvorstellbare weiterdenken. Wenn wir sagen, manchmal muss man an die Grenzen gehen, wenn alles nur noch ein Warten auf die allerletzte Grenze ist. Wir könnten auch sagen, Joshua hat im Leben nur wenig zu verlieren, aber er kann noch etwas gewinnen, vielleicht etwas wie Glück, einen Atemzug brennendes Leben. Wir können Joshua von Tag zu Tag besser verstehen. Meer und Brandung hören wir immer wieder in seinen Sätzen, und wir verstehen ihn genau. Auch wenn es einfacher wäre, ihn nicht zu verstehen.
Wir brüten über Landkarten, klopfen Orte der Erinnerung ab, und irgendwann fällt der Name, vielleicht Stresa, schon tief in Italien und ein See wie ein Meer, und es ist nahe, drei oder vier Stunden? Der Name hakt sich fest, er ist nicht mehr wegzubringen, und wir sehen, dass Joshua zu warten beginnt, dass er in Gedanken schon unterwegs ist, vielleicht schon nach Stresa unterwegs ist, und dass sein Blick anders geworden ist, wacher. Es ist unmöglich, Joshuas Blick zu begegnen und ihn nicht zu enttäuschen. Wir beginnen, die Reise ins Ungewisse zu planen, wir suchen einen grossen Wagen mit Liegefläche, zu Martha sagen wir: Wir nehmen alles mit, was Joshua braucht, Inhalationsgerät, Notfallkoffer, Sauerstoff. Sie lässt sich nicht anmerken, was sie noch immer vom Unternehmen hält, gar nichts, aber sie ist nachgiebiger geworden, vielleicht hat sie Joshuas fiebrige Erwartung umgestimmt, schliesslich sagt sie: Natürlich fahre ich mit.
Als wir an einem grauen Junimorgen aufbrechen wollen, verlässt uns für einen Augenblick der Mut. Joshua sieht blass aus und atmet schwer, er hat kaum geschlafen. Nur seine Augen haben einen warmen Glanz, und wir glauben zu wissen, was er jetzt denkt, er denkt, wenn wir heute nicht fahren, fahren wir nie mehr. Martha sieht uns mit eisigem Blick an, als wäre sie sich sicher, dass wir bei erster Gelegenheit, bei der ersten Ausfahrt wieder umkehren würden. Wir kehren nicht um. Die Fahrt dauert länger als vier Stunden, wir haben das Gefühl, es sind zehn Stunden oder mehr. Zweimal, dreimal legen wir die Sauerstoffmaske um Joshuas schmalen Kopf, der endlose Simplontunnel ist ohne Sauerstoff nicht zu überstehen, nach Domodossola geraten wir in ein Gewitter, das so heftig ist, dass wir auf der löchrigen Strasse durch sprühende Wasserlachen katapultiert werden. Als endlich der See vor uns liegt, bricht erstmals die Sonne durch, mit fahlem Glanz.
In Stresa ist es schon brütend warm, die Sonne steht direkt über uns. Auf dem Parkplatz vor der Schiffsstation stauen sich die Wagen, Männer mit Shorts und weissen Mützen versuchen erfolglos Ordnung zu schaffen, die Luft vibriert vom Staccato der Stimmen, von der lustvollen fremden Sprache, es riecht nach Maschinenöl und Espresso. Leute kommen an oder brechen auf, viele stehen in Gruppen zusammen und warten darauf, dass jemand ein Zeichen gibt. Die Senioren einer Reisegruppe schauen mit offenem Mund zu, wie wir Joshua aus dem Wagen und in den Rollstuhl heben, wie wir ihn stützen müssen, weil er sich nicht aus eigener Kraft halten kann, und das Sauerstoffgerät an den Rollstuhl hängen. Sie starren Joshua an, als gehörte er auf die nächste Notfallstation. Aber Joshua gehört nicht auf eine Notfallstation, er gehört hierher.
Er atmet jetzt ruhiger, das Rasseln ist kaum zu hören, und seine Augen leuchten, als wollte er den See und mit ihm die Welt umarmen. Das Leuchten hält an, als wir uns langsam in Bewegung setzen, als wir uns in die Kolonne der Uferwanderer einreihen. Vorne Martha, die den Weg freihält für Joshua, den wir mit den Händen stützen und mit dem Rollstuhl über Treppen und Wegabbrüche heben wie einen König in seiner Sänfte. Vielleicht ist Joshua jetzt auch wirklich eine Stunde lang König, ein anspruchsloser König, der noch einmal sein verlorenes Land sehen kann. Die Leute begegnen uns mit besorgtem Blick, ein paar lächeln Joshua ergriffen zu, einige bleiben stehen und starren ihn an wie eine Erscheinung. Ein bewegungsloser Mime in weissem Gewand und mit weiss bemaltem Gesicht gibt seine Versteinerung auf und verneigt sich so tief vor Joshua, dass sein Weisskopf den Boden berührt.
Weit draussen, schon ausserhalb der Stadt stossen wir auf eine kleine Bucht, wo zwei Kinder Steintürme bauen, sonst ist da niemand. Joshua gibt uns ein Zeichen, und wir halten an. Er will ganz nahe ans Wasser, so nahe, dass die Wellen bis an den Rollstuhl schwappen, dass sie ihm ins Gesicht spritzen, Joshua lässt sich davon nicht abhalten, er will bleiben. Wir bleiben lange, eine Stunde, zwei, wir haben nicht gewusst, dass Joshua das schaffen kann, sich so lange im Rollstuhl halten, er hat ihn nie länger benutzt. Er horcht reglos in die Brandung hinein, die manchmal schweigt und dann wieder in rythmischen Schlägen heranrollt, es sieht aus, als hätte er alles andere vergessen, die unselige Fahrt und den griffbereiten Sauerstoff und auch uns, als hätte er auch sich selbst vergessen. Auch wir horchen jetzt auf die Sprache der Brandung, die hart und wieder versöhnlich ist, in jedem Wellenschlag beides, aber wir können nicht hören, was Joshua hört. Vielleicht hört er etwas, das über ihn hinausgeht, das über die Zeit hinausgeht, wir würden es gerne wissen. Vielleicht ist es etwas, das ihn aufnimmt, ihn in einen anderen Raum trägt, nicht greifbar und nicht erklärbar. Wir hören es nicht, aber wir sind uns sicher, Joshua hört es die ganze Zeit. Wir bleiben lange, der Himmel ist schon grauweiss und milchig, wir bleiben, bis das Prasseln von Joshuas Atem laut und gefährlich geworden ist, bis sein Kopf ganz leicht zur Seite kippt, fast unbemerkt, und er tonlos sagt, nun ist es gut. Seine Augen sind fest auf Martha gerichtet, es ist keine Unruhe darin zu erkennen.
Einen Augenblick warten wir unschlüssig, als könnte uns irgendeine Antwort erreichen, als würde sich etwas entscheiden. Wir wissen nicht, was kommt, wie der Weg zurück sein wird, ob wir das schaffen, ob Joshua es schafft und ob er eine Rückfahrt überhaupt will. Aber wir haben Joshuas Augen gesehen, etwas wie Glück in seinen Augen, und wir halten uns an den Gedanken, dass es nicht falsch gewesen sein kann, hierherzukommen. Dass man manchmal etwas tun muss, das viele für unsinnig halten und das dennoch einen Sinn ergibt.
HERZVERSAGEN
Christa weiss nicht mehr, wann sie zum letzten Mal mit Vincent zusammen da war. Sie hat das Gefühl, es ist Jahre her, aber es sind nur ein paar Monate. Vincent konnte nur noch mit Mühe gehen, eigentlich gar nicht mehr, aber er wollte das, er wollte noch einmal zu seinem Platz, Christa kann noch heute hören, wie er geatmet hat, er hat geatmet, als wäre nie genug Luft da, als wäre nicht einmal zum Sitzen und Schweigen genug da. Er hat noch immer darauf gewartet, dass etwas geschieht, dass etwas zu Ende geht, vielleicht hatte er das Warten auch schon aufgegeben, Christa kann das nicht mehr sicher sagen. Wie lange hält mein Herz noch durch?
Hinter Neubauten und Baukränen ist der hohe Klotz des Unispitals nicht zu sehen, wo man Vincent einen Tag lang von Untersuchung zu Untersuchung geschleppt hat, wo die Gesichter immer ernster wurden, immer verschlossener, und man schliesslich versuchte, es ihm so schonend wie möglich zu sagen: Ohne Spenderherz können Sie nicht überleben.
Der Rasenplatz vor der Uni ist jetzt kalt und leer, nur ein paar Kinder toben lustlos herum, werfen sich auf die leeren Liegestühle, die wie kahle Gerippe herumstehen. Die jungen Wilden sind weg, die hier im Sommer ihre Freizeit zelebrieren, träge ausgestreckt oder eng umschlungen und elektrisiert vom Sound ihrer Technorhythmen. Auch die Schachspieler sind weg. Eine Gruppe von Japanern mit Fotoausrüstung kommt aufgeregt näher, bleibt gestikulierend und ratlos stehen. Einstein ist weggesperrt, sagt Christa, he is in reparation, vielleicht kommt er mit neuem Metallglanz und winterfest wieder zurück. Die Japaner nicken und lachen zustimmend, Christa ist sich nicht sicher, ob sie verstanden haben. Sie denkt, vielleicht ist es gut, dass Einstein in stillem Einverständnis mit Vincent verschwunden ist.
Der Schock hatte Wochen gedauert. Aber die Gespräche auf der Herzabteilung gaben Vincent Halt, er wusste jetzt, was auf ihn zukommen würde. Die Informationen waren beruhigend, an ihnen konnte er sich aufrichten: Herztransplantationen sind heute Routineeingriffe; Verlegung auf die Bettenstation am zweiten oder dritten Tag. Erste Spaziergänge nach einer Woche, wenn alles gut geht, Heimkehr nach drei bis vier Wochen. Er begann sich einzurichten in der neuen Denkordnung – Warteliste, Wartezeit, Operation. Die Wartezeit unbestimmt, nur immer bereit und erreichbar sollte er sein.
Vincent begann wieder an etwas zu glauben, woran er lange nicht mehr geglaubt hatte. Er stellte sich vor, wie das sein könnte mit einem neuen Herz. Nicht mehr schleppend langsam gehen und nach Luft ringen, nicht mehr mit fünfundvierzig Jahren alle paar Meter stehen bleiben wie ein alter Mann. Wieder zu den blühenden Alpwiesen hochsteigen mit der Kamera. Christa hat Vincents Satz nie vergessen, den er auf seiner Einsteinbank gesagt hat: Eigentlich ist das Leben ein fragiles Gesamtkunstwerk, aus hundert kleinen Kunstwerken zusammengesetzt, jetzt weiss ich es. Seit das Herz immer schwächer wird, weiss ich es.
Sie hat Vincent nie gefragt, warum er diesen Platz so geliebt hat, warum er ausgerechnet neben dem Monument Einstein sitzen wollte, aber sie hat es geahnt. Es gefiel ihm einfach, den Passanten zuzuschauen, wie sie vorbeiströmen, mit ihren Zielen und den letzten Textnachrichten beschäftigt, und plötzlich ins Stocken geraten, wenn sie die reglose Figur auf der Bank sehen und nicht wissen, lebt er oder ist er ein Kunstgeschöpf. Sie beschleunigen ihre Schritte oder verlangsamen sie, je nachdem, oder sie kommen neugierig näher, bis sie befreit auflachen und dem hohlen Körper auf die Schulter klopfen. Einmal war Christa dabei, als ein junger Eritreer Vincent ansprach, und natürlich dachten sie beide, er will Geld, aber er wollte kein Geld, er zog ein paar Unterschriftenbögen hervor und sagte in gebrochenem Deutsch, ich sammle Namen gegen ein neues Tram, das Tram tötet die Bäume, Bäume dürfen nicht sterben. Sein feuriger Eifer hatte etwas Rührendes und schwer Begreifbares. Ein anderes Mal blieb ein älterer Herr verstört stehen und fragte, wie kommt denn der alte Goethe hierher. Vincent hat nur mild gelächelt und nichts gesagt. Aber er hat das heitere Missverständnis genossen.
Christa nimmt einen abgebrochenen Ast und zeichnet ein Herz auf den körnigen Boden, sie weiss jetzt genau, wie ein Herz aussieht. Wie ein filigranes Wunderwerk, das in fliessender Bewegung ist und viel kleiner, als man denkt. Das rätselhafte innere Uhrwerk ist das Wunder, und auch die Kraft, mit der dieser kleine Muskel zu pumpen vermag. Über hunderttausendmal am Tag und vierzig Millionen Mal im Jahr.
Eine fieberhafte Erwartung trieb Vincent lange an. Die Anspannung vor einem Abenteuer, von dem man nicht weiss, wann es anfängt, wie es sein wird. Sie trug ihn durch die Monate, auch als er längst nicht mehr arbeiten konnte, als er sich immer mehr schonen musste wie ein Schwerbeschädigter. Christa wünschte sich, dass die Anspannung anhalten würde bis zu dem Tag, an dem es soweit wäre. Aber sie hielt nicht an, die Zeit verlangsamte sich, blieb stehen. Trocknete das dunkle Feld Zukunft aus. Christa weiss, dass es keine Worte dafür gibt, wie das Warten für Vincent wirklich war. Neun Monate, zehn? Dreihundertmal am Morgen aufstehen mit dem Blick aufs Mobiltelefon, das noch immer stumm ist. Das in der Nacht neben dem Bett liegt und durch den Schlaf zuckt, den Schlaf zerreisst. Manchmal hörte Vincent im Traum seinen Klingelton, immer nur im Traum, bis er es einfach fortwerfen wollte. Er warf es nicht fort. Es blieb seine Lebensbrücke, er klammerte sich daran. Aber die Erwartung wurde dumpfer, begann zu lähmen. Die Lähmung wucherte weiter, die Tage verloren ihre Zugkraft.
Die schwarze Wand vor dem Nichts, wozu noch warten? Warum die Medikamente nicht einfach fortwerfen, dann geht es schneller. Manchmal schreckte Vincent mitten in der Nacht auf und schleuderte weg, was ihm unter die Finger kam. Einfach immer bereit sein, den Koffer gepackt, die Transportwege geklärt, wenn der Anruf kommt.
Der Anruf kam nicht.
Der Koffer steht noch immer unberührt im Hausflur. Trainingsanzug, zwei gebügelte Hemden, Waschzeug. Soll ich ein Buch einpacken, hatte er sie gefragt. Christa versucht, genauer in die Gesichter zu schauen, die vom Bahnhof heraufkommen, sie versucht, sich ihre Geschichten vorzustellen, Anfänge von Geschichten, sie denkt, auch Vincent würde das jetzt tun. Die Hast, mit der die meisten blicklos unterwegs sind, kommt ihr vor wie ein Versehen, wie Gehen auf einer falschen Spur, ohne dass sie sagen könnte, wo denn die richtige Spur liegt. Im Strom der Passanten sieht sie ein altes Paar, das nur langsam vorankommt, er knickt immer wieder ein, sie hält ihn unaufgeregt und geduldig am Arm. Die Gelassenheit der beiden findet Christa tröstlich.
Über das fremde Herz aus unbekanntem Himmel hat Vincent nicht oft gesprochen. Aber Christa weiss, dass er jeden Tag daran gedacht hat. Auch dann noch, als er kaum mehr atmen konnte, als er nur noch mit der Sauerstoffzange im Bett lag und fast nur noch schlief. Dass einer sterben muss, damit ich leben kann. Dass der Tod eines anderen mein Leben retten soll. Keiner stirbt für dich, hat Christa dann gesagt. Ein sinnloser Tod ist immer ungerecht, aber ein Tod, den man verhindern kann, ist es auch.
Vincent hat auf ein neues Herz gewartet, nicht darauf, dass irgendjemand stirbt. An den letzten glasklaren Sommertagen, wenn Christa das Dröhnen von Rettungshelikoptern hörte, war das Wort Spenderwetter auf einmal da. Donor weather. Sie wollte nicht daran denken, der Gedanke kam dennoch. Sie scheuchte die Vorstellung weg, dass an einem solchen Tag jemand verunglücken könnte. Ein Unheil durfte nicht sein und war doch die einzige Rettung. Sie wusste nicht, ob Vincent überhaupt noch daran denken mochte. Oder ob nicht alles schon zu weit weg war. Ein Wettstreit mit der Zeit, der nicht mehr zu gewinnen war.