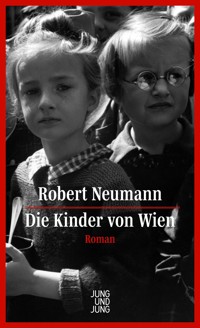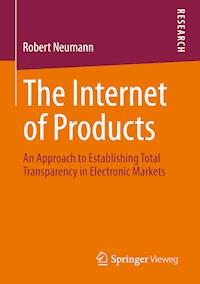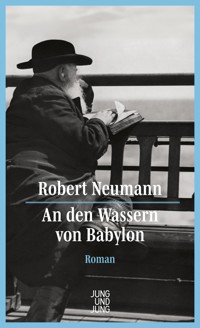
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1938, ein Autobus quält sich über eine staubige Straße nach Palästina. Hinter denen, die der Zufall in diesem Gefährt zusammengewürfelt hat, liegen bewegte Vergangenheiten, vor ihnen eine ungewisse Zukunft. Ein Grenzposten prüft die Liste der Passagiere: »Juden. Von überall.« Aus Konstantinopel, München und New York, aus Polen und Russland haben sie sich auf den Weg gemacht. Alle sind sie auf der Flucht, viele von ihnen schon seit langer Zeit. Robert Neumanns Exil-Roman An den Wassern von Babylon ist ein schillerndes Kaleidoskop der jüdischen Diaspora. Er erzählt von verleugneter Identität und trotzigem Aufbegehren, von Naivität und Widerstand, von Duldsamkeit, Zuversicht und Resignation. Dabei spielt Neumann mit den Slangs und Sprechweisen der Milieus, in denen sich seine Figuren bewegen, tritt als wütender Brandredner und bitterer Humorist auf, als akribischer Historiker und bibelfester Romancier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AN DEN WASSERN VON BABYLON
BHubert-Sattler-Gasse 1, A-5020 Salzburg
© 1987 Robert Neumann Estate
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlagbild: Hanns Tschira
© Bildarchiv Pisarek/akg-images/picturedesk.com
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-320-3
ROBERT NEUMANN
An den Wassern von Babylon
Roman
mit einem Nachwort von Herbert Wiesner
Warum willst du sterben, du Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tode dessen, so da stirbt, spricht der Herr Darum wende dich, und lebe.
Hesekiel, 18,31–32
Was in diesem Buche berichtet wird, greift weit zurück, und auch der Vorfall an der Grenze ereignete sich vor kaum mehr vorstellbar langer Zeit – noch vor dem letzten Kriege.
DIE GRENZE
DIE GRENZE
Das Wasser war noch grau, doch zitterten schon Lichter auf den flachen Kämmen der Dünung, die aus den ungewissen Nebeln der hohen See träg mächtig in einer schlafhaft breit hinrollenden Traurigkeit gegen die Küste lief. Nur eine Viertelstunde, so wußte man, nur noch zehn Minuten, dann ist alles azuren. Wie gelbe, nackte Knochen, blankgespült von der Morgenebbe, lagen die Ufertrümmer eines toten Gesteins, das sich in langen, langsamen, baum- und graslosen Halden höherklimmend in die Wildnis kegliger, einander gleichender Berge zog. Nur noch zehn Minuten, so wußte man, dann ist da die große Dürre und der ewige Sand. Ein erblaßter Dreiviertelmond segelte weit dort hinten irgendwo über das öde Land. Nur noch eine kleine Weile, so wußte man, dann ist er verstorben.
Zwischen Wüste und Meer, dem träge klimmenden Flutschwall jener Südostbucht nur um wenige Meter landein entrückt, standen Pfähle in regelmäßigem Abstand. Zwischen diesen Pfählen schimmerte Draht. Die Telegrafenleitung entlang war in Dreimeter-Breite der rauhe Stein zermalmt und hinabgepreßt zu einer holprigen Wanderspur, die immer wieder für eine Strecke in einem Tümpel fliegenden Sands ertrank. Das war eine Straße. Wo ein im Widerstreit von Wüste, Meer und dem großen Wind zu einer unüberschaulichen Halbmondform zusammengebrochener Uferberg nah an die Küste trat, war zwischen Wasser und Wildnis nicht einmal mehr Raum gewesen für dieses Dreimeterband, und so hatte man es aus dem Gestein gesprengt. An dieser Sprengstelle, die Straße beherrschend, klebte am Berghang ein dürftiges Steinhaus. Ein Wegweiser zeigte dahin und dorthin. Nach der einen Seite war es die Wüste. Nach der andern Seite, an einem Schlagbaum vorbei und über das Bett eines eingetrockneten Flusses weg, war es wieder die Wüste, doch hieß sie dort Palästina. Über dem Steinhaustor war ein Wappen. Es wohnten da die englischen Wächter des Landes Kanaan.
Dieser Teil der Straße war neu. Die alte war, dem Küstensturz ausweichend, keine dreihundert Meter von der Grenze mit einer jähen Wendung in die Berge getreten; blickte man scharf hin, so sah man dort noch ihr schon dem Sand und der Ödnis verfallenes Fundament. Auch zog sich, Kontinent mit Kontinent verbindend, irgendwo dort hinten das Schienenband einer Eisenbahn; doch war die nicht sichtbar. Und auch ein vereinzelter Pfiff, der mitunter auf den Schwingen der trockenen Sonnenluft aus ihrer Verborgenheit herüberritt, war so ohne Macht vor der großen Stille, daß er nicht lauter war als eines fernen Wüstenvogels klagender Wanderruf. Da war nur das Meer und der Wind, da war nur das Land und der Sand, da war nur die Straße.
Blickte man scharf hin, so sah man die wandernde Säule des Staubes schon meilenfern. »Ein Auto«, sagte der Telegrafist, auf der Steinstufe neben dem Schlagbaum sitzend, das Fernglas am Auge.
Der Sergeant nahm ihm das Glas aus der Hand. »Ein Autobus«, sagte er nach einer Weile. Nun war es so, daß zu der Zeit nicht viele Autobusse über die Grenze fuhren nach dem Land Palästina, in dem ein unruhiger Frieden war. Die Fremdenreisezeit hatte für jenes Jahr noch nicht begonnen; viel Zustrom händelsüchtiger Araber gab es aus den Ländern ringsum; auch gab es einen heimlichen und zähen Zustrom von Juden; man schaute sich besser der Reisenden Pässe an. »Den Schlagbaum nieder«, befahl der Sergeant.
Der Telegrafist sagte: »Es ist kein Auto avisiert auf der Straße. Aber die Leitung war nicht in Ordnung während der Nacht. Kann sein –« Er brach ab, die Säule war nähergekommen, er hatte wieder das Glas am Auge. »Sie fahren wie die Verrückten«, sagte er ruhig.
Nun war es schon mit unbewaffnetem Auge erkennbar: ein großer, schwerer, sechsrädriger, staubgrauer Autobus. Die Nummerntafel war nicht zu unterscheiden, doch gehörte das Fahrzeug nach Farbe und neuartigem Bau zu einer Rotte amerikanischer Wagen, die weit dort hinten im Westen liefen, jenseits der Ödnis, auf den regelmäßig befahrenen ägyptischen Linien. Aber dieses Ausdemweggeratensein des Reisekolosses war immer noch weniger verwunderlich als die Weise, wie er gesteuert ward. Aus Sorglosigkeit, aus Übereile, oder, fast konnte man es glauben, weil er mit den Hebeln und Knöpfen des Schaltbretts nicht ganz vertraut war, hatte der Führer es übersehen, die Scheinwerfer abzudrehn. So blickten sie, blaß gewordene Augen, durch das Grau des frühen Tags, und an ihrem Irren war zu erkennen: die dort fuhren tatsächlich wie die Verrückten. Rechtshin, linkshin geworfen, immer wieder in einem letzten Augenblicksbruchteil zurückgerissen von dem Verderben des Straßenrands. Sand stiebte, Staub quoll unter den Rädern dieser rasenden Reise.
Als der Wagen noch dreihundert Meter von dem niedergelassenen Schlagbaum und den auf der Straße Wartenden ferne war, bremste er so scharf ab, daß man das Kreischen herüberhören konnte durch die trockene Luft. Nun kam er zu stehen. Ob nun aber ein so sehr Ortskundiger auf dem Lenksitz saß oder ein so sehr Ahnungsloser oder nur einer, der eben erst den Grenzposten und Schlagbaum wahrgenommen hatte und dem jeder Weg lieber war als der dort vorüber – das Automobil fuhr wieder an und bog seitab auf die verfallene, unter Geröll und Flugsand kaum mehr sichtbare Straßenspur, die sich dort in die Berge zog.
»Sie brechen durch«, rief der Telegrafist. »In fünf Minuten sind sie über der Grenze!«
Der Sergeant sagte langsam: »Noch nicht.«
Der Autobus arbeitete sich höher, stand schräg, glitt zwei Meter zurück auf dem Schottergrund, fand sein Gleichgewicht, fuhr weiter. Von der Straße gesehen klomm er nun schon in beträchtlicher Höhe. Der Sergeant verlangte: »Das Maschinengewehr. Wir schießen auf die Reifen.«
Der Wagen dort oben bog taumelnd doch siegreich gesteuert um die Kante des Halbmondbergs und verschwand.
»Das tut nichts«, sagte der Sergeant. »Das Maschinengewehr. In vierzig Sekunden kommen sie an der alten Straßenschleife dort oben wieder zum Vorschein.« Er hatte die Uhr in der Hand. »Zwanzig Sekunden«, sagte er. »Dreißig.« Die Männer standen um ihn und warteten. Einer kauerte hinter der zylindrischen Waffe auf ihrem Drehgestell und visierte. Ein Schweigen war.
»Achtzig Sekunden«, sagte der Telegrafist. »Sie werden nicht wieder sichtbar.«
Der Sergeant sagte: »Wenn sie nicht wieder sichtbar werden –« Er verstummte und horchte.
»Zweieinhalb Minuten«, sagte einer der Männer.
Nun erst, in die Stille, die folgte, trug die trockene Luft um die Kante von der unsichtbaren Seite des Berges her ein ungewisses Geräusch. Das war so fein und so fern, daß man nicht zu erkennen vermochte, ob das nun ein Klirren gewesen war oder ein Poltern oder auch nur ein Knall.
»Da ist etwas geschehen«, sagte der Sergeant. Er wandte sich und befahl: »Sechs Mann dort hinauf.«
Der Telegrafist saß drinnen am Apparat. Indes die ausgesandte Patrouille schon über eine Schutthalde bergwärts klomm, trat er wieder auf die Straße hinaus. Er trug einen Zettel. Er sagte: »Ich habe mit den Posten drüben auf der ägyptischen Seite Verbindung bekommen. Der Autobus ist heute nacht um elf Uhr gemietet worden, in El Bahra, für eine Sonderfahrt.«
Der Sergeant, mit dem Blick auf jene bergwärts Klimmenden, fragte: »Die Passagiere?«
»Ich habe die Namen.« Der Telegrafist las von seinem Papier. »Der erste heißt« – er unterbrach sich und lachte ein wenig, ehe er fortfuhr: »Reb Mojsche Wasservogel aus – ich kann den Ort nicht aussprechen. Muß in Polen sein. Dann ist da einer – wie heißt der? Borscht! Mit Frau und Tochter.«
Der Sergeant sagte: »Juden.«
»Warten Sie«, sagte der Telegrafist; er las weiter: »Lord Melville!«
»Ein Jude«, sagte der andere.
Der Mann las von seinem Zettel:
»Madame Sephardi, Konstantinopel.
Simson Silverman, Preisboxer aus New York. Mit Frau.
Glückstein, ein französischer Advokat. Mit Sohn.
Smith, Ingenieur aus London.
Liselotte Lewy aus Wien, kommt von Moskau.
Marcus, Schriftsteller, München.«
Der andere nickte. Und fragte: »Schluß?«
»Einer noch«, sagte der mit dem Zettel. »Der Name ist mehrfach gemeldet worden – mehrfach verschieden. Der Mann heißt Schlessing – ist die Vermutung der Polizei.« Er setzte hinzu: »Heißt er Schlessing – so läuft gegen ihn ein Steckbrief.«
»Juden«, sagte der Sergeant. Er hatte seine Augen auf den nun schon ferner und höher Klimmenden auf dem Hang; nun bogen sie dort oben Mann um Mann hinter die Kante des Berges.
Der Sergeant wiederholte: »Juden. Von überall.«
DIE ERBEN
Wasservogel – oder Das Leben im Geiste
Borscht – oder Das Blut der Väter
Melville – oder Das Lächeln der Schlafenden
WASSERVOGEL oder Das Leben im Geiste
Dies ist der Bericht von einem Mann, der bekannt war unter dem Namen: der Blasse. Dieser Blasse hatte hinter sich ein reiches, heiteres und unbelastetes Leben. Keine Lieben, keine Geschwister, nicht einmal seine Eltern hatte er sterben sehen müssen – und war doch schon über fünfzig Jahre alt. Das kam daher, daß er jene Lieben, Eltern, Geschwister nicht kannte. Denn als man ihn damals auffand, hatte er, als ein Kind von drei Jahren, noch nicht den rechten Blick für die kleinen Vorgänge ringsum. Nicht für den Vater, der da lustigerweise sich schlafend stellte und auf dem Estrich lag mit dem bärtigen Gesicht in einer Lache fröhlichen Rots. Nicht für die Mutter, die ein wenig geschrien hatte, als die vielen fremden Männer mit den schönen Kosakenuniformen sie stolpern machten. Nicht auch für die Brüderchen und die Schwesterchen und die Kinder von nebenan, die jene Uniformleute an lange, blitzende Bajonette gespießt hatten, daß es für ein weiß Gott wie und weiß Gott warum Übersehenes ein wenig zum Lachen war. Da waren auch schon die lustig knisternden Flammen, die an Bett, Tisch und Schrank sich ergötzten. Dann waren, nach Abzug jener Kosaken, auch alsbald die weißröckigen, fröhlichen ukrainischen Bauern da, mit Säcken, um mitzunehmen was sich etwa noch fände. Und einer fand noch ein versehentlich lebendiges Judenjunges unter den Gemetzelten sitzen, und gutmütig wie Bauern sind, nahm er es lebendig mit sich, so wie ein Jäger ein lebendig gebliebenes junges Reh oder Füchslein mit sich nimmt.
Es war aber diese kleine, den Juden damals an der Karpathengrenze gewordene Bestrafung nur ein gerechter Ausbruch des Volkszorns. In einem Orte mit Namen Tisza-Eszlar drunten im nahen Ungarn hatte in diesem Jahr 1882 ein Jud, wegen Verwendung von Christenblut nach altem Brauch vor die Richter gezogen, die Frechheit gehabt, unter dem Schutze jüdischer Advokaten aus Budapest und aus Wien auf seinem Freispruche zu bestehen. Weil er freigesprochen worden war, mußte man die Juden ein wenig in ihrem Übermut beschneiden. Das tat man drei Jahre lang, bis ins vierundachtziger Jahr. Kaum zweitausend von ihnen wurden dabei erschlagen. Und das war wieder ein Beweis für den Fortschritt der Menschheit an weichlichen Ideen und für ihren Rückschritt an Tüchtigkeit, denn zweihundert Jahre zuvor, als der große Chmelnicky noch lebte, hatte er es in eben jenem Landstrich in einem einzigen Sommer auf siebenhunderttausend tote Juden gebracht.
Das so am Leben gelassene Rehlein wurde acht Jahre alt und wußte nicht wie, ehe es von zwei bärtigen Kaftanhausierern gefunden wurde, es wußte nicht wo, und in eine Stadt gebracht, es wußte nicht ihren Namen, wo viele Kaftantragende nah und warm beieinander wohnten. Denn so lebt sichs nun einmal fröhlich weiter nach einem kleinen Aderlaß.
Da sein Name vergessen war, nannten sie ihn Moses wie jenen andern im Strom des Lebens Gefundenen, und gaben ihm, wie das Gesetz des Zaren es vorschrieb, auch einen europäischen Namen. Doch hieß er schon damals, als ein Achtjähriger, gemeinhin »der Blasse« – und das wollte etwas besagen unter der Gemeinschaft der Judenkinder von Semienka. Das war der Name der kleinen Stadt. Mit achteinhalb verstand und schrieb er Hebräisch und Jiddisch. Mit neuneinhalb konnte er große Strecken der Thora auswendig hersagen und las neben Jünglingen, Männern, Greisen viele Stunden des Tages im Talmud. Die Nacht verbrachte er als Gewölbwächter eines Altkleiderhändlers, für das Nachtlager, zwei Stück Zwiebeln und einen halben Hering als Wächterlohn. Doch war das minder wichtig, als daß er von jenem Altkleiderhändler auch die Besitztümer seines Lebens erwerben konnte: ein Sterbehemd, wie der Gläubige es mit sich führt; ferner ein hebräisches Buch, auf dem als Titel stand Sohar, das heißt: das Leuchtende, und das dem Knaben in einem erregenden, beinahe ketzerischen Gegensatz zu stehen schien zu den ihm bis dahin bekannt gewordenen hebräischen Büchern. Es bejahte, was jene verneinten; es war irdisch sozusagen, wo jene anhingen dem Vertrag mit Gott dem Herrn und der buchstäblichen Auslegung des geheiligten Worts; und so war es zu verdammen und doch sündhafter- und lockenderweise aufzubewahren in aller Heimlichkeit. Dazu kam als dritter Besitz ein überzähliges, einäugiges Hündchen, das zu ertränken man von jenem Brotherrn ausgeschickt worden war, und dem zwischen Unrat und Gerümpel in glückhaftem Geheimnis das Leben zu bewahren dem blassen Knaben zum Abenteuer jener sorgenlosen und umfriedeten Jahre ward. Doch vermochten diese beinahe unstatthaft diesseitigen Bindungen das Leben im Geist und die Glaubensstrenge, wie sie von einem Mann von damals schon mehr als zehn Jahren zu erwarten waren, nicht zu erschüttern. Mit elf Jahren hielt er vielmehr in der Talmudschule von Semienka jene in rabbinischen Kreisen später viel erörterte Disputation, bei der er gegen dreimal und sechsmal ältere Unterredner die Kabbala und alles Kabbalistische, als da war der ohnmächtige Versuch eines Brückenschlagens vom Worte zur Wirklichkeit, mit einer für solch einen jugendlichen Gelehrten verwunderlichen und durch genaue Vertrautheit mit den von ihm verdammten Schriften befremdlich wirkenden Entschiedenheit der Dialektik verwarf. Mit dreizehn Jahren, ein Mann schon, der auf seinen eigenen Beinen stand, Marktkarrenabladehelfer bei einem Geflügelhändler und weiter Nachtwächter in jenem Altkleidergewölb und eine Hoffnung der Thoraschule ansässiger strenggläubiger Judenheit, wurde der Blasse als mannbares Mitglied in diese Gemeinde von Semienka aufgenommen. Es war das im zweiundneunziger Jahr.
Im vierundneunziger Jahr, am 26. August, erfolgte im Auftrag des Gouverneurs von Kiew unter Einsetzung einer Eskadron der Achten Don-Kosaken, dreier katholischer Priester, der lokalen Musikkapelle und einer Kompanie der Kischinewer Stadtpolizei in Semienka der Einzug der Fliegenden Militärischen Kommission. Von dem Versuch, die Juden auszurotten, war man in Rußland eben damals übergegangen zu dem edlern, sie zu erziehen. Das tat man, indem man sie in die Grenzbezirke des großen Reiches verbannte, wo das Leben ein wenig dürftiger und dadurch geeigneter war zu moralischer Festigung. Indem man ihnen zweitens den Aufenthalt in diesen Grenzbezirken verbot, damit sie sich nicht etwa zu Spionage und Schmuggel verleitet fühlten. Indem man ihnen zum dritten das Leben in den Dörfern und auf dem flachen Land untersagte, dem schlichten, treuherzigen, ihren jüdischen Praktiken nicht gewachsenen Bauern zum Schutz. Und indem man viertens den derart in den Städten Zusammengetriebenen dort zwar kein Quartier gab, ihnen dafür aber auch die Ausübung eines Gewerbes, den Beitritt zum Anwalt-, Arzt- und Beamtenstand und den Ankauf von Haus und Boden ein für allemal verwehrte. Einer ob solcher Pädagogik jählings einsetzenden Prosperität des Leichenbestattungsgewerbes konnte man allerdings nicht gut Einhalt tun. Und da auch die erlassenen Ehebeschränkungen samt Judendoppelsteuer, Spezialprotektionsabgabe und Israelitenerziehungsumlage nur halbe Wirkung taten, wollte man den halsstarrigerweise Überlebenden wenigstens jene heilsame Disziplin erschließen, wie sie in der Zarenarmee gang und gäbe war. Und kurz und gut – an jenem 26. August 1894 etablierte sich zu Semienka die Fliegende Militärische Kommission. Daß vierzehn Juden erschlagen, zweihundertelf verletzt und etwa achthundert Häuser geplündert wurden, geschah eigentlich nur aus Versehen, und am Abend zog man weiter, mit hundertachtzig jüdischen, für fünfundzwanzig Jahre Waffendienst dem Zaren verpflichteten Rekruten wohlbewacht in der Mitte.
Unter diesen war einer, fünfzehnjährig damals, mit Namen Moses oder Mojsche Wasservogel – es war das der bürgerliche Name, mit dem eine vorsorgliche Behörde ihn unterscheidbar machte von anderen, die Mojsche hießen, und auf ewig erzieherisch verbunden mit den Segnungen der Zivilisation und des Abendlands. So war es ihm wieder einmal wohl gelungen im Leben; man hatte ihn nicht übersehen und nahm sich gar trefflich seiner an; jenes immerhin mühvollen Marktkarrenabladens und Gewölbbewachens war er ledig; für Kost und Quartier sorgte fürder der Zar und gab ihm noch eine zwar dreckige aber prächtige Uniform! Auch hatte er nicht wie mancher andere den Schmerz eines Abschieds von seinen Lieben, Eltern, Geschwistern. Und der Verlust jenes Hündchens, das ein Infanterist scherzhafterweise auf sein Bajonett spießte, wog weniger als der Glücksfall, daß ihm das wichtigere Teil seines Besitztums erhalten blieb: jenes Buch und auch jenes Totenhemd. Damit war einer nicht schlecht ausgerüstet fürs Leben.
Der für fünfundzwanzig Jahre vorgesehene Militärdienst des kaiserlich russischen Infanteristen Mojsche Wasservogel dauerte drei Monate und einen Tag. Die drei Monate waren gefüllt mit einigem Exerzier- und Marschierversuch. Ferner mit dem Spaß, daß man dem Infanteristen Wasservogel das von seiner Religion verbotene Schweinefleisch zu essen gab (ein wenig gewaltsam zu essen gab, wie man gestehen muß, mit Festhalten, Indenschlundstopfen, Durchdenhalswürgen, wie man es sonst mit den Gänsen treibt). Ferner mit einigem hieran sich schließendem Krankliegen in einer Baracke (auf den Tod krank liegen, wie man am besten gleich zugibt), das aber aufgehellt ward dadurch, daß der Militärpfaff täglich in christlicher Nächstenliebe sich einstellte an dem Krankenbett. Und einmal fragte er: »Na, Jud, wie gehts, wie stehts?« Und einmal fragte er: »Na, Jud, wie wärs mit Sichtaufenlassen und der ewigen Seligkeit?« Und einmal sagte er: »Wenn du dich nicht taufen läßt, jetzt, sofort, heute, du dreckiger Saujud –!«
Das waren drei Monate. Der eine Tag, der noch fehlte, des Infanteristen Mojsche Wasservogel Militärdienst vollzumachen, war einem Strafexerzieren gewidmet. Das begann um sechs Uhr am Morgen, unter Hepp und Hallo. Für zehn Uhr war ein allgemeines Ausrücken angesetzt, in Feldmarschadjustierung mit Tornister und Bajonett. Um zwölf Uhr, als die Sonne hochstand, schlug der Infanterist Wasservogel lang hin und kollerte ein wenig seitab in den Graben des staubigen und endlosen Karrenwegs. Und da er sich nicht mehr bewegte, nahm man ihm Tornister und Bajonett und den Rock und die Stiefel und ließ ihn liegen, dort wo er lag.
In Wirklichkeit war in diesen drei Monaten die Erlebnisreihe des Infanteristen Wasservogel ein wenig anders verlaufen, als es nach außenhin den Anschein hatte. Jene Zwangsaushebung hatte ihn unterbrochen auf der Höhe der Meditation über die mögliche Rechtfertigung des von den Rabbinen Jona Gerondi und Salomo ben Abraham vom Berge im Jahre 1226 ausgerufenen Banns gegen die profaner Wissenschaft gewidmeten Werke des Moses Maimonides. Wenn (so hatte er schon all die Wochen zuvor bei seinen Nachtwachen in jenem Kleidergewölb und auch beim Abladen der Geflügelkarren gedacht) – wenn Jacob ben Machir, genannt auch Profatius, recht hätte mit seiner Verdammung jener Rabbinen, wie hätte der große Raschba zu Bercelona diesen als Eideshelfer erstehn können, in dem Großen Bannfluch von dreizehnhundertundfünf? Es wäre (so dachte er eben, als mit Hepp und Hallo jene Musterer in die Schule von Semienka brachen und ihn aufrissen von seinem Meditationspult) – es wäre da nachzulesen, wie die ersten Erkenner des Zwiespalts in Gottes Volk, des Zwiespalts zwischen Ratio und Antiratio sich zu der Frage verhielten. Was er, der fünfzehnjährige Reb Mojsche Wasservogel von Nirgendwo, als Störung und mit leisem Protest empfand, war nicht so sehr die zwangsweise Einkleidung in ein unwürdig buntes Tuch (als ginge es, kaum fünf Sabbate nach dem Versöhnungstag, auf einen Purim-Ball) – sondern daß man ihm, durch eine ihm aufgenötigte räumliche Entfernung, das Heraussuchen jener seinen Fragenkomplex beleuchtenden Werke aus dem Büchergewölb der Gelehrtenschule von Semienka unmöglich machte. Es hatte da (so erinnerte er sich, indes man in folgenden Wochen das sinnlose Hin- und Widerstolzieren auf einem abgemessenen Feld und das Anfassen eines gefährlichen Kriegsinstrumentes, eines sogenannten Gewehres, von ihm verlangte) – es hatte da einen frühen Versuch gegeben zu einem dualistischen Kompromiß!
Wie war es (so dachte er eines Abends, nachdem die gleich ihm in Buntes verkleideten Gojim ihren Scherz getrieben hatten mit ihm nach Gojim-Art und ihm etwas Unreines durch den Schlund gepreßt) – wie war es, dachte er, indes er schon auf seiner Pritsche lag, mit Würgespuren am Hals und ein wenig Blut auf den Lippen, und das Fieber in seinen Adern schwoll, wie war es mit der Lehre des Rabbi Isaak Albalag? Es war wohl nur dieses Fieber (auch lag er da schon anderswo, das war wohl, was man nennt: ein Spital), das es ihm als aussichtsreich und statthaft erscheinen ließ, daß er den täglich ihn durch einen Besuch auszeichnenden Galach (als da ist das Wort des Gläubigen für einen christlichen Priester) befrage nach dem ihm entfallenen Namen jenes Werks des Rabbinen. Es ist das Werk, mein Herr Galach – so gedachte er all die Tage lang es ihm klarzumachen –, das sich an der Möglichkeit einer dualistischen Lösung der ewigen Antithese zwischen Ratio und Irratio versucht! Sie kennen es selbstverständlich, es muß recht genau um das Jahr zwölfhundert gewesen sein, Herr Galach, nach Ihrer Rechnung der Zeit!
Der Christ sprach von anderem, so wie Christen tun – Taufe, sagte er, Saujud und derlei leicht Überhörbares. Aber da Gott einem das Hirn wieder erhellte vom Fieber, am neunzigundersten Tag seines Militärdienstes, mitten in einem sein tieferes Bewußtsein nicht weiter berührenden, Strafexerzieren genannten Vorgang, fiel dem Infanteristen Mojsche Wasservogel tief glückhafterweise endlich der Name ein. Die Lehre von der Doppelten Wahrheit – so hieß jenes Werk des seit bald siebenhundert Jahren toten Rabbinen! Und dies war (aber das wußte einer erst, da er von der Sonne geschlagen seitab in den Straßengraben gekollert war und, um jene bunten und gewalttätigen Gegenstände erleichtert, nach Verhallen von Schritt und Tritt allein gelassen mit seinem Hirn und dem Herrn in einer großen äußern Ermattung lag) – dies also war jenes Werks von der Doppelten Wahrheit Kernsatz und Weisheit: »Bin ich auch auf Grund meiner wissenschaftlichen Einsicht davon überzeugt, daß etwas sich mit Naturnotwendigkeit auf eine bestimmte Weise verhalte – was vermag das wider den Glauben? Und so glaub ich gleichzeitig und dennoch dem Wort des Propheten und daß auf eine übernatürliche Weise sich zugetragen habe das Gegenteil!«
Es war aber dieser Reb Mojsche von Unbekannt in einem Zustand großer Beglücktheit über die Wiederauffindung der vergessenen Sentenz. In diesem Zustand – demgegenüber es wenig wog, daß von seinem Puls und von seinem Atem nicht mehr viel zu merken war – fanden ihn zwei kaftantragende Hausierer und erkannten ihn als einen der ihrigen Leute. Sie brachten ihn nach einer nahen und guten Stadt, in der achtzigtausend andere Kaftanträger zusammenwohnten, in drei sicheren Gassen. Die nahmen den aus dem Militär Gefallenen auf, wie es sich gegenüber einem Gelehrten ziemt. Damit er sein Brot und Auskommen habe, gaben sie ihm bei einem Wurstmacher einen Gedärmwäscherposten, was ein leichtes Gewerbe war. Den Rest des Tages und ein Gutteil der Nacht saß er in der Gelehrtenschule über den Büchern. Und der Umstand, daß er mit seinem Militärbesitz auch jenes geheime Druckwerk verloren hatte, an dem ein wenig sein Herz hing, wog weniger als der Glücksfall, daß ihm das wichtigere Teil seines Besitztums erhalten blieb: Es war ein Sabbat gewesen, als ihm jener kleine Unfall und jenes große Erinnern kam. Den Sabbat zu heiligen in der Fremde, hatte er nichts anderes unternehmen können, als daß er sich festlich kleidete. Und er führte nichts Festlicheres bei sich als jenes sein Totenhemd. Das trug er am Leibe, als man ihn liegen ließ. So blieb ihm immer noch dieses Hemd als Besitztum. Damit war einer nicht schlecht ausgerüstet fürs Leben.
Die Stadt, die ihn so gut und gastlich aufnahm zu einer dauernden Geborgenheit, hatte den Namen: Kischinew.
Einer Registrierung der Biographie des M. Wasservogel in den Jahren, die folgten, stehen Schwierigkeiten entgegen. Die der Zeitberechnung ist unter ihnen noch die geringste. Ob er nach der Stadt Kischinew im Jahre 1894 nach Christi Geburt kam oder im Jüdischen Jahre 5655 nach Erschaffung der Erde, das wäre minder wichtig als die Beantwortung der Frage, ob er denn nun also wenigstens wirklich in diesem 1894er Jahre lebte, als er dort einzog – oder nicht vielmehr im Jahre 1611, oder im Jahre 1502, da der Kabbalist Ascher Leculin sich als einen Vorläufer des Messias bezeichnete, oder im Jahre 1399 zur Zeit des Posener Hostienschändungsdisputs. So wäre es vielleicht richtiger, nicht von Jahren zu sprechen, sondern von der Meditation. Dann kam er nach Kischinew, als in ihm war die Doppelte Wahrheit des Isaak Albalag, und blieb dort eine sehr kurze Weile, die als neun Lebensjahre zu bezeichnen abwegig wäre – reichte sie doch eben hin, ihn erkennen zu lassen, daß auch die Behutsamkeit und Bedingtheit, mit der der Scholastiker diesseitige Erkenntnisquellen immer noch zuließ, ein Weg in den Irrtum und ins Verderben war. Ja er war nahe daran, dies betreffend einen noch entschiedeneren Standpunkt zu beziehen, noch trennten ihn vielleicht nur wenige Versöhnungstage oder gar nur ein kleines Dutzend Sabbate von einer Entscheidung hierüber – als der Vorfall von Kischinew sich ereignete.
Der Vorfall von Kischinew böte denn, nach Jahresepochen und Meditationsepochen, eine dritte Möglichkeit zur Einteilung der Zeit. Dem erziehungsfreudigen Zaren Alexander war ein Zar Nikolaus, der zweite seines Namens, auf dem Throne gefolgt (man schrieb 1903), und dieser neue hielt es den Juden gegenüber wieder einmal nicht mit der Pädagogik, sondern mit der eisernen Faust. Es war das in Rußland eine demokratische Zeit – für die Volkstümlichkeit des neuen Herrschers mußte etwas geschehen. Am 6. April dieses Jahres 1903 verkündeten Flugblätter in der Stadt Kischinew, der neue gute Zar habe die Abhaltung eines Pogroms gestattet. Es war kein großer Pogrom – als am Ende des zweiten Tags die Truppen eingriffen, zählte man fünfundvierzig Tote und fünfhundertsechsundachtzig zu Krüppeln Geschlagene oder sonstwie ein wenig Ramponierte, ausschließlich, wie sich versteht, der vergewaltigten Frauen. Doch sprang der kleine Funken von Kischinew noch in diesem selben Augustmonat 1903 hinüber nach Homel, Schitomir, Odessa, Bialystok und dann noch nach sechshundertvierunddreißig anderen Städten und Städtchen in achtundzwanzig Provinzen des durch solches frischfröhliche Hand in Hand mit der Behörde von revolutionären Gedanken abzubringenden Russenreichs.
Will man nun also diese dritte Art der Zeitberechnung heranziehen, die nach Pogromen, so erlebte der Blasse seine Entscheidung zur unbedingten Antiratio und Wortgläubigkeit zur Zeit des Pogroms von Kischinew. Eine Welle der innern Anfechtung dieser seiner Unbedingtheit hatte er durchzumachen zur Zeit, als die Massenverbreitung eines die geheimen Praktiken der jüdischen Weltverschwörer aufdeckenden Druckwerks, genannt: Die Weisen von Zion, einen neuen Judensturm entfachte. (»Achtung, der Jüd marschiert!« so hieß die Parole.)
Wobei das jene innere Anfechtung Auslösende selbstverständlich nicht besagter Sturm war. Der drang gar nicht hinab bis in den Keller, in dem der brotlos gewordene emeritierte Gewölbwächter, Geflügelkarrenablader und Wurstdarmwäscher Mojsche Wasservogel auf einem feucht verfaulenden Strohlager hauste. (Die Abwässer eines undichten Kanales sickerten durch die Mauern; ein Weib mit drei Kindern verhungerte nebenan.) Nein, was den Blassen, der ein wenig entkräftet in jenem Keller lag, in eine kleine und vorübergehende Anfechtung stürzte, war das Verhalten der Juden selbst. Es war da ein Mann aufgestanden unter der Judenheit, ein Westler mit dem Namen Theodor Herzl. Der hatte eine höchst verwirrende und verstörende Erfindung gemacht, und der Name für das Ding hieß: Nation. Wie aber: sollte es nun also eine nationale Bewegung unter den Juden geben als wären sie Gojim, mit bunten Anzügen und gefährlich anzurührendem Tötungsinstrument in der Hand? Sollte wirklich der Herr Gott seinem Volke die Demütigung und Strafe abfordern wollen, daß es dem Goj die Faust und Stirne zeigen müsse nach Gojim-Art?
Die Anfechtung für den Besinnlichen war gering, wenn man ihm nur Muße ließ, es recht zu bedenken. Als er es recht bedacht hatte, schrieben die Christen eben 1914 oder 1915, und in einigem Nebensächlichen und Äußerlichen ringsum trat unter vieler Gewalttat ein Wechsel ein, wie er in der Natur des Vergänglichen nun einmal beschlossen ist. Reb Mojsche Wasservogel zog eben mit anderen eine lange, enge Gasse hinunter – er rannte, jene anderen rissen ihn mit sich fort. Die Häuser brannten links und rechts, und was da ticktackte, war ein russisches Maschinengewehr, und was da explodierte, waren deutsche Granaten. Nein, diese neue Erfindung, genannt Nation, sie war zu verwerfen – so meditierte der Rennende. Über sie stand nicht geschrieben, also war sie nicht existent! Das Ticktacken der russischen Maschinengewehre war da schon ferngerückt, und die Häuser schwelten verkohlt, und jeder dritte oder vierte der Kaftanträger lag still auf den Katzenköpfen des Pflasters, zwischen denen ein kleines hellrotes Rinnsal lief, und die Deutschen zogen schon mit Schritt und Tritt in die Ruinen ein.
Als ob Gott, so meditierte der Blasse und fror ein wenig vor Hunger, zur Errettung und Erhöhung seines Volks eines Doktor Theodor Herzl bedürfte und seiner Erfindungen! Wie zum Beispiel hatte Er dem Anführer der Buntverkleideten (einem Goj und General, er hieß Ludendorff) es ins Herz gelegt, daß er einen Anschlag kleben lasse an alle Mauern? »Zu die lieben Jidden in Paulen!« Und wenn sie bis dahin geknechtet worden seien von Rußland, zertreten, geschändet, in Häuser gepfercht, Mann, Weib und Kind, und mit Petroleum übergossen und massakriert – jetzt, Jud, so stand es da, jetzt, unter dem Segen und der Freiheit unserer Kultur, jetzt (wenn du nur zu uns hältst und eine deutschpatriotische Extra-Befreiungskontribution bezahlst), jetzt wird das anders! Freue dich, Jid in Paulen – der Deutsche bietet dir seine Bruderhand!
Die Registrierung der Erlebnisse des M. Wasservogel begegnet von diesem Augenblick des Eingriffs deutscher Ordnung in seine Existenz keiner weitern Schwierigkeit. Nicht, daß er etwa gar zu jenen dreiundachtzigtausendundvierhundert gehört hätte, die dem brüderlichen Ruf des Deutschen Folge leisteten und die Bärte und Schläfenlocken hinopferten unter dem Schermesser, um einzutreten in die deutsche Armee oder gar um nach Westen auszuwandern in ihre gastfrei dem neuen Bundesgenossen sich darbietenden Städte Breslau und Berlin. Diese Versuchung war dem im Glauben Lebenden nicht einmal eine Versuchung. Doch vertiefte sich in ihm der Gedanke: wie wenn diese Erhellung des Großen Elends der Fremde in der Tat ein Fingerzeig des Herrn Gottes sein sollte dafür, daß der Tag des Messias nicht mehr ganz ferne war? Kam da der Goj und reichte die Bruderhand! Mochte sein – es hatte Gott, dem das Sonderbarste noch dienstbar ist, den Goj gesandt als ein Zeichen? Und da eine geringe Weile danach (die Christen schrieben 1918) der Goj Deutscher davonzog, kam nun auch noch der Goj Pole und der Goj Ukrainer und baten: Komm, Bruder Jud, hilf mir bauen ein Freies Polen, hilf mir aufrichten wider die Roten ein Freies Ukrainisches Königreich! Und gehörte der Blasse auch nicht zu den hundertunddreiundsiebenzigtausend, für die dieser Bruderruf ein Ruf in den Tod ward, so brachte er doch auch ihm die Erhellung, endgültig und nicht mehr verrückbar: Ja, dies war des Herrn Gottes Signal! Auf den Messias zu warten, dauerte sicherlich nicht mehr lang. Es war an der Zeit, sich zur Reise zu rüsten!
Es gab aber, so steht es geschrieben in der Anweisung des Elieser ben Nachman, für diese Reisezurüstung ein Doppeltes zu vollziehen. Und ist das erste, daß einer sich seines irdischen Eigentums entblöße, bis auf einen Reisezehrpfennig. Was das betrifft, so wohnte der Mojsche Wasservogel in dieser festlichen Zeit, da das Lamm sich lagerte mit dem Löwen, in behäbigen Umständen in der Stadt Lemberg. Sonnenstraße 34 hieß das Quartier. Mit nur neun Personen teilte er eine Kammer, in der es vier Betten gab, indes ringsum und in der Altgasse links und in der Synagogengasse rechts um die Ecke bis zu zwanzig in solch einer Kammer wohnten und hatten nur drei Betten oder auch zwei. Aber hier waren in vergangnen zwei Wochen vier Kinder an der Krankheit Scharlach gestorben und eine Greisin an ihrem Greisentum, und so hatte man behäbigen Raum! Man konnte gehen und kommen. Auch gab es einen Abtritt nur zwei Stockwerke tiefer. Auch war es nicht kalt, wenn alles daheim war und man das Fenster schloß. Und sogar großherrlich aus diesem Fenster lehnen konnte man sich mitunter, da ein Teil der Rauminsassen tagsüber drüben auf dem Jüdischen Markte stand, um etwas zu verkaufen oder zu kaufen, wenn etwa doch einer sich fände, der etwas zu kaufen oder verkaufen kam. Das Besitztum des Reb Mojsche Wasservogel ruhte unter dem Fußteil des einen Betts und war, wie es solcher Wohlbestalltheit entsprach, ein behäbiges Bündel. Darin fand sich nicht nur jenes Hemd, als Letztes und Wertvollstes, sondern auch einen Schatz von fünf Büchern besaß er zu jener Zeit, ferner einen ganzen Kranz Zwiebeln, die reichten auf lang hinaus, und vier Hosengurte, zwölf Kerzen und drei Spiegel mit Kämmchen – wenn etwa einer sich fände, der Kerzen oder Hosengurte erstehen wollte, oder ein Goj, der auf Ausschau war nach einem Präsent.
Gab somit der erste Punkt der Vorschrift für einen Reisenden, sein Hab und Gut zu veräußern, schon Anlaß zu Umsicht und tatkräftiger Spekulation – der zweite Punkt forderte Höheres, Tieferes, Schwereres: die große innere Bereitschaft für das endgültige Zeichen zum Aufbruch, für das Zweite Signal! Es gab aber für den sich Bereitenden Einen Weg – und einen Andern Weg. Und war der erste, daß er der Ankunft des Messias harre in Gebet und Kasteiung. Das war der Weg der Rabbinen. Für sie war Reb Mojsche Wasservogel mit seinen scharfsinnigen Streitgesprächen eingetreten, seit er nur dachte. Und der Andere Weg des Wartens – der war verpönt! Wie, oder sollte vielleicht doch ein im Glauben Gereifter, einer schon jenseits der Jahre, da man ein Weib sich wählt, mit ergrauendem Bart und falb gewordenen Schläfenlocken sich noch die Lehren eines Baal Schem, des Chassiden, zu eigen machen, so da anriet dem Wartenden: Freu dich, Jud, daß der Messias nicht ferne ist; Jud, trink, tanz!
Es war dies, meditierte der Blasse in seinem guten Quartier mit dem Packen seiner Erdengüter vor sich auf dem Fensterbrett – es war dies eine verpönte und doch eine lockende Lehre. Nicht gut für den Alltag, gewiß. Aber nun, da die große Wandlung vor sich ging, da man neunzehnhundertundachtzehn schrieb und der Goj nicht weiter den Juden schlug? Was besagen wollte – so meditierte er –, daß man vielleicht kecken Mutes hineinfassen sollte in dieses Irdische, in diesen Kranz Zwiebeln zum Beispiel, und ihrer zwei verzehren zu einem einzigen Mahl, mit einem weißen Stück Sabbatbrot. Daß man einen der gojischen Präsentspiegel vor sich aufklappte hier auf dem Fensterbrett und das Haar sich kämmte mit dem Kämmchen, das in dem imitierten Leder verborgen stak. Daß man Kerzen – gleich zwei auf einmal! – vor sich hinpflanzte hier auf den Tisch und ansteckte, prasserisch, um müßig sich rückwärts zu lehnen, Bein über Bein, und zu lesen in einem Buch! Es war diese Versuchung die größte, der der Blasse ausgesetzt war in seinem Leben. Bedachte er es, alles in allem, so hatte er seine Tage herrlicher hingebracht als irgendein anderer. Gewiß, es hatte da einige Gewalttat gegeben. Aber wo war einer ein Jude – und begegnete nicht der Gewalt? Und hatte Gott ihn aus vielen Gefahren nicht ebenso viele Male gerettet?
An diesem Nachmittag bürstete Reb Mojsche Wasservogel von Nirgendwo mit einer Bürste den schwarzen Rock, den er trug, und setzte feierlichen Blicks, obgleich es ein Werktag war, auf seinen Scheitel den mit Kaninchenfell beborteten Sabbathut. Er stopfte sich vermessen mit vier Zwiebeln die Taschen voll, und auch eines jener Spiegelchen steckte er zu sich. Unter seinen fünf Büchern wählte er lange, welches er wohl mit sich nähme auf seinen Gang. Denn zu gehen, zu promenieren, großherrlich – danach stand sein Sinn. Das Buch, das er wählte, hieß Sohar, das heißt: das Leuchtende. Solch ein Buch hatte er besessen als Jüngling – und verloren zu gutem Recht, da er selber damals noch nicht erleuchtet gewesen war. Er wandte sich noch einmal auf der Schwelle und überschaute seine behäbige Wohnung mit einem lächelnden Blick. Das also war sein. Und es war wohl nur zur Erhöhung dieses seines irdisch festlichen Besitzergefühls, daß er sein Bündel unter dem Bett noch einmal hervorzog und ihm jenes linnene Hemd entnahm und es an sich verwahrte, in der großen Tasche des schwarzen Rocks. Freude, sang er schon auf der Treppe – ich singe die Freude des Ewigen!
Es waren wenig Leute im Hause mitten am Nachmittag, auch hatten die ihre Sorgen, jeder für sich, und achteten seiner nicht. Als er drunten schon auf der Gasse stand, versuchte er einen Tanzschritt. Es war das aber nicht so sehr selten in der Sonnenstraße des Judenviertels von Lemberg, daß einer unter die Tänzer ging. Ein Chassid, dachten zwei, drei, die vorüberhasteten, und hielten nicht an. Da stellte der M. Wasservogel das Tanzen ein; er war ein wenig von Kräften gekommen, der Schwindel überkam ihn über dem Drehen. Auch gelüstete es den großherrlich Promenierenden, diesmal nicht die Juden zu sehen, die ihm glichen und die er kannte – sondern den Bruder Goj! Er verließ das Quartier. Da war schon eine Straße mit einer Straßenbahn. Gott, sang er, Gott, ich singe die Freude des Ewigen!
Zwei stießen ihn, einer lachte, ein Automobil verhielt mit Bremsenkreischen die Fahrt, da er über den Fahrdamm ging. Er holte eine Zwiebel aus der Kaftantasche und ein Stück weißen Schabbes-Brotes und biß darein. Schalom, grüßte er mit Lächeln und Winken drei Brüder Gojim, drei Eckensteher – Schalom, mit euch sei der Friede! Das war die Vorstadt, da waren noch zwei, drei Fabriken, dann war da ein Friedhof, ein Schuttabladeplatz, ein Strich zerfressenen Wiesenlands. An dieser Stelle versuchte der M. Wasservogel noch einmal zu tanzen. Ihn schwindelte. Auch war er allein. So ging er weiter in den schütteren Wald.
Der sogenannte Petljura-Pogrom, der nach Liebeswerben der Deutschen, Polen und Ukrainer über den Osten Europas ging, gehört der Geschichte an. Er setzte ein am 4. Januar 1919. An diesem Tag traf auf dem Bahnhof der ukrainischen Stadt Berditschew die sogenannte Todeskompanie ein. Das waren weißrussische Offiziere, die eben jenem Petljura zugehörten; die Mannschaft rekrutierte sich aus ukrainischen Bauern, Städtern, sowie Kosaken. Die auf dem Bahnhof angetroffenen Juden wurden mit Reitpeitschen totgeschlagen. Bei Kindern, später schon in der Stadt, war man mitunter nicht sicher und fragte: »Bist du ein Judenjunges?« – ehe man sie aufs Bajonett nahm. Die Frauen warf man über die Betten, die Männer trieb man auf die Straße hinaus und zwang sie zu rufen: »Tod den Juden!« Und knallte sie nieder.
Von Berditschew zogen die Kameraden des Todes nach Schitomir, von dort weiter nach Owrutsch. Dort ließ der Ataman Kosyr Syrko am 14. Januar die Juden zusammentreiben. Dann brachten sie die Kosaken mit Peitschenhieben in Trab und zwangen sie, das Lied Majofes zu singen – das Sabbatlied. Darüber kamen sie vor dem Bahnhof an. Von dort aus ließ der Ataman mit Explosivpatronen in die Singenden feuern, bis mit dem letzten Kaftanmann der letzte Ton des Liedes verstorben war.
An diesem selben 14. Januar wurden die Juden erschlagen in Kiew, Bobrinskaja, Sorny, Fastow, Romoday, Bachmatsch und Kasatin. In Proskurow erging der Befehl: zu töten ohne zu plündern. Der Ataman Semossenko ließ seine ordenklirrenden Offiziere und mit westlichem Kapital untadelig ausgerüstete Mannschaft aufs Banner schwören: die Hände sollten blutig sein – aber rein. Man marschierte in die Judenstadt mit der Musikkapelle an der Spitze und der Sanitätskolonne am Schluß. Alle wurden mit der blanken Waffe geschlachtet; kein Schuß fiel. Ein Priester, der mit dem Kruzifix in der Hand dem Schlächterzug in den Weg trat, wurde getötet. Tausendfünfhundertundsechzehn Tote gab es zwischen drei und sechs Uhr nachmittags an diesem 2. Februar 1919 in Proskurow.
Von da zog man nach Felchtin, von dort nach Schargorod, von dort nach Pestschanka. In diesen drei Städten schnitten Offiziere und mit westlichen Geldern ausgerüstete Mannschaft vierundvierzig Juden die Zunge ab, sechzehn riß man die Augen aus. Die Männer rasierte man und zwang sie, ihre Bärte zu fressen, ehe man ihnen das Bajonett gab. In Bratslaw hängten die Leute des Petljura an die dreißig an ihren Händen auf und schnitten ihnen mit den Säbeln das Fleisch von den Knochen. Und zwangen zwei Stunden später in dieser selben Stadt Bratslaw dreizehn Frauen (die des Rabbiners, die des Kaufmanns Weinreb und die des Arztes waren unter ihnen), ihre Kinder mit ausgestreckten Armen ihnen entgegenzuhalten. So schlug man ihnen die Köpfe ab.
So wurden vom Monat Januar bis zum Monat Oktober 1919 hundertfünfundsechzigtausend Juden qualvoll zu Tod gebracht. An die dreihundertvierzigtausend wurden zertreten, verstümmelt, geblendet – und lebten weiter. Die Vermißten sowie die geschändeten Frauen, Jungfrauen, Mädchenkinder wollte man zählen, um in Versailles eine Liste zu überreichen. Als die Liste eine Million und einhunderttausend Namen lang war, gab man das Zählen auf.
Reb Mojsche Wasservogel, der unter die Chassiden gegangen war, figurierte nicht auf der Liste der Toten, nicht auf der der Verstümmelten, nicht einmal auf der der Vermißten – und dies wohl, weil ihn keiner vermißte. Daß er durch den Zufall eines Ganges in die freie Natur vor dem Entsetzen bewahrt blieb – seines ersten Gangs dieser Art, in jener neuerwachten Tänzerfreude an dieser Erde –, das mußte die Überzeugung in ihm festigen, es sei endlich das Zeichen an ihm geschehen. Er rastete auf einem Baumstrunk in kahlem Wald, und es war ein seltsamer Anblick, wie er selbst in seiner Starrheit und falbhaarigen Dürre solch einem Baumstrunk glich. Geirrt – so meditierte er – hatte er nur, da er glaubte, jenes Zeichen sei wirklich schon das Große Signal gewesen für Alle. Er errötete vor sich selber, daß er auch nur für eines Atemzuges Dauer hatte annehmen können, wirklich habe der Goj die Bruderhand hingereicht und habe es wirklich so gemeint. Nein, was geschehen war, das war ein Zeichen für ihn, den M. Wasservogel allein, der sich der Freude an dieser Welt zugekehrt hatte. Und es hieß: Es will Abend werden, Reb Mojsche, so mach dich bereit für die Reise!
Von da ab, irgendwann im Spätjahr 1919, war ein falbbärtiger, blasser, mit einem vor Alter grünlich schimmernden Kaftan bekleideter und festlicher Mensch von großer Hinfälligkeit und Dürre des Leibes darauf aus, den Reisepfennig zu sammeln zu seiner Fahrt nach Jerusalem, um dort zu sterben. Für dieses Sammeln, dessentwegen er von Ort zu Ort und von Gemeinde zu Gemeinde und von reichen Manns Tür zu reichen Manns Türe zog, brauchte er lange Zeit, denn es waren viele Tausende Kaftantragende gleich ihm auf den Straßen, die sammelten und wollten in der Erde Zions begraben sein. Einmal, nach sieben Jahren, war er nahe daran, daß er aufbrechen konnte. Es war das aber das Frühjahr 1927, da erreichte ihn ein Pogrom in der Stadt Klausenburg. Dabei verlor er sein Reisegeld, und das war ihm eine große Trauer, denn er war müde und eine Schlafsehnsucht war in ihm. Er begann zu sammeln, von reichen Manns Türe zu reichen Manns Tür. Doch war er langsamer auf den Beinen, und die Judenwelt um ein Vielfaches ärmer geworden in dieser letzten Zeit. So brauchte er an die elf Jahre, ehe er noch einmal sich aufmachen durfte zur Reise. Er tat das in großem Fiebern, denn ihm war, er habe keine Zeit zu verlieren, wollte er noch mit lebenden Augen das Land Palästina sehen. Er kam zu Fuß nach Triest. Von dort fuhr er zu Schiff nach Port Said. Die Eisenbahnfahrkarte hinüber nach der leuchtenden Stadt Jerusalem hatte er schon im voraus gekauft, gegen bares Geld.
Ja, da saß er endlich im Zuge! Zehn Stunden, acht Stunden, sechs Stunden noch – dann war man in Kanaan! Kam da noch einer, der sagte: Halt? Kam da einer, der sagte: Dein Geld her, du Judenhund? Blitzte da noch ein Bajonett? Nein, nein, nein! Man hatte schon enger gesiedelt auf dieser Erde als in dem Winkel des ein wenig engen Waggons, und nur aus einer lebenslangen Gewöhnung hielt man die zarten, knochigen Knie zusammengepreßt und war beflissen, nicht ein Zollbreit mehr für sich in Anspruch zu nehmen als unerläßlich war. Man saß da, ein wenig mager vielleicht, daß einer erschrecken mochte, wenn er unversehens herantrat. Man stellte sich an, als säße man da im Schlafe. Aber das Herz! Das Herz pochte wild. Das Herz flog durch das Dämmerlicht dem ratternden Zug voraus, und hätte einer etwa noch kommen wollen und Halt gebieten, ehe der Reisende Reb Mojsche Wasservogel von Unbekannt hinsänke auf seine Knie, auf Kanaans Erde – der hätte nunmehr schon von großer Schnelligkeit sein müssen, schneller als nur ein Mensch, und beinah so schnell wie der Flügel des schwarzen Engels, der das große Vergessen trägt.
Auf den Knien des schlaflosen Schläfers rastete seine Habe, ein Buch und ein Bündelchen. Es war das Buch Sohar, was da bedeutet: das Leuchtende. In dem Bündelchen war ein Hemd. Damit war einer nicht schlecht ausgerüstet fürs Leben.
BORSCHT oder Das Blut der Väter
Es fehlte nicht viel – und ein Mann mit Namen Borscht, ein mit Weib und Tochter reisender, finster blickender Schwarzbart, hätte jenen Blassen gekannt von altersher. Anläßlich der an jenem Augusttag des Jahres 1894 stattfindenden Tagung der Fliegenden Militärischen Kommission in der Stadt Semienka lag zwischen ihm und dem M. Wasservogel nicht mehr als eine einzige Mauer. Auf ihrer einen Seite war der gemeinsame Betraum der Talmud-Thora-Schule, in dem man den eben über die Doppelte Wahrheit des Rabbinen Isaak Albalag Meditierenden einfing, und auf ihrer andern Seite war der Lagerkeller des Heringhändlers Leib Fischel. Dort zog man den Commerzianten Meier Borscht hinter einer Fischtonne vor, wo verborgen er sich seinen patriotischen Pflichten hatte entziehen wollen. Der Commerziant Borscht war damals zwölf Jahre alt. Da er einen Schnurrbartanflug auf seiner Lippe trug, schätzte ihn der Fliegende Militär-Kommissar auf achtzehneinhalb und verpflichtet zum Waffendienst. Der Commerziant verkaufte sein Warenlager, bestehend aus einem Viertelpfund Zigarettenstummeltabaks, zu einem Schleuderpreis an den Krämer Tulpenthal. Bei dieser Gelegenheit beschlagnahmte er ein auf dessen Pulte liegendes Paket der teuren Schabbes-Wachskerzen. Die nahm ihm die alte Schanofski ab, die Frau des Mühlenbesitzers, und zwar für das genau Fünfunddreißigfache ihres Wertes – als er durchfließen ließ, er kenne den Versteckort des Schanofskischen Sohnes, der seit der Ankunft jener Kommission in einer leeren väterlichen Mehlkammer saß. Der Erlös erhöhte sich nach Einkassierung einiger außenstehender, an gleichaltrige Persönlichkeiten gegen Faustpfand gewährter Darlehen auf sechzehn Rubel und sechsundfünfzig Kopeken. Hievon erhielt dreißig Kopeken der ihn unter ständigen Todesdrohungen für den Fall eines Fluchtversuchs auf diesen Geschäftswegen begleitende Herr Gendarm. Fünf Rubel hatte der Herr Fliegende Militär-Kommissar selbst zu bekommen – und das obwohl er außerdem noch die Vorlage eines Dokumentes verlangte, das die behauptete Minderjährigkeit des Commerzianten bewiese. Weshalb weitere volle sechs Rubel und fünfzig zu investieren waren in einer Transaktion mit Schlojme dem Schreiber. Dafür sah aber auch der von ihm gelieferte kaiserlich russische Reisepaß so gut wie echt aus, und der darin beschriebene Commerziant M. Borscht hatte vorteilhafterweise eben erst das zarte Alter von acht Jahren erreicht.
Blieb von dem liquiden Borschtschen Kapital ein Rest von vier Rubeln und vierundsiebzig Kopeken. Sie wendete der Commerziant an den Ankauf koscherer Lebensmittel sowie eines Handkarrens, um sie zu transportieren. Damit fuhr er den hundertundachtzig Glaubensfrommen nach, die fortgeschleppt worden waren zum Militär. Er verkaufte seine Waren mit etwas über vierhundert Prozent Gewinn – von denen er allerdings an den Herrn Feldwebel der Kompanie die Hälfte hätte abgeben sollen (und tatsächlich genaue fünf Prozent abgab). Der Militärpope kam hinter diesen rituellen Versorgungsdienst und donnerwetterte dagegen nach Gojim-Art. Der Commerziant besänftigte ihn durch das Versprechen, die Taufe zu nehmen. Den Taufunterricht des Galachs verbog er nach zwei Stunden in einen Kursus im Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Taufhandlung selbst wollte er, befallen von einer besondern christlichen Frömmigkeit, an keinem andern Tag als an dem noch beträchtlich entfernten Weihnachtsfeste vollzogen sehen. Drei Wochen vor diesem, als der noch ungetaufte Commerziant Borscht in den Lese-, Schreib- und Rechenkünsten schon wesentlich sattelfester war als sein Lehrer, wurde der Pope zu einem andern Regiment versetzt.
Dieser zwölfjährige Commerziant Meier Borscht aus Semienka in Russisch-Polen war – ohne daß er darum wußte (und hätte er darum gewußt, so wäre das für ihn nicht weiter von Bedeutung gewesen) – der Großsohn des Urgroßsohns jenes Meier Arboza oder Harboza, der mit dem sogenannten Falschen Großinquisitor zog. Das war nach der Austreibung der Juden aus Spanien. Etwa hunderttausend von ihnen erbaten von Juan dem Zweiten von Portugal Recht auf Durchzug. Der Portugiese gewährte es für acht bis hundert Gold-Cruzados per Kopf. Er verhinderte die Durchwanderer durch planvolle Verzögerung der Schiffsbeistellung an rechtzeitiger Abfahrt. Die hiedurch sich Verspätenden erklärte er als leibeigen und verschenkte oder verkaufte sie. Die Kinder wurden zwecks christlicher Erziehung nach der jüngst entdeckten Verbrecherinsel Sankt Thomas verschickt, wo sie sämtlich krepierten – soweit sie es nicht früher schon vorgezogen hatten, samt ihren Müttern ins Meer zu springen zu den Haien. Von den hunderttausend Juden blieben nach dieser Transaktion mit der portugiesischen Krone dreitausendachthundert am Leben. Mit unbekannten Mitteln gelang es diesen, doch noch in See zu stechen. Fünf Wochen später, am Ostertag 1498, traf zu Lissabon ein päpstlicher Legat und spezieller Großinquisitor ein. Die christliche Glaubenslauheit, wie sie sich in dem Echappierenlassen jener Dreitausendachthundert offenbarte, wurde von ihm zum Gegenstand einer scharfen und kurzen Untersuchung gemacht. Tags darauf brannten auf dreiundvierzig Scheiterhaufen dreiundvierzig Mönche und Pfaffen von Lissabon, obgleich sie ihren besondren Eifer beim zwangsweisen Judentaufen und der herzerfrischend exemplarischen Behandlung der Verstockten unter Beibringung vieler Einzelheiten beteuerten. Tags darauf, indes noch ringsum Heulen und Zähneklappern war, zog der Gehilfe jenes päpstlichen Inquisitionslegaten, ein finsterblickender, schwarzbärtiger Mann, die irdischen Güter der vom Leben zum Tode Beförderten ein. Und tags darauf war er samt dem Einkassierten und seinem Herrn mit einem Schlage verschwunden. Doch währte es noch beinah eine Woche, ehe der in Briefen avisierte päpstliche Speziallegat wirklich in Lissabon eintraf, mit großem Gefolge, und man so sah, daß der Pfaffenverbrenner nicht der echte gewesen war. Des falschen Inquisitors Name blieb unbekannt. Sein die Vermögen der Gerichteten einsammelnder Gehilfe hieß Meier Arboza oder Harboza.
Es zeugte aber dieser Meier Harboza aus der Kraft seiner Lenden acht Söhne, von denen in dem Großen Elend, das über die vertriebenen Juden kam, zwei Hungers starben an der Küste von Algier. Einen verschleppten die Berber, und er wurde nicht mehr gesehen. Einer wurde erschlagen auf einer Straße in Deutschland. Zwei, denen man kein Quartier gab, erfroren auf einem Alpenpaß. Einer, der der älteste und der mutigste war, kam bis nach Bagdad und starb dort an einer Krankheit, genannt: die Pest. Einen, den jüngsten, der noch zu zarten Alters war, zu wissen, wie ihm geschah, lockte ein Mönch an das Taufbecken mit einer hingehaltenen Rinde Brots. Der zweitjüngste aber, der all das überlebte und der den Namen Jona ben Meier trug, landete im Jahr 1527 in der Stadt Saloniki.
Dort war eben die Nachricht unter die Juden gefallen, es sei einer aufgetaucht, Reubeni mit Namen. Sein Bruder war König des verloren geglaubten Stamms Ruben und hatte irgendwo in der Wüste sein Königreich! Und war willens, mit Papstes und Spanienkönigs Waffenbrüderschaft zum nächsten Jahr das Land Palästina aus der Türkennot zu befreien! Ob dieser messianischen Nachricht bemächtigte sich eine große Erregung der von Gott geschlagenen Judenheit; und war die Judenheit der Stadt Saloniki mit allen anderen entschlossen, ohne viel Aufschub in jene Wüste und in die Schlacht zu ziehen. Darüber herrschte eine messianische Aufbruchsfreude, eben als Jona ben Meier vom Schiffe stieg. Da sah dieser Jona ben Meier (ein finsterer Kaftanmann mit einem Schwarzbart) seine Gelegenheit, kühlende und schattenspendende Wüstenhüte herzustellen nach seiner eigenen Erfindung und Phantasie. Die verkaufte er in großer Zahl den Juden von Saloniki für ihren Wüstenzug. Und als man daraufkam, daß sie nichts taugten und daß man übrigens ihrer nicht mehr bedurfte, da jener Reubeni schon als Schwindler entlarvt und in einem spanischen Gefängnis verkommen war – da war die Trauer über den Schwindel des Reubeni so viel größer als der Ingrimm über den Schwindel des Meier, daß man diesen letzteren laufen ließ.
Es zeugte aber dieser Jona ben Meier aus der Kraft seiner Lenden den Josua ben Jona, genannt Jossele Jonassohn der Buchhändler. Der zog von Gemeinde zu Gemeinde, aufrufend zur frommen Einkehr und Keuschheit der Sitten – und nach gehaltener Predigt versuchte er jedermann ein Exemplar anzudrehen des damals neu erschienenen frommen Werkes Schulchan Aruch, das heißt: der gedeckte Tisch. Er ward erschlagen im Jahre 1574 in Deutschland. Sein Sohn Schloime der Buchhändler ward erst erschlagen im Jahre 1612, in Lodcz im Land Polen, wo er sich niedergelassen und gezeugt hatte den Meier Salomonsohn, der bekannt ward unter dem Namen: der reiche Reb Meier Lodcz. Es war das derselbe, der die Uniformen und Sättel lieferte für den ukrainischen Hetman Chmelnicky, als der im Jahre 1648 gegen die Polen zog. Ferner Pferde sowie zwanzig Kanonen für den Polenkönig Jan Kasimir, als der den Chmelnicky aufs Haupt schlug. Ferner Schlachtvieh, Mehl und wieder Pferde und Kanonen sowie Darlehen baren Gelds für den Karl Gustav von Schweden, als der in Polen einbrach, sowie für den Polen, als der den Schweden wieder aus seinem Lande warf. Darüber zeugte der reiche Reb Meier Lodcz – ein finsterblickender Kaftanmann mit einem Schwarzbart – fünf Kinder. Und als ihm die erste Frau starb, zeugte er neun mit der zweiten. Und als ihm die starb (da war er achtundsiebzig Jahre alt), freite er eine dritte, die noch nicht zwanzig war, und zeugte mit ihr noch drei.
Von diesen siebzehn Kindern des reichen Reb Meier Lodcz starben drei Hungers, solang er noch lebte – die Chmelnicky-Kosaken hatten ihm nur die Augen ausgestochen anläßlich des Tulczyner Pogroms. Ein anderes Kind des reichen Reb Meier Lodcz kam durch die Leute des Chmelnicky zu Tode anläßlich des Pogroms zu Homel. Und seine Lieblingstochter Lea anläßlich des Pogroms zu Nemirow. Einer wurde gehängt. Zwei wurden erschlagen von den Leuten des Polenkönigs Jan Kasimir, als der gegen den Hetman Chmelnicky zog. Einer fiel für den Schweden Karl Gustav in offener Schlacht. Und kamen in diesem Hin und Wider auch siebenhunderttausend Juden unter Galgen, Kosakensäbel, Muskete und anderer militärischer Vorrichtung zu ihrem Tode – von den siebzehn Kindern des reichen Reb Meier Lodcz lebten immer noch acht, als alles vorüber war. Von den achten starben zwei Hungers – aber da war der reiche Reb Meier selbst schon gestorben, als Bettler in der Stadt Lodcz. Zwei starben an einer Krankheit, genannt: die Cholera. Einer schnitt sich die Kehle durch. Einer nahm die Taufe und wurde ein katholischer Galach. Einer ersäufte sich in einem Fluß.
Blieb ein einziger von den Siebzehn, ein finsterblickender, schwarzbärtiger Mann. Der floh in die Wälder, der hungerte, der fraß Erde und Gras, der schlich sich an die Dörfer der Bauern und riß ihr Vieh wie ein wildes Tier und fiel ihre Hirten an und erschlug zwei Soldaten um einen Brotlaib und ward verscheucht und kam wieder zur Nachtzeit und heulte im kahlen Winterwald wie ein hungriger Wolf. Es ward aber dieser Jacob Meiersohn, genannt Jeinkef Dieb, erst gefangen im 1680er Jahr von einer Kompanie Soldaten, nach einer Treibjagd von drei Wochen, und mit abgehackten Händen verbrannt. Er heulte, so wie ein Wolf heult, auf seinem Holzstoß acht Stunden lang, indes schon der Gestank seines brennenden Fleisches und Schwarzbarts den ob solcher jüdischen Hartnäckigkeit skandalisierten Marktplatzanwohnern in die Fenster und Zimmer schlug.
Er ließ einen Sohn zurück, Jossel das Kind. Der ließ einen Sohn zurück, der den Namen Meier Josselsohn der Buchhändler führte – da schrieb man schon tausendsiebenhundertvierundfünfzig; er hatte diesen Namen angenommen, ob er gleich von seinen zwei Ahnen, die Buchhändler geheißen hatten, nichts wußte. Das Geschäft des Meier Josselsohn Buchhändler war, daß er umherzog und mit gerichtsordnungsmäßigen Unschulds- und Abwesenheitstabellen hausierte – als da waren ein von ihm selbst in einem hochtrabenden Amtsstil aufgesetztes und in Druck vervielfältigtes Formular, in das jeder Jude Tag und Nacht zu jeder Stunde eintragen und von Zeugen sich bestätigen lassen sollte, was er getan und wo er sich aufhielt. Und machte man einem den Prozeß und wurde er wegen Ritualmordes angeklagt, so war solch ein Dokument – das war des Buchhändlers Einfall – ein starkes Verteidigungsmittel und ein mustergültiges Alibi.
Es verkaufte dieser Meier Buchhändler siebzehntausend dieser Tabellen zu hohem Preis, bevor man ihn selber fing. Von seinem Prozesse kaufte er sich los durch Opferung seines Vermögens. Und gewann es aufs neue, indem er im Jahre 1771 als Prediger durch die Gemeinden zog – predigend die damals neue Lehre der Lebensfreude des Baal Schem Tow. (Und hatte er gepredigt, so drehte er seinen ergriffenen Hörern einen Posten im Preis zurückgesetzter chassidischer Schriften an.) Er vermehrte dieses neu gewonnene Geld im Jahre darauf, 1772 – predigend durch die Gemeinden zu flammendem Protest gegen die chassidische Lehre. (Und seinen erschreckten Hörern drehte er zu ermäßigtem Preis ein Edikt an des Rabbi Elia Wilnaer, so mit viel scholastischer Weisheit den Baal Schem Tow und die Lebenslust vor die Hunde warf.) Und er vermehrte wieder dieses Vermehrte noch in diesem selben Jahr 1772, da der Sektierer Jakob Frank seine zwischen Jud und Christ zerriebenen, verhungerten, von Verfolgung und Elend ausgedörrten Jünger noch einmal um sich versammelte. Ihre fadenscheinigen Kaftans sollten sie schürzen und sich allesamt jeder mit einer jeden in der Lust des Fleisches ergehen, um den letzten Tag, den sie durch eine höchste Frömmigkeit nicht hatten heraufführen können, vielleicht doch noch auf sich herabzuzwingen durch eine tiefste sodomitische und gomorrhanische Sündigkeit! Worauf also der Meier Josselsohn Buchhändler eingriff und den halbverhungerten Zelebrierern Riechwasser verkaufte, Talmischmuck, einen unter der Hand zu reduziertem Preis erstandenen Posten gojischer Karnevalsmützen, sowie ein geheimes Mittel zur Verschärfung der Sinnenlust.
Dieser Reb Meier Josselsohn genannt Buchhändler, der über all seinen ingrimmigen und guten Geschäften ein finsterblickender, schwarzbärtiger Jude blieb, zeugte in hohem Alter – denn bis dahin hatte ihm die neue russische Judenheiratseinschränkung die Ehe versagt – einen Sohn, hieß Schlojme. Der erlebte, daß ihm unter vierunddreißigmaliger Kriegskontribution an die Russen, Preußen und den Kaiser Napoleon die väterliche Habe und alles andere verlorenging. Doch ward ihm die solch kleine Bedrängnis aufwiegende Freude, daß er von der Behörde einen abendländischen Namen bekam. Er konnte sich nicht wie die Reichen, die dem Kommissar dafür zwanzig Rubel zusteckten, nach einem wilden und stolzen Tier benennen, noch wie die Zehn-Rubel-Bezahler nach einer edelduftenden Pflanze. Aber es erwachte in ihm aus diesem besondern und wichtigen Anlaß die Tatkraft der Ahnen. Er ließ nicht zu, daß er von einer um ihr Trinkgeld geprellten Behörde für alle Zukunft eingetragen werde als Stinker samt Kind und Kindeskind, als Schlecker oder Kanalduft. Zu der Zeit aß er ein kärgliches Brot in einer kleinen Gemeinde als Minjen-Mann – einer so da bestellt ist, bei Bedarf zu komplettieren die Zehnzahl der Männer, ohne die es keinen Gottesdienst geben darf im Volk Israel. Das war ein Freitagmittag, als er sich ermannte und drohte, er werde am Abend nicht ins Bethaus gehen und es so der Judenschaft unterbinden, Schabbes zu machen. Schon zwei Stunden später war er imstande, vor dem Kommissar zu erscheinen mit einer gestopften Gans, zwei Laib Weißbrot und fünfundneunzig Kopeken. Er stritt an und feilschte mit der Behörde, und sie nannte ihn nach einer ehrlichen Speise, und da er keine höher stellte als eine Rote-Rübensuppe, die dortzulande bereitet wird, nannte er sich mit deren Namen – und die hieß Borscht.
Es hatte aber die Lebenskraft des Schlojme Borscht mit dieser im Reigen der Geschlechter unauslöschbaren Handlung sich aufgebraucht; ihm war festlich zu Mute aber sein Herz war schwach; er starb zwei Tage später. Er hinterließ einen Sohn, der hieß Mojsche Borscht. Der hinterließ einen Sohn, der hieß Leib Abraham Borscht und siedelte sich in der Stadt Semienka an. Und starb der Sohn dieses Leib Abraham auch vor der Zeit im Jahr 1848 an einer Gewalttat, so blieb doch ein Sohn dieses Sohnes – der hieß Meier Borscht, und da der sich auf seine eigenen Beine stellte als Commerziant und als koscherer Lebensmittelhändler hinter den Soldaten des Zaren zog, war er zwölf Jahre alt. Und von jenen vor ihm Lebendigen und vor ihm Gestorbenen war in seinem Wissen nicht der Hauch eines Hauches und nicht die Spur einer Spur.
So bereichert und doch verarmt, so schattenlos überschattet, so ohne Gewicht und doch mit der Bürde von tausend und tausend Jahren auf seinen Schultern, wuchs der Commerziant Borscht in sein Leben. Da man 1903 schrieb, war er ein Mann von voller Gültigkeit. Er wohnte in einer größern Stadt, die hieß Kowno, und wenn auch nicht in der freien Stadt selber, so doch auch nicht mehr eigentlich im Judenquartier. Den steifen schwarzen Judenhut trug er auf eine städtische und westliche Weise. Der Kaftan hatte sich ihm zu einer Art weitgeschnittenen schwarzen Rocks verkürzt. Verkürzt, gestutzt (wenn auch beileibe nicht etwa vollends dem Schermesser hingeopfert) waren Schläfenlocken und frühsprossender Schwarzbart. Und wenn etwas unbeschnitten und unverkennbar dem Elend der lichtlosen Judengassen zugehörig geblieben war, so war es die von keinem Sonnenstrahl zerstörbare Blässe seines sehr jungen und sehr finster entschlossenen Mannsgesichts.