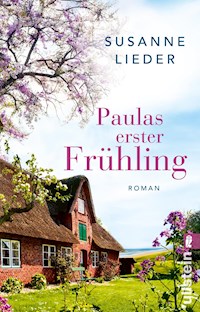Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich eigentlich? Und wer will ich sein? Mit Ende vierzig bricht Valerie aus ihrer Ehe aus. Sie weiß schon lange nicht mehr, wer sie eigentlich ist, was sie sich wünscht und wovon sie träumt. Hat sie überhaupt noch Träume? Bei einem Kurzurlaub begegnet sie Barbara, einer beeindruckenden, lebenslustigen Frau – für Valerie ein echtes Vorbild. Sie beginnt, ihr Leben ganz neu zu überdenken. Auf einer Pilgerreise durch das Schaumburger Land trifft sie die Erkenntnis wie ein Schlag: sie selbst ist der Schlüssel zu ihrer Zufriedenheit und ihrem Glück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Wer bin ich eigentlich? Und wer will ich sein?
Mit Ende vierzig bricht Valerie aus ihrer Ehe aus. Sie weiß schon lange nicht mehr, wer sie eigentlich ist, was sie sich wünscht und wovon sie träumt. Hat sie überhaupt noch Träume? Bei einem Kurzurlaub begegnet sie Barbara, einer beeindruckenden, lebenslustigen Frau – für Valerie ein echtes Vorbild. Sie beginnt, ihr Leben ganz neu zu überdenken.
Auf einer Pilgerreise durch das Schaumburger Land trifft sie die Erkenntnis wie ein Schlag: sie selbst ist der Schlüssel zu ihrer Zufriedenheit und ihrem Glück.
Susanne Lieder
An einem dieser Tage
Roman
Edel Elements
Edel ElementsEin Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Susanne Lieder
Lektorat: Rabea Güttler
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-129-4
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
I.
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Kapitel 3.
Kapitel 4.
Kapitel 5.
Kapitel 6.
Kapitel 7.
II.
Kapitel 8.
Kapitel 9.
Kapitel 10.
Kapitel 11.
III.
Kapitel 12.
Kapitel 13.
Kapitel 14.
Kapitel 15.
IV.
Kapitel 16.
Kapitel 17.
Kapitel 18.
Danke
I.
Wer nicht weiß,in welchen Hafen er will,für den ist kein Wind der richtige.– Seneca –
1.
Stift Fischbeck im Mai 2015
Als wir angekommen waren, hatte es wie aus Eimern geschüttet. Nass bis auf die Haut, aber glücklich hatten wir vor der Tür gestanden.
An diesem Morgen ging die Sonne gerade verheißungsvoll und leuchtend rot auf, als ich nach unten in den Kräutergarten ging. Eine ganze Weile blieb ich auf dem Kiesweg stehen und schaute in den strahlend blauen Himmel. Keine einzige Wolke war zu sehen, es würde ein herrlicher Frühlingstag werden.
Langsam schlenderte ich weiter, vorbei an den Fünffingersträuchern, die bereits blühten.
Es musste wunderbar sein, hier zu leben. Vorausgesetzt, man eignete sich für ein Leben als Stiftsdame. Und ich war für so ein Leben vermutlich nicht geschaffen. Auf Dauer würde ich mich eingeengt fühlen.
Der Geruch des Kräutergartens vermischte sich mit dem von frischem Kaffee. Zeit fürs Frühstück. Hungrig war ich nicht, aber ich freute mich auf einen Kaffee.
Ob Lisa auch schon auf war?
Wir kannten uns erst wenige Tage, hatten uns aber bereits unser halbes Leben erzählt. Für mich war Lisa, diese warmherzige, geduldige und so lebendige Frau, inzwischen zu einer Freundin geworden.
Ich ging zum Rosmarinstrauch und kniete mich hin. Wie wunderbar er duftete! Schwester Margarethe hatte mir erzählt, dass sein Geruch sehr wirksam bei leichtem Kopfweh sei. Man musste eine der Nadeln abzupfen und zwischen den Fingern zerreiben.
Ich stand wieder auf, hob den Kopf und breitete die Arme aus. Ich war endlich angekommen! Und damit meinte ich nicht meinen derzeitigen Aufenthaltsort, den ich erreicht hatte, nachdem ich ein Stück des Pilgerwegs von Loccum bis Fischbeck gegangen war, nein, ich war bei mir selbst angekommen.
Ich hatte auf diesem Weg, meiner inneren Einkehr, eine Menge über mich erfahren und gelernt.
Das letzte Jahr war ein ganz besonderes gewesen. Was zuerst wie ein Haufen Scherben ausgesehen hatte, unmöglich wieder zusammenzusetzen, hatte sich zu einem der wichtigsten Jahre meines Lebens entwickelt. Stück für Stück hatte ich die einzelnen Puzzleteile meines Lebens wieder neu zusammensetzen können, sodass ich jetzt an einem Punkt war, an dem ich die Geschehnisse von einer ganz anderen Seite betrachten konnte. Und ich sah, dass nur noch ein Puzzleteil fehlte, das noch eingesetzt werden musste: Christian.
Mehr als zwanzig Jahre waren Christian und ich glücklich gewesen, hatten eine harmonische, liebevolle Ehe geführt. Letzten Endes war ich es gewesen, die all dem ein Ende gesetzt hatte: Ich war aus meiner Ehe ausgebrochen, weil ich nicht mehr gewusst hatte, wer ich war.
Irgendwo klopfte jemand an eine Fensterscheibe. Ich schaute mich um und entdeckte Lisa, die, ein weißes Frotteetuch auf dem Kopf, oben am Fenster unseres gemeinsamen Zimmers stand und winkte. Offenbar war sie gerade erst aufgestanden.
Sie hatte mir erzählt, sie habe einen ungewöhnlich tiefen Schlaf, man könne sie wegtragen und an einen anderen Ort bringen, ohne dass sie davon aufwachen würde.
Davon hatte ich mich bereits überzeugen können. Es hatte eine Nacht gegeben, in der ein Gewitter mit einem Hagelsturm über uns hinweggefegt war. Lisa hatte mich am nächsten Morgen erstaunt gefragt, ob es in der Nacht etwa geregnet hätte – der Rasen sei ja ganz nass.
Sie erinnerte mich dabei an Christian. Mir kann man im Schlaf die Haare schneiden, hatte er gemeint. Ich würde mich am nächsten Morgen nur über die neue Frisur wundern.
Ich machte kehrt und ging langsam weiter. Diesen Moment würde ich festhalten, einfrieren, so wie ich Dutzende in den vergangenen Monaten eingefroren hatte. Momente, die voller Glück und tiefer Zufriedenheit gewesen waren. Momente, in denen ich verblüffende Erkenntnisse über mich selbst gewonnen hatte. Und dann schließlich dieser ganz besondere Augenblick, in dem ich mich beinahe erleuchtet gefühlt hatte.
Schwester Marie eilte an mir vorbei, den langen Rock gerafft, die Wangen gerötet. „Guten Morgen, Valerie. Schon wieder so früh auf?“
„Ich hab’s nicht länger im Zimmer ausgehalten. Es ist ein so schöner Tag.“
„Das ist wahr, Valerie, das ist wahr. Ich muss leider weiter. Schwester Helene braucht meine Hilfe. Sie und der Ofen werden wohl keine Freunde mehr werden.“
Ich musste lachen und folgte ihr, wenn auch deutlich langsamer. Lange Zeit hatte ich mich nicht spüren können, mich leer und wie tot gefühlt, so als hätten die letzten Jahre alles Leben aus mir herausgepresst und eine leere Hülle zurückgelassen. Endlich lebte ich wieder.
Die Äbtissin kam den Weg entlang, den Kopf gebeugt, anscheinend in Gedanken versunken. Ich mochte sie, sie war eine offene, freundliche Frau mit einer samtweichen, dunklen Stimme.
Vielleicht hatte sie meine Schritte gehört, denn sie hob den Kopf und lächelte mich an. Sie hatte wasserblaue Augen mit unzähligen Lachfältchen ringsherum. Bei unserer ersten Begegnung war mir durch den Kopf gegangen, dass ich mir eine Äbtissin immer ganz anders vorgestellt hatte. „Ich sehe, auch Sie genießen den frühen Morgen.“
„O ja, es ist herrlich hier um diese Zeit. Ich werde mich an diesem Garten wohl nie sattsehen. Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass ich ein Kloster besuchen würde …“ Ich machte eine ausladende Handbewegung. „Es ist ein so schöner Ort voller Magie. Und voller Poesie.“
„Genau genommen sind wir ein Stift“, verbesserte sie mich.
„Ich weiß. Entschuldigung.“
„Schon gut.“ Die Äbtissin zeigte auf einen Ginkgobaum, der rechts stand. „Er soll über zweihundert Jahre alt sein. Eine Stiftsdame, die leidenschaftliche Gärtnerin war, soll ihn gepflanzt haben. Schwester Margarethe sagte mir, wie sehr Sie den Kräutergarten lieben. Sie könnten sich auch einen zulegen“, schlug sie vor. „Schwester Margarethe gibt Ihnen sicher gern ein paar nützliche Tipps.“
Ich unterdrückte ein Seufzen. „Ich werde darüber nachdenken.“
Ein Kräutergarten, o ja, wie gerne.
Doch dazu müsste ich erst einmal wieder einen Garten haben, ein Haus.
Und all das hatte ich vor einem Jahr aufgegeben …
2.
Hamburg, im April 2014, ein Jahr zuvor
Christian stand mit gerunzelter Stirn vor mir.
Ich hatte befürchtet, er würde wütend sein, aber er sah nur fassungslos aus. „Was soll das werden, Valerie?“
Ich wich seinem Blick aus, weil ich es nicht ertragen konnte, wie er mich ansah. „Ich packe.“
„Willst du verreisen?“
Fragte er das im Ernst? Wie oft hatte ich ihm gesagt, ihm an den Kopf geworfen, dass ich nicht mehr konnte, leer war, müde. Hatte er geglaubt, ich würde Spaß machen? Übertreiben?
„Ich ziehe aus, Christian.“
„Du tust bitte was?“
„Ich ziehe aus.“
„Das ist lächerlich, Valerie! Wir haben ein paar Differenzen, von mir aus auch Probleme, wenn du so willst. Aber das ist doch kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen.“
Ich schluckte und stellte den Karton mit der Bettwäsche auf dem Boden ab. Ich vermied noch immer, ihn anzusehen. Ein Blick in seine wundervollen grünen Augen würde es mir schwermachen, zu gehen. Diese Augen hatte ich immer so geliebt. „Ich werfe nicht die Flinte ins Korn.“
„Doch, genau das tust du. Konnten wir nicht immer über alles reden?“
Ich schwieg. Mein Magen zog sich zusammen. Machte ich einen Fehler? Übertrieb ich vielleicht doch nur maßlos? Sollte ich mich einfach mehr zusammenreißen und mich wie eine erwachsene Frau benehmen, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden stand? Das Dumme war nur: Genau das war schon lange nicht mehr der Fall. Und zusammengerissen hatte ich mich in den letzten Jahren mehr als genug.
„Meine Güte, Valerie, wir sind fast vierundzwanzig Jahre verheiratet, da wirft man nicht einfach alles weg.“
Jetzt schaute ich Christian doch an. Er hatte recht, man warf vierundzwanzig Jahre nicht einfach weg. Aber das tat ich auch gar nicht. Es hatte unzählige Gespräche, Diskussionen, Tränen, Wutausbrüche und Versöhnungsversuche gegeben. Wir hatten ganze Nächte hindurch geredet, uns manchmal aneinandergeklammert, weil wir nicht begreifen konnten, dass wir uns verloren hatten. Für Christian mochte es sich nicht so anfühlen, für mich schon. Für ihn war ein Streit ein Streit, eine Meinungsverschiedenheit, etwas, das man aus dem Weg räumen konnte. Für mich wurde es immer mehr. Ich hatte diese Dinge noch nie besonders gut trennen können, sachlich und objektiv streiten konnte ich einfach nicht. Wenn wir uns stritten, fühlte ich mich immer gleich als Mensch angegriffen.
Und nun, nach all den Jahren, hatte ich keine Kraft mehr. Ich war nicht nur müde und verzweifelt, ich war desillusioniert.
Da half es auch nicht, dass Christian theatralisch die Hände rang. „Wo willst du überhaupt wohnen?“
„Bei Marlen.“
„Du brauchst ein bisschen Zeit, das verstehe ich.“
Warum war er nur dauernd so verständnisvoll? Manchmal brachte mich dieses ständige „Ich verstehe dich ja, Valerie“ fast um den Verstand. Warum schrie er mich nie an, tobte, haute mit der Faust auf den Tisch? Wenn er ganz ehrlich wäre, müsste er zugeben, dass er mich doch längst nicht mehr verstand.
Aber wie wäre ich mit so einer Reaktion umgegangen? Hätte ich gesagt: „Schon gut, Christian. Ich versteh ja, dass du sauer bist“? Nein, ich wäre schon viel früher auf und davon gewesen, weil ich das noch viel weniger hätte ertragen können.
Christian hatte irgendwann zu mir gesagt, ich sei unberechenbar, er könne mich überhaupt nicht mehr einschätzen. Früher habe er geglaubt, mich in- und auswendig zu kennen, jetzt aber stünde er oft da und starre mich an, als wäre ich eine Fremde. Er wüsste nicht mehr, was in mir vorging, was ich empfand.
Wie denn auch? Ich wusste es ja selbst nicht mehr. Ich war zu einem Zuschauer meines eigenen Lebens geworden.
Ich lief aus dem Zimmer, das früher Jona gehört hatte, meinem höflichen, hilfsbereiten, aber leider auch sehr chaotischen Sohn. Das Wort Ordnung hatte er wahrlich nicht erfunden, manchmal hatte ich mir einen Weg bis zu seinem Kleiderschrank bahnen müssen, um seine frische Wäsche einzuräumen. Später hatte ich sie ihm einfach vor die Tür gelegt.
Wie sehr ich ihn vermisste! Ihn und sein einzigartiges Chaos, seine Unordnung, die für ihn immer eine ganz bestimmte Ordnung gehabt hatte.
Ich unterdrückte die Tränenflut, die sich anbahnte, und verschwand im Wohnzimmer, um den Karton mit meinen Orchideen zu holen. Dabei biss ich mir fest auf die Unterlippe.
Ich war ein impulsiver Mensch und neigte außerdem dazu, in solchen Augenblicken sehr ungerecht zu werden, aber ich würde jetzt nicht heulen und sagen, dass mir all das leidtue. Ehrlich gesagt war ich im Moment so aufgewühlt, dass sich mein Kopf doppelt so schwer anfühlte wie sonst. Wie sollte ich da einen klaren Gedanken fassen?
Christian verzog das Gesicht zu einem verkrampften Lächeln.
„Ist wohl besser, wenn du die Orchideen mitnimmst. Bei mir würden sie eingehen.“ Er schien wirklich zu glauben, dass ich nur eine Weile fortbleiben und dann zurückkehren würde.
Wie sehr hatte ich diesen Mann geliebt. Vielleicht tat ich das noch immer. Aber tief in mir drin war eine große Leere, die sich wie ein schwarzes Loch anfühlte. Und diese Leere hatte viele Jahre an mir genagt, mich nach und nach zerfressen. Nein, falsch. Es war gar keine Leere, es war Unmut. Und all die aufgestaute Wut und der Groll hatten mich von innen vergiftet. Die nachgiebige, sanftmütige Valerie hatte sich in eine mürrische, notorisch unzufriedene Frau verwandelt, der ihre eigenen Emotionen Angst machten.
„Ich werde nicht zurückkommen, Christian“, sagte ich leise, mit rauer und brüchiger Stimme.
Wahrscheinlich würde ich doch gleich heulen.
Christian hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden. Verlassen zu werden. Doch auch wenn mir das bewusst war, ich konnte nicht anders. Es ging nicht. Ich fühlte mich wie eine Marionette, deren Fäden man zog oder losließ.
„Du gehst wirklich“, sagte er mit tonloser Stimme.
Mein Magen zog sich zusammen. Ja, ich würde gehen. Lange hatte ich darüber nachgedacht, es vor mir hergeschoben und wieder vertagt. Es war die Angst vor meiner eigenen Courage gewesen, die mich bisher daran gehindert hatte, durch die Tür zu gehen.
Ich hievte den Karton mit den Pflanzen auf den mit der Bettwäsche. Für einen Augenblick war mir, als würde ich den größten Fehler meines Lebens machen. Christian und ich gehörten doch zusammen. Wir hatten miteinander alt werden, gemeinsam unter dem Birnbaum sitzen und unseren Enkelkindern beim Spielen zusehen wollen.
Heiße Tränen schossen mir in die Augen. Ich musste blinzeln und mich ein paarmal räuspern. „Wir haben so viel geredet, Christian“, sagte ich leise. „Immer und immer wieder geredet, unsere Probleme hin- und hergewälzt, sie zertreten und wieder zusammengesetzt. Ich kann einfach nicht mehr.“
Ein Wagen hupte vor dem Haus.
„Hast du ein Taxi bestellt?“, fragte er.
„Das wird Marlen sein. Sie holt mich ab.“ Ich nahm meine Jacken und Tücher von der Garderobe und warf sie auf den oberen Karton. Ein letzter Blick in die Küche, deren Tür offen stand. Ein flüchtiger Blick auf die Flurkommode, auf der Fotos unserer Kinder standen. Alexandra mit ihrem dunklen, glänzenden Haar und dem leicht spöttischen Lächeln, daneben die blonde Amelie, die ihrer großen Schwester so gar nicht ähnlich sah, und Jona, der einen Arm um sie gelegt hatte. Wie fröhlich sie aussahen, wie unschuldig. Und wie glücklich.
Ich erinnerte mich noch gut daran, wie Christian das Foto gemacht hatte. Es war ein Samstagnachmittag im Herbst gewesen, kurz nach Amelies achtzehntem Geburtstag.
Ich musste mehrmals hintereinander schlucken. Meine Kinder, meine Familie. Ich machte alles kaputt. Und doch konnte ich nicht anders.
Ich drehte mich um und ging.
„Als Erstes brauchst du ein Auto.“ Marlen stellte die letzte Kiste ins Gästezimmer, das ich vorübergehend beziehen würde.
„Und wovon soll ich das bezahlen?“
„Du suchst dir einen Job.“
„Die freien Kuratorenstellen liegen ja Gott sei Dank auf der Straße“, erwiderte ich trocken. Selbst mir fiel auf, wie verbittert es klang. Ich wusste gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal aus vollem Hals gelacht hatte. Wie lange war es her, dass ich zufrieden und glücklich gewesen war?
„Dann suchst du dir eben was anderes“, meinte meine Freundin schulterzuckend. Für Marlen war alles immer ganz einfach.
Ich hörte meinen Vater sagen: Du bist jung und hast zwei gesunde Hände. Und ich hörte mich antworten: Ich habe zwei gesunde Hände, stimmt, aber ich bin nicht mehr jung. Ich bin siebenundvierzig.
Aber war das alt? Nein, aber auch nicht mehr jung. Es war irgendwas dazwischen, und das machte es nicht besser.
Tatsache war, dass ich mich alt fühlte, uralt sogar.
Am frühen Abend saßen wir zusammen in Marlens kleiner Küche.
Ich hatte keinen Appetit. Es fühlte sich seltsam an, nicht zu Hause am Küchentisch zu sitzen, Christian gegenüber.
Als Alexandra vor fünf Jahren ausgezogen war, hatte ich die ersten Tage immer noch für sie mitgedeckt, aus lauter Gewohnheit. Die anderen hatten sich über mich lustig gemacht und mich liebevoll geneckt, ob wir vielleicht einen unsichtbaren Gast hätten.
Ob Christian an diesem Abend auch für mich Teller und Besteck hingestellt hatte? Aus Gewohnheit? War es das, was unser Zusammenleben ausgemacht hatte? Gewohnheit? War die Vorstellung, bis ans Ende unserer Tage verliebt zusammenzuleben, am Ende nur eine riesengroße Illusion und nichts weiter als eine Seifenblase gewesen?
„Du denkst an ihn, stimmt’s?“
„Blödsinn.“
„Natürlich denkst du an ihn. Ich seh’s dir an.“
Marlen hatte sich vor einigen Jahren von ihrem Mann getrennt, einen Schlussstrich unter ihre Ehe gezogen und sich neuen Dingen zugewendet. Ich hatte nie den Eindruck gehabt, als sei ihr das schwergefallen.
Ich war aber nicht wie sie.
Mein Handy piepste, ich hatte eine SMS von meiner Tochter bekommen. Amelie war vor wenigen Wochen nach Münster gezogen, um dort Musik zu studieren.
Und sie hat keine Ahnung, dass ich ausgezogen bin. Gott, wie soll ich ihr das bloß sagen?
- Alles gut bei euch, Mami?
Mit zittrigen Fingern tippte ich eine Antwort.
- Sicher. Und bei dir?
Als unsere Jüngste vom Hof gefahren war, hatte es sich angefühlt, als würde man mir den Boden unter den Füßen wegreißen. Bis dahin hatte ich mich gebraucht gefühlt.
Was sollte ich mit meinem Leben anfangen? Christian hatte seinen Beruf, seinen Traumjob, und ich, was hatte ich? Außer einer Menge Zeit? Zeit, mit der ich nicht mal etwas anzufangen wusste. Womöglich hatte ich sogar zu viel Zeit. Warum sonst musste ich ständig über mein Leben, meine Ehe, meine Unzulänglichkeiten nachdenken?
Eine Antwort darauf hatte ich nie gefunden. Meine Grübelei war eine Art Dauerschleife gewesen, ein Strudel, der mich hinabgezogen und festgehalten hatte.
Es war ja nicht so, als hätte ich nicht versucht, wieder ins Leben einzusteigen, ins Leben ohne Kinder. Aber als Kuratorin hatte mich niemand haben wollen. Ich hatte zu lange pausiert und den Anschluss verpasst.
Manchmal hatte ich morgens im Bett gelegen und mich gefragt, warum ich überhaupt aufstehen sollte. Zu nichts hatte ich noch Lust gehabt.
„Du hast es ihr noch nicht gesagt.“
Ich wich Marlens Blick aus. „Amelie? Nein. Ich muss darüber nachdenken, wie ich es anstelle.“ Ich schob meinen Teller beiseite. Eine angebissene Scheibe Brot lag darauf.
„Vielleicht hast du Glück und Christian ist schneller.“
„Vielen Dank auch, Marlen. Das war genau das, was ich heute noch gebraucht habe.“
„Tut mir leid.“ Sie legte die Hand auf meinen Arm. „Du kennst mich, ich denke manchmal nicht nach, bevor ich losquatsche.“
„Wie konnte es nur so weit mit uns kommen?“ Ich drehte gedankenversunken an meinem Ehering.
„Mit uns? Aber wir verstehen uns doch super.“
„Nicht mit uns, Marlen, ich meinte Christian und mich.“
„Ach so.“ Sie zuckte die Schultern. „Du bist uneins mit dir, Vali. Vielleicht weißt du doch, woran es liegt, und du willst es dir nur nicht eingestehen.“
„Blödsinn, ich hab keine Ahnung, was mit mir los ist. Manchmal stört mich die Fliege an der Wand.“
„Und Christian.“
Ich beschloss, es einfach zu überhören.
„Vielleicht ist da irgendetwas, über das ihr nie geredet habt“, überlegte sie.
„Nein.“
„Komm schon, Valerie, irgendwann wird mal was passiert sein, über das ihr nicht sofort gesprochen habt.“
„Nein, nicht dass ich wüsste.“
„Vielleicht hast du es verdrängt. Ihr wart immer bedingungslos ehrlich zueinander?“
Ich nickte matt.
„Da gab es nie klitzekleine Geheimnisse?“, hakte sie nach und bewies damit wieder mal, wie verdammt hartnäckig sie sein konnte.
Ich schüttelte den Kopf. Dann spürte ich, wie mir das Blut in die Wangen schoss. Doch, ein kleines Geheimnis gab es. Aber das war eigentlich völlig bedeutungslos. Bis jetzt hatte ich nicht mal mehr daran gedacht.
Vor Jahren hatte ich einen alten Schulfreund wiedergetroffen, ganz zufällig, im Supermarkt. Er hatte plötzlich vor mir gestanden. Valerie? Wow, du siehst immer noch klasse aus.
Und ich war rot wie ein Feuerlöscher geworden.
Markus hatte mit mir geflirtet, was das Zeug hält, und ich dumme Nuss hatte ihn vermutlich sogar noch ermutigt, indem ich alles in mich aufsaugte, was er säuselte. Hinterher hätte ich mich selbst ohrfeigen können.
Christian hatte ich nichts davon erzählt. Warum auch? Es war ja bedeutungslos. Wenig später hatte ich die Begegnung mit Markus schon wieder vergessen.
„Oha.“ Marlen warf mir einen vielsagenden Blick zu. „Ich sehe, da gibt es doch etwas.“
„Na schön, ich hab vor Jahren einen alten Schulkollegen wiedergetroffen, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten.“
„Hattet ihr was miteinander?“
„Natürlich nicht!“
„Damals in der Schule meine ich.“
„Ach so. Nein, auch das nicht. Ich mochte ihn, er war einer der Netten, verstehst du? Keiner dieser Typen, die außer einer großen Klappe nichts vorzuweisen haben.“
Sie lächelte bedeutungsvoll. „Verstehe. Wusstest du, dass es zwei Kategorien Frauen gibt? Die eine steht auf solche
Männer …“
Ich unterbrach sie. „Solche Männer?“
„Na, so wie dein Schulkollege. Nett, sanft …“
„Sanft?“
Marlen redete unbeirrt weiter. „Die zweite Kategorie Frau mag Macho-Männer.“
„Willst du wirklich damit sagen, dass es nur zwei Sorten Männer gibt? Weicheier und Machos?“
„Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mir Machos lieber sind als Weicheier.“
Ich war sprachlos. Hatte ich bis dahin geglaubt, sie gut zu kennen, musste ich das nun revidieren.
„Nun sieh mich nicht so an, Vali. Ich mag halt gern echte Kerle.“
„Echte Kerle, aha. Und was ist Christian deiner Meinung nach?“ Wollte ich das wirklich hören? „Nein, lass nur. Ich ahne es.“
„Lass uns nicht streiten. Schon gar nicht wegen Männern. Was war denn nun mit deinem Schulkollegen?“
„Ich hab ihn erst gar nicht erkannt. Sein Haar war schon fast grau. Wir haben uns unterhalten, mehr nicht.“
„Er hat dir Komplimente gemacht“, konstatierte Marlen.
„Ein bisschen schon.“
„Und du hast es genossen. Und Christian weiß nichts davon.“
„Mal ehrlich, Marlen, warum sollte ich ihm erzählen, dass ich einen Schulfreund wiedergetroffen …“
„Eben war er noch ein Schulkollege.“
„… und wir uns unterhalten haben? Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Und ein Geheimnis schon gar nicht. Christian trifft bestimmt auch öfter mal eine alte Schulfreundin.“
Sie schwieg und schien darüber nachzudenken.
Ich hatte das Bedürfnis, es ihr genauer zu erklären. „Ich war nie verliebt in Markus.“
„Er in dich?“
„Schon möglich. Ach was, nein, ich glaube nicht.“
Marlen klopfte auf den Tisch, und ich fuhr zusammen. „Alles, was du jetzt brauchst, ist ein bisschen Ablenkung.“ Sie schaute auf ihre Uhr. „Ich muss los. Kommst du?“
„Wohin?“, fragte ich müde.
„Heute ist Mittwoch, Valerie.“
Und Mittwochabend war Bauchtanz. Das hatte ich völlig vergessen.
Marlen hatte vor wenigen Monaten ein kleines Tanzstudio gepachtet und bot dort Bauchtanz- und Zumba-Kurse an.
Um ihr einen Gefallen zu tun, hatte ich mich zu einem Kurs angemeldet, und es hatte mir wider Erwarten sogar Spaß gemacht. Die orientalische Musik mit den verschiedenen Trommeln und fremdartigen Klängen war wundervoll, genau wie die sinnlichen Bewegungen, bei denen man das Becken kreisen ließ und die Hüften auf und ab schwang.
Ich hatte mir ein nicht zu teures Kostüm in einem zarten Türkis bestellt, und als ich es vor dem Spiegel anprobiert hatte, war ich verblüfft gewesen, wie gut es mir stand. Die kleinen Speckpölsterchen, die mir immer Kummer bereitet hatten und in Wahrheit vermutlich niemandem außer mir selbst aufgefallen waren, hatten sich in dem hübschen, leicht durchsichtigen Kostüm richtig gut gemacht. Der BH, mit winzigen Pailletten und Steinchen besetzt, war ein wenig knapp gewesen, doch seltsamerweise hatte ich gerade das besonders reizvoll gefunden. Ich hatte etwas zu viel Busen für meinen Geschmack, doch in diesem Oberteil wirkte er zwar üppig, aber wohl platziert.
Christian hatte ich bewusst auf Distanz gehalten. Er hatte mich nicht mal im Kostüm sehen dürfen. Der Bauchtanz, das Kostüm, die Musik, all das gehörte mir, war ein Teil meines Lebens, der einmal wöchentlich stattfand und zu dem er keinen Zutritt hatte. Den Warnglocken, die da bereits geläutet hatten, hätte ich Beachtung schenken müssen, anstatt sie zu ignorieren.
„Ich glaube, ich bleibe heute zu Hause.“ Zu Hause. Ich schluckte.
„Nichts da, du musst unter Leute.“
„Ich möchte gern in Ruhe auspacken.“
Marlen verzog das Gesicht, schließlich seufzte sie ergeben. „Schön, ganz wie du meinst.“
Sie hatte kaum die Tür hinter sich zugezogen, da saß ich bereits auf dem Bett, den Laptop auf den Knien.
Auspacken konnte ich später, jetzt wollte ich ins Internet und mit Martin chatten.
Vor ein paar Wochen hatte es mit ihm angefangen.
Er war Freiberufler, irgendwas mit Computertechnik, genau hatte ich das nicht verstanden. Es war auch nicht wichtig.
Am dritten Tag hatte er ein Foto geschickt, und ich hatte den Atem angehalten. Ein gut aussehender Mann. Ein leicht verschmitztes Lächeln, dutzende Lachfalten um seine braunen Augen, dunkelbraunes, leicht welliges Haar, erstaunlich dicht für einen Mann Anfang fünfzig. Und er hatte einen sinnlichen Mund.
Immer wieder hatte ich das Bild angesehen und darüber nachgedacht, ob das Schmetterlinge in meinem Bauch waren. Wann war ich das letzte Mal so nervös, so aufgeregt gewesen? Schon, wenn ich nur den Laptop aufgeklappt hatte, hatte mein Herz wild gepocht und mein Magen hatte sich zusammengezogen, sobald auf dem Bildschirm „Martin ist online“ erschienen war.
Eigentlich war er gar nicht mein Typ, ich mochte blonde Männer. Davon abgesehen war ich auch nicht der Typ für Flirtversuche, schon gar nicht im Internet, wo sich Menschen tummelten, die ich nicht einschätzen konnte. So was hatte mir schon immer Angst gemacht. Aber es war so wunderbar anonym, so anders.
Martin hatte mir vom ersten Moment an zu verstehen gegeben, dass auch er nicht auf Anmachsprüche im Internet stand. Nie im Leben wäre er auf die Idee gekommen, sich eine Frau im Netz anzulachen. Aber bei mir hatte er eine Ausnahme gemacht. Ich sei nämlich was Besonderes.
Früher hatte ich geglaubt, dass ich immun gegen solche Sprüche war. Das schlechte Gewissen, die Scham hatten mich manchmal fast übermannt, doch ich hatte sie immer wieder abschütteln können. So, als wenn man ein durchgeschwitztes Shirt auszieht, weil es sich unangenehm auf der Haut anfühlt.
Christian hatte nebenan in seinem Arbeitszimmer gesessen, und ich hatte in Jonas altem Zimmer gehockt und mit einem anderen Mann gechattet.
Ich hätte es gleich wieder beenden und ihm schreiben sollen, dass ich verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern war. Aber ich hatte es nicht getan.
Plötzlich hatte ich mich wieder lebendig gefühlt, weiblich, begehrenswert.
3.
Wenige Tage nach meinem Auszug verabredete ich mich mit Martin. Zum ersten Mal würden wir uns vis-à-vis gegenübersitzen.
Er wohnte in Krefeld, hatte aber beruflich in Flensburg zu tun. Mir war es sehr recht, dass wir uns auf neutralem Boden treffen würden.
Während ich im Zug saß, dachte ich darüber nach, wie es mit Christian und mir weitergehen würde. Wie würden wir das Ende unserer Ehe bewältigen, wie damit umgehen? Könnten wir irgendwann Freunde sein?
Wie hatte ich das früher gehasst. Lass uns Freunde bleiben.
Wie absurd. Wie konnte man in Freundschaft verbunden bleiben, wenn man sich vorher geliebt und alles miteinander geteilt hatte? Das war absolut undenkbar. Und jetzt erwartete ich, dass Christian und ich – einst das Vorzeigepaar – Freunde blieben? Waren wir das überhaupt noch, Freunde? Konnte man das behaupten, wenn man sich gegenseitig so tief enttäuscht hatte?
Vielleicht sollten wir erst mal Gras über die Sache wachsen lassen und uns dann auf einen Kaffee zusammensetzen und alles Weitere besprechen.
Die Sache.
Alles Weitere.
Die Sache war das Scheitern unserer Ehe und alles Weitere die Konsequenz daraus. Wir würden unseren Haushalt trennen und versuchen, alles gerecht aufzuteilen. An Feiertagen und zu besonderen Anlässen würden wir mit unseren Kindern zusammensitzen und uns verzweifelt um eine zwanglos-fröhliche Stimmung bemühen. Vielleicht würde Christian kochen, die Kochmütze auf dem Kopf, die ich ihm vor Jahren geschenkt hatte, und wir würden Stadt-Land-Fluss spielen so wie früher. Wir hatten immer unglaublich viel Spaß gehabt, uns lustige Begriffe zugerufen und manchmal gebrüllt vor Lachen.
Das Herz tat mir weh, als ich mich daran erinnerte.
Zwei Stunden später saß ich an einem hübsch gedeckten Tisch in einem gemütlichen Café, meine Handtasche auf den Knien, darin mein Ehering. Gerade noch rechtzeitig hatte ich daran gedacht, ihn abzunehmen. Es hatte sich wie Verrat angefühlt, und mir war ganz seltsam zumute gewesen.
Mir gegenüber saß der Mann, der mir schlaflose Nächte, mächtiges Herzklopfen und Magenschmerzen bereitet hatte.
Martin mit dem dunkelbraunen, welligen Haar, den unzähligen Lachfältchen, den übermütig blitzenden Augen, den sinnlichen Lippen. Martin, der sich selbst als schlank und durchtrainiert bezeichnet und seine Größe mit knapp unter eins neunzig angegeben hatte.
Ich war viel zu früh dagewesen und konnte daher betont unauffällig Ausschau nach ihm halten.
Als er hereingekommen war, hatte ich ihn nicht erkannt. Der Mann, der mit einer roten Rose in der Hand – wie einfallsreich – an meinem Tisch stand, konnte nicht Martin sein. Doch dann hatte er gesagt: „Valerie. Du bist ja in echt noch viel hübscher.“ Er hatte meine Hand genommen und mich vom Stuhl hochziehen wollen. Wahrscheinlich hatte er vorgehabt, mich zu umarmen, womöglich sogar zu küssen.
Ich war so fassungslos gewesen, dass ich einfach sitzen geblieben war. Der Mann, der kaum größer war als ich, sollte Martin sein?
„Du siehst wirklich toll aus.“ Damit hatte er sich mir gegenüber auf den Stuhl fallen lassen.
Seitdem saßen wir uns gegenüber und musterten uns immer wieder. Er ganz unverhohlen und sichtlich angetan.
Das war also Martin.
Schlank? Durchtrainiert?
Der Mann vor mir hatte mindestens zwanzig Kilo zu viel auf den Rippen. Und ein Fitnessstudio hatte er seit Jahren nicht von innen gesehen. Sein angeblich dichtes, welliges Haar war schütter und mehr grau als dunkelbraun. Und war das Haarspray, das so eigenartig glitzerte?
Nicht mal sein Gesicht war mir wirklich vertraut, obwohl ich das Foto, das er mir geschickt hatte, so oft angesehen hatte, dass ich sicher gewesen war, ihn unter Hunderten sofort wiederzuerkennen. Ob er mir das Foto eines Freundes geschickt hatte?
Dennoch hätte ich vielleicht sogar über all das hinwegsehen können. Das waren Äußerlichkeiten. Aber dazu kam, dass sich sein Charme, sein Humor und seine Schlagfertigkeit, die er während unserer unzähligen Begegnungen im Chatroom immer wieder unter Beweis gestellt hatte, praktisch in Luft aufgelöst hatten. Sie waren nicht einmal ansatzweise spürbar.
Was war mit seiner Anziehungskraft, die mich so fasziniert hatte? Wo waren der Zauber, die Magie, all die Schmetterlinge?
Kerzengerade saß ich da und konnte nicht umhin, ihn erschüttert, ja fast schockiert, anzustarren.
Ich versuchte verzweifelt, Konversation zu machen – und wünschte mich an einen anderen Ort.
Mir fielen wieder all seine Nachrichten und Mails ein.
Hin und wieder hatte er mir kurze Gedichte geschickt, keine selbst geschriebenen, das war mir aber auch nicht wichtig gewesen. Atemlos hatte ich ihm zurückgeschrieben, manchmal war es mir sogar vorgekommen, als sei dieser Mann mein Seelenverwandter.
Nun saß er hier vor mir und konnte kaum einen vernünftigen Satz artikulieren.
Ich versuchte, es auf seine Nervosität zu schieben. Ja, natürlich, er war bestimmt schrecklich nervös und brachte deshalb keinen klaren Satz heraus. So was war nicht ungewöhnlich. Bestimmt würden sich gleich sein unwiderstehlicher Charme und sein spitzbübischer Humor entfalten, und wir würden zusammen lachen, uns verliebt ansehen und wünschen, die Zeit würde stehenbleiben.
Wir bestellten eine Flasche Weißwein, und Martin schenkte mir einen sehr eindeutigen Blick. Der bedeutete nichts anderes als: Von mir aus können wir uns gleich ein Hotelzimmer nehmen.
Ich schluckte und fragte mich zum hundertsten Male, wie ich so blöd hatte sein können. So naiv. Wie ein Backfisch hatte ich mich benommen, überzeugt davon, der Mann, der mir gerade mal ein Foto und ein paar Gedichte geschickt hatte, könnte derjenige sein, mit dem ich auf der Stelle durchbrennen würde.
Wir bemühten uns um eine zwanglose Unterhaltung. Es war erbärmlich. Noch vor wenigen Stunden hatten wir heiß miteinander geflirtet. Wenn auch nicht von Angesicht zu Angesicht.
War es das? Mussten wir uns erst aufeinander einstellen?
Oder waren die Erwartungen einfach zu hoch gewesen?
Ich trank drei Gläser Wein und fühlte mich ein wenig betrunken. Ich war drauf und dran, ihm die Wahrheit, meine ganze Enttäuschung ins Gesicht zu schleudern. Ich fühlte mich betrogen, verraten. Er hatte mir absichtlich ein fremdes Foto geschickt, weil er mich beeindrucken wollte. Er wusste, dass er kein George Clooney war, warum aber hatte er versucht, sich als einer auszugeben? Das war lächerlich. Er hätte doch wissen müssen, dass sein Schwindel früher oder später auffliegen würde.
Warum hatte er sich als Mann von Welt, als Charmeur, Gentleman und Liebhaber romantischer Gedichte ausgegeben, wenn er nicht mal im Ansatz weder das eine noch das andere war? Was hatte er sich davon versprochen?
Oder lag es womöglich an mir? Hatte ich diesen Mann in ihm sehen wollen?
Plötzlich kamen mir alle E-Mails von ihm läppisch vor, selbst die, die mich sprachlos gemacht hatten. Er hatte mich getäuscht, mit voller Absicht.
Und ich war blöd genug gewesen, darauf hereinzufallen. Selbst schuld.
Ich sollte nicht hier sein, nicht mit einem Mann in einem Café sitzen, in einer Stadt, die mir in diesem Augenblick fremd und kalt vorkam. Dabei mochte ich Flensburg.
„Erzähl mir von dir“, bat er mich und tätschelte meine eiskalte Hand. „Deine Hand ist ja ganz kalt. Komm, ich wärm sie dir.“