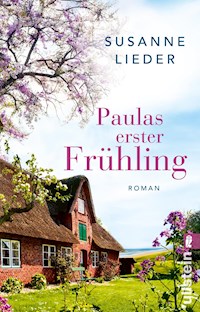9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie heilt mit der Kraft der Natur und wird eine Pionierin der Medizin.
Paris, 1834: Mélanie will Ärztin werden, doch als Frau wird ihr der Zugang zur Universität verwehrt. Heimlich schleicht sie sich trotzdem in den Vorlesungssaal. Als sie krank wird, scheint ihr kein Arzt helfen zu können, ihre letzte Hoffnung ist die Homöopathie. Durch Zufall fällt ihr die heilkundliche Schrift eines Samuel Hahnemann in die Hände. Mélanie ist fasziniert von seinen Erkenntnissen und weiß: Sie muss diesen Mann treffen, von ihm will sie lernen, wie sie ihren Traum verwirklichen und Menschenleben retten kann ...
Von der Autorin des Bestsellers »Astrid Lindgren« ein so packender wie emotionalerRoman über die Anfänge der Homöopathie, basierend auf der Lebensgeschichte von Mélanie und Samuel Hahnemann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Paris, 1834: Mélanie d’Hervilly will Ärztin werden, doch als Frau wird ihr der Zugang zur Universität verwehrt. Heimlich schleicht sie sich trotzdem in den Seziersaal, um die Anatomie des Menschen zu studieren. Ihr Geld verdient sie als Malerin und Dichterin. Doch dann wird sie plötzlich krank: Sie leidet an starken Unterleibsschmerzen, und die Ärzte scheinen ihr nicht helfen zu können. Ihre letzte Hoffnung ist die Homöopathie. Wie durch Zufall fällt ihr Samuel Hahnemanns »Organon der Heilkunst« in die Hände. Die junge Frau weiß: Sie muss diesen Mann treffen! In Männerkleidung reist sie nach Köthen, um den Begründer der neuen Heilkunst kennenzulernen. Als sie nach zwei Wochen aus der Kutsche steigt und Samuel Hahnemann gegenübersteht, ist sie beeindruckt von diesem klugen und charmanten Mann. Und auch er fühlt sich sofort zu der jungen, lebensfrohen Comtesse hingezogen, die schon bald nicht nur seine Schülerin wird, sondern auch seine Frau …
Über Susanne Lieder
Susanne Lieder, 1963 in Bad Oeynhausen geboren, lebt mit ihrer Familie südlich von Bremen. Unter verschiedenen Pseudonymen schreibt sie sehr erfolgreich historische Romane und Romanbiographien. Als sie erfuhr, dass der große Homöopath Samuel Hahnemann in zweiter Ehe mit einer wesentlich jüngeren Frau verheiratet war, wollte sie sofort mehr über diese Frau wissen und ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte erzählen.
Im Aufbau Taschenbuch liegt ebenfalls ihr Roman »Astrid Lindgren« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Susanne Lieder
Die Elemente des Lebens
Mélanie lebt für die Heilkunst, in Samuel Hahnemann findet sie die Liebe
Historischer Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
I. — Spätsommer 1834 – Sommer 1835
1. Kapitel — Paris im September 1834
2. Kapitel — Köthen, etwa zur gleichen Zeit
3. Kapitel
4. Kapitel — Köthen, am Tag darauf
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel — Köthen, wenige Tage vor Weihnachten
13. Kapitel — Zwei Tage nach Weihnachten
14. Kapitel — Köthen im Februar 1835
15. Kapitel — Köthen im April desselben Jahres
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel — Köthen im Juni desselben Jahres
II. — Winter 1836 – Winter 1839 Paris
19. Kapitel — Paris, Rue de Madame, im Januar 1836
20. Kapitel — Paris im März
21. Kapitel
22. Kapitel — Paris im Mai 1836
23. Kapitel — Paris im September desselben Jahres
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel — Paris im November desselben Jahres
28. Kapitel — Paris im Februar 1837
29. Kapitel — Paris im Juni desselben Jahres
30. Kapitel — Paris im November 1837
31. Kapitel
32. Kapitel — Paris im April 1838
33. Kapitel — Paris im Oktober desselben Jahres
III. — Herbst 1842 – Herbst 1843
34. Kapitel — Paris im Oktober 1842
35. Kapitel — Paris im Dezember
36. Kapitel — Paris im März 1843
37. Kapitel — Paris im April desselben Jahres
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel — Paris im Juni
41. Kapitel
42. Kapitel — Paris im Juli desselben Jahres
43. Kapitel — Zwei Tage später
44. Kapitel — Friedhof Montmartre
Nachwort und Danksagung
Impressum
I.
Spätsommer 1834 – Sommer 1835
1. Kapitel
Paris im September 1834
Mélanie stand am Fenster ihrer Kammer und lehnte die Stirn an die kühle Scheibe. Ausgerechnet heute musste es so regnen!
Sie schaute in den Himmel, an dem tief und schwer graue Wolken hingen, und verzog missmutig das Gesicht. Für einen kurzen Moment überlegte sie, die Reise zu verschieben. Sie könnte noch ein paar Tage abwarten und auf besseres Wetter hoffen.
Nein, beschloss sie gleich darauf, sie würde wie geplant reisen und dem scheußlichen Regen trotzen!
Ihre Reisetasche stand fertig gepackt neben dem Bett, und auf dem Sekretär lag der Brief, den sie an ihren Onkel verfasst hatte. Ein paar Zeilen der Erklärung war sie ihm schuldig.
Mélanie wandte sich um und betrachtete den dunklen Wollanzug, der an ihrem Kleiderschrank hing. Er war frisch ausgebürstet worden, und Clementine hatte das helle Leinenhemd geplättet.
Wo aber war der Hut?
Sie drehte sich um die eigene Achse und sah ihn auf dem kleinen Tisch neben dem Bücherregal liegen, darunter das Paar Schuhe aus Ziegenleder. Es war ein wenig zu groß, deshalb hatte Clementine die Spitzen mit Zeitungspapier ausgestopft.
Mélanie reiste grundsätzlich als Mann gekleidet, es war sicherer und ersparte ihr eine Begleitperson.
Sie schlüpfte aus ihrem Nachthemd, wusch Gesicht und Oberkörper in der Waschschüssel und trocknete sich gründlich ab. Es war kühl im Zimmer, und sie fröstelte. Mit klammen Fingern umwickelte sie ihre Brust mit Streifen von Leinentüchern, vergewisserte sich, dass sie straff, aber nicht zu straff saßen, und zog ein Unterhemd darüber.
Sie warf einen kritischen Blick in den Standspiegel und strich mit beiden Händen über das Hemd. Es war keine Wölbung mehr zu sehen. Zufrieden nickte sie und zog sich weiter an.
Einige Minuten später schloss sie die Zimmertür hinter sich und beugte sich über das Treppengeländer. Von hier aus konnte man den gesamten Eingangsbereich einsehen, und wenn man sich ein wenig anstrengte, auch hören, ob jemand im Salon oder in der Bibliothek war. Ihr Onkel frühstückte um diese Zeit für gewöhnlich im Salon.
Mélanie beugte sich noch etwas weiter vor und lauschte. Als junges Mädchen wäre sie einmal um ein Haar über die Brüstung gefallen, weil sie das Gleichgewicht verloren hatte.
Aus dem Salon waren Stimmen zu hören; die kräftige ihres Onkels und die leise, zaghafte des Dienstmädchens.
Auf Zehenspitzen huschte Mélanie die marmorne Treppe hinunter, blieb kurz stehen, weil sie meinte, eine Tür gehört zu haben.
Sollte sie ihrem Onkel begegnen, würde sie ihm das sagen, was sie auch in dem Brief geschrieben hatte: Sie begäbe sich auf eine längere Reise und wüsste noch nicht genau, wann sie zurück wäre. Er würde davon ausgehen, dass sie innerhalb Frankreichs verreiste, und das war gut so. Wüsste er, dass ihre Reise nach Deutschland ging, würde er augenblicklich ihren Vater verständigen.
Besser, wir begegnen uns nicht, dachte sie und lief weiter in Richtung Vestibül. Dort hing der schwere dunkle Mantel, den sie nur ungern trug, der bei dem scheußlichen Wetter aber notwendig war.
Im Vorbeigehen legte sie den Brief auf den silbernen Teller, auf dem sich bereits die Visitenkarte eines Kunsthändlers befand, der ihren Onkel am gestrigen Tag nicht angetroffen hatte.
Den Mantel über dem Arm, den Hut in der Hand, verließ Mélanie die Villa, duckte sich an den tropfnassen Rhododendren vorbei und öffnete die schmiedeeiserne Gartenpforte. Wie immer ächzte und quietschte sie, und Mélanie blieb mit wild klopfendem Herzen stehen. Würde gleich das Gesicht ihres Onkels am Fenster erscheinen?
Doch es blieb still, niemand war zu sehen. Als sie die Kutsche sah, die wie verabredet etwas weiter abseits stand, stieß sie ein erleichtertes Zischen aus. Auf Edouard war Verlass!
Der Kutscher, ein stattlicher Mann in den Vierzigern, der viele Jahre im Dienst ihres Vaters gestanden hatte und seit einiger Zeit für sie arbeitete, kam auf sie zu und nahm ihr Mantel und Hut ab. »Mademoiselle.« Er verbeugte sich, sein belustigtes Grinsen hatte sie aber noch gesehen.
Edouard nahm ihr die Reisetasche ab und war ihr beim Einsteigen behilflich. »Achten Sie auf die Stufen, Mademoiselle, sie sind rutschig. Hoffen wir, dass das Wetter besser wird.«
Mélanie nahm auf der samtbezogenen Bank Platz und fasste sich verstohlen ans Bein. Der Stoff ihrer Hose kratzte fürchterlich und zwickte im Schritt, sie würde sich wohl nie daran gewöhnen. Genauso wenig wie an den schrecklichen Schnauzbart aus Ziegenhaar, der sie beim Sprechen in der Nase kitzelte.
Edouard schob die Reisetasche unter die Bank und legte einen Regenschirm daneben. »Der kann sicher nicht schaden. Wir werden häufig eine Rast einlegen müssen.« Er sah sie kurz fragend an, als rechne er damit, dass sie es sich doch noch anders überlegen könnte. Dann reichte er ihr eine zusammengefaltete Decke.
»Merci, Edouard, Sie haben wieder an alles gedacht.«
Er schloss die Tür und ging zum Kutschbock, um aufzusitzen.
Kurz darauf vernahm sie ein »Ho!«, und die Kutsche zog mit einem Ruck an, als sich die beiden dunklen Pferde in Bewegung setzten.
Mélanie lehnte sich zurück und schloss die Augen.
Eine zweiwöchige Reise lag vor ihr.
Nachdem sie eine ganze Weile gefahren waren – Paris, das längst erwacht war, hatten sie hinter sich gelassen –, waren Mélanie die Augen zugefallen.
Sie schreckte hoch, als Edouard an die Tür klopfte und »Mademoiselle d’Hervilly?« raunte. Wie lange hatte sie geschlafen?
»Sind Sie wach, Mademoiselle?«
»Oui«, murmelte sie schläfrig, öffnete die Tür und blinzelte.
»Da vorn ist ein Gasthof.« Er deutete nach links zu einem verhutzelten Gebäude, an das ein länglicher Stall angrenzte. »Es wird bald dunkel.« Er schmunzelte. »Die letzten beiden Pausen haben Sie verschlafen.«
Mélanie stieg benommen aus und streckte sich. Ihr tat jeder Muskel, jeder Knochen im Leib weh. »Wie spät ist es?«
»Gleich sieben.« Edouard nahm ihre Reisetasche. »Soll ich Sie morgen früh um fünf Uhr wecken lassen, Mademoiselle?«
Fünf Uhr. Sie unterdrückte ein Seufzen und nickte ergeben.
Edouard räusperte sich und deutete auf ihr Haar. »Pardon, aber vielleicht sollten Sie den Hut aufsetzen.«
»Mon Dieu!« Hastig griff sie nach ihrer Kopfbedeckung. Eine Haarsträhne hatte sich aus dem Knoten gelöst, mit einer ungeduldigen Handbewegung steckte sie sie zurück. »Und?«
Ihr Kutscher nickte.
»Bon.« Mélanie ging zu den Pferden und klopfte ihre Hälse. »Jetzt könnt ihr euch ausruhen, meine Hübschen.« Sie nahm zwei Karotten aus dem kleinen Säckchen, das am Kutschbock hing, und hielt sie ihnen vors Maul.
»Kommen Sie, Mademoiselle, ich bringe Sie hinein.« Edouard hatte den Ellbogen bereits gespreizt, schien sich dann jedoch daran zu erinnern, dass sie offiziell keine Mademoiselle war.
Mit einem leisen »Pardon« reichte er ihr die Reisetasche. »Die werden Sie wohl selbst tragen müssen«, raunte er und nickte wie beiläufig in Richtung Gasthof. »Sie steht dort und beobachtet uns.«
Mit »sie« meinte er wohl die Wirtin, eine rundliche Person mit ausladenden Hüften und einer merkwürdigen Frisur, die Mélanie an eine Obstschale erinnerte. Sie stand in der Tür, eine Hand in ihrer Schürze, die irgendwann vermutlich mal weiß gewesen war. »Ah, Gäste!«, rief sie entzückt aus und wedelte mit der Hand. »Kommen Sie, kommen Sie, Messieurs!«
»Bitte keine Würfelspiele, Mademoiselle«, flüsterte Edouard, während sie auf die Wirtin zugingen.
Mélanie gluckste. »Keine Sorge, Edouard.«
Es war schon eine Weile her, als er sie nach Reims gefahren hatte, wo sie eine Freundin besuchen wollte. Auch damals hatten sie in einem Gasthof übernachtet, und Mélanie hatte sich von zwei jungen Burschen zu einem Würfelspiel überreden lassen. Die beiden waren betrunken genug gewesen, um nicht zu bemerken, dass sie gegen eine Frau verloren – und zwar haushoch. Einer der beiden war ein ausgesprochen schlechter Verlierer und hatte gemeint, sie würde betrügen, das könne kaum mit rechten Dingen zugehen. Edouard hatte dazwischengehen und sie vor einer Rauferei bewahren müssen –, bei der sie vermutlich den Kürzeren gezogen hätte.
Der Gasthof wirkte nicht sehr einladend, doch das spielte keine Rolle. Hauptsache, sie bekämen eine warme Mahlzeit und ein halbwegs weiches Bett.
»Messieurs.« Die Wirtin trat beiseite und winkte einem jungen Mann mit feuerrotem wirrem Haar zu. »Mein Sohn wird Ihr Gepäck aufs Zimmer bringen. Sie möchten doch ein Zimmer?«
»Zwei, wenn wir bitten dürfen«, sagte Edouard.
»Gewiss, gewiss, zwei natürlich.«
Mélanie stellte verblüfft fest, dass die Wirtin ihr zuzwinkerte.
»Wünschen Messieurs ein warmes Mahl?«
Mélanie überließ wie gewohnt, wenn sie als Mann reiste, ihrem Kutscher das Reden.
»Das wäre fein.« Er blickte sich in der schummrigen Gaststube um und verzog flüchtig das Gesicht.
»Nehmen Sie Platz, Messieurs.« Die Wirtin eilte voraus, wischte halbherzig über einen Tisch und rückte zwei der Stühle zurecht. »Ein kühles Bier?«
»Für mich ein Starkbier und für meinen Freund hier ein helles«, sagte Edouard.
Die Wirtin schürzte die Lippen und rief einem hünenhaften Mann mit Halbglatze und kugelrundem Bauch zu: »Hast du gehört, Jacques?« Dann beugte sie sich vertraulich zu Mélanie. »Wie wär’s mit einem würzigen Wildeintopf, Monsieur?«
Mélanie nickte.
»Er ist nicht sehr gesprächig, was?«, fragte die Wirtin Edouard.
»Mein Freund ist taubstumm, Madame«, erklärte er. »Aber er kann von Ihren Lippen ablesen.«
»So, kann er das?« Sie kniff die Augen zusammen, taxierte Mélanie und raunte dann: »Na, wenn er’s nicht hören kann: Er ist ein hübscher Bursche, Ihr junger Freund, Monsieur.«
Aus Edouards Kehle kam ein heiserer Laut, und er musste sich räuspern. »Kümmert sich jemand um unsere Pferde?«
»Mais oui«, versicherte die Wirtin, wischte erneut über den Tisch und trollte sich.
»Mon Dieu, Edouard!«, stieß Mélanie leise hervor und musste sich das Lachen verkneifen.
»Ich wollte mich eigentlich selbst um die Pferde kümmern«, gab er grinsend zurück. »Aber ich dachte, es wäre besser, wenn ich bei Ihnen bleibe.« Er nickte in Richtung der Wirtin, die sich lautstark mit dem Mann am Tresen stritt. »Sie hat ein Auge auf Sie geworfen, fürchte ich.«
»Dabei hat sie doch einen sehr ansehnlichen Ehemann«, entgegnete Mélanie trocken, und er prustete vor Lachen.
Ihr Bier wurde gebracht, und sie stießen ihre Krüge aneinander.
»Auf Ihr Wohl, Mademoiselle«, sagte Edouard leise. »Oder hätten Sie lieber ein Glas Wein?«
»Nein, nein, nur keine Umstände. Vielleicht sollten wir uns einen Namen für mich ausdenken«, schlug sie vor, nachdem sie einen großen Schluck getrunken hatte. Eigentlich machte sie sich nichts aus Bier, doch dieses war süffig und kühl und löschte ihren Durst. »Was halten Sie von Hercule?«
Edouard schien nachzudenken. »Hercule«, sagte er schließlich und um seine Mundwinkel zuckte es. »Dann auf Ihr Wohl, Hercule.«
Der Wildeintopf war kräftig gewürzt und das Brot, das die Wirtin dazu gebracht hatte, hart und grob gebacken. Es war ein Segen, dass man es in die Suppe tunken und einweichen konnte, andernfalls hätte Mélanie es kaum hinunterbekommen.
»Man braucht Zähne wie ein Gaul«, meinte Edouard und brach ein Stück ab. »Aber es macht satt. Soll ich noch etwas Eintopf bringen lassen, Mademoiselle?«
»Hercule«, erinnerte sie ihn und schüttelte den Kopf.
Außer ihnen war noch ein alter Mann in der Gaststube anwesend, der vor einem Glas Dunkelbier saß. »Beachten Sie den gar nicht«, hatte die Wirtin gemeint. »Gleich kippt er vornüber. Ich kenne das schon.«
Und tatsächlich sackte sein Kopf, gerade als Mélanie aufgegessen hatte, auf die Tischplatte, und er begann, laut zu schnarchen.
Edouard bestellte einen Krug Wein, der von dem Hünen gebracht wurde, dessen Bauch über der Gürtelschnalle wippte. »Ihr Wein.« Er knallte den Krug auf den Tisch und etwas Wein schwappte über. »Santé!«
Als Edouard um zwei Gläser bat, schaute er ihn verwundert an, zuckte die Schultern und brachte sie kurz darauf. Selbst im schummrigen Licht war zu erkennen, wie schmierig sie waren.
Mélanie nahm ihr Glas und wischte es an ihrem Hemd ab, bis es einigermaßen sauber war.
»Ob er geglaubt hat, dass wir den Wein aus unserem Bierkrug trinken?« Edouard schnalzte mit der Zunge. »Pardon, Mademoiselle, wenn ich gewusst hätte, dass es hier so …«
»Schon gut«, unterbrach sie ihn mit einem Lächeln. »Wir haben gut gegessen und getrunken und hatten unseren Spaß. Oder etwa nicht?«
Er nickte, und sie stellte fest, wie müde und erschöpft er aussah. »Hoffen wir, dass das Bett einigermaßen komfortabel ist«, meinte er und prostete ihr zu.
»Und dass der Wirtin nicht in den Sinn kommt, in der Nacht an meine Zimmertür zu klopfen.«
Wenig später stand Mélanie in der kargen, aber offensichtlich sauberen Kammer. Sie wartete, bis die Wirtin die Tür hinter sich geschlossen hatte und sank dann auf das Bett. Das knarzte nicht weniger als die Holztreppe, die sie eben hochgestiegen waren. Mélanie streckte sich lang aus und gestattete sich ein erleichtertes, wohliges Seufzen.
Nach einer Weile stand sie wieder auf und ging zum Fenster, um es zu öffnen. Eiskalte, feuchte Luft drang ins Zimmer, und sie begann, zu frösteln.
Dennoch schloss sie es erst wieder, nachdem sie Anzug und Hemd ausgezogen und über die Stuhllehne gehängt hatte.
Sie war so müde, dass sie hoffte, gleich einschlafen zu können. Sie zog die Nadeln aus ihrem Haar, das sich wie ein Wasserfall über ihre Schultern ergoss, und band es zu einem Zopf zusammen. Mélanie war blond wie ihre Mutter und groß wie ihr Vater. Für eine Frau ungewöhnlich groß. Das hatte es ihr stets erleichtert, in die Rolle eines Mannes zu schlüpfen.
Sie überlegte, ob sie die Leinenstreifen abwickeln sollte. Nein, dann würde es morgen früh zu lange dauern.
Aus dem Zimmer nebenan war Schnarchen zu hören, offenbar war Edouard bereits eingeschlafen.
Mélanie kroch unter das dicke Plumeau, das leicht nach Mottenkugeln roch, und machte die Augen zu. »Bonne nuit, Hercule.«
Wie in ungezählten Nächten zuvor, passierte es auch in dieser: Sie erwachte schweißgebadet von heftigen Bauchkrämpfen. Ausgerechnet jetzt und hier!
Sie rollte sich zusammen und umklammerte mit beiden Händen ihren Leib. Zischend ließ sie den angehaltenen Atem entweichen.
Herr, betete sie, gib, dass der Hofrat Hahnemann mir helfen kann und ich den weiten Weg nicht vergeblich gemacht habe.
Nach dem Frühstück, das aus mit Honig gesüßtem Gerstenbrei, dunklem Brot mit Butter und einem Kaffee bestand, der Tote wiedererwecken könnte, spannte Edouard die Pferde an, während Mélanie am Tisch sitzen blieb. Ihr Leib fühlte sich wund an, wie immer, wenn diese furchtbaren Schmerzen sie gequält hatten.
Die Wirtin pirschte sich an sie heran, stellte sich vor sie hin, das Gesicht ihrem zugewandt. »Hatten Sie eine angenehme Nacht, Monsieur?«, fragte sie laut und deutlich, wobei sie jede einzelne Silbe betonte.
Mélanie nickte und schenkte ihr ein Lächeln, das freundlich, aber hoffentlich nicht zu freundlich ausfiel. Sie wollte die Frau nicht dazu bringen, sich zu etwas hinreißen zu lassen.
Sie bezahlte die Rechnung und gab ein üppiges Trinkgeld.
Die Wirtin starrte auf die Münzen. »Merci beaucoup, Monsieur!«
Bevor ihr womöglich einfiel, Mélanies Hände zu küssen, war die rasch aufgestanden und zur Tür gegangen.
»Mein Sohn bringt Ihr Gepäck zur Kutsche, Monsieur!«, rief sie ihr hinterher.
Mélanie winkte ab und schüttelte den Kopf.
»Wo steckt der Bengel nur wieder?« Die Wirtin brüllte seinen Namen, blickte sich suchend um und resignierte schließlich mit einem langanhaltenden Seufzen. »Zu nichts zu gebrauchen, ganz wie der Vater.«
Mélanie griff nach ihrer Reisetasche und floh aus der Gaststube. In der Tür prallte sie beinahe gegen Edouard.
»Beehren Sie uns bald wieder, Messieurs!« Die Wirtin kam angelaufen. Hatte sie vor, ihnen noch rasch den Weg zur Kutsche zu fegen? Sie machte einen ungelenken Knicks, der so ulkig aussah, dass Mélanie ein Lachen nicht mehr unterdrücken konnte.
Die Wirtin musterte sie, und für einen Augenblick befürchtete sie, dass ihre Tarnung aufgeflogen war. Dann aber murmelte die Frau etwas Unverständliches und wandte sich ab.
Mélanie war froh, als sie wenig später in der Kutsche saß. Die Stille war Balsam für ihre Ohren.
Die Gegend, durch die sie fuhren, war ländlich und malerisch. Mit kleinen Dörfern, die sich in weiche Hügellandschaften duckten, Wäldern mit rotgoldenem Laubwerk, umzäunten Viehweiden und Feldern, auf denen das Korn zusammengebunden wurde. Mélanie dachte an ihren Onkel und ihre Tante, die den Brief längst gelesen haben müssten. Onkel Lucien hatte wahrscheinlich bereits ihren Vater benachrichtigt, obwohl sie ihn gebeten hatte, es nicht zu tun.
Ich werde ihnen alles erzählen, wenn ich zurück bin und auf ihr Verständnis hoffen.
Dann und wann kamen Kinder mit spitzen, schmutzigen Gesichtern an die Straße gelaufen, und das eine oder andere Mal bat Mélanie Edouard, anzuhalten, und warf ihnen ein Geldstück zu.
»Seien Sie nicht zu großzügig, Mademoiselle«, raunte er ihr zu, als sie ihn erneut bat, zu halten.
Sie steckte den Kopf aus der Tür und tastete ein wenig fahrig nach ihrem Haar. Der Hut!
Sie setzte ihn flott auf, es war ihr egal, ob er richtig saß. »Sehen Sie sich doch diese armen Geschöpfe an, Edouard.« Ihr Herz zog sich vor Mitgefühl zusammen.
Ein kleiner Junge mit dunklen Locken kam angelaufen. Er war barfuß wie die meisten Kinder, seine Kleidung war geflickt, die Hosenbeine zu kurz. Er starrte Mélanie neugierig an, und sie konnte nicht umhin, ihn anzulächeln.
»Julien!«, rief eine junge Frau hinter ihm. »Wirst du wohl aufhören, Monsieur zu belästigen!« Sie war nähergekommen, und Mélanie sah, wie ausgezehrt sie war. »Pardon, Monsieur.« Sie knickste und nahm den Jungen an die Hand, den Blick gesenkt.
Mélanie hätte ihr gern etwas Freundliches, vielleicht sogar Tröstendes gesagt. Nur was? »Es tut mir leid, dass Sie es so viel schwerer haben als ich?«
Unterschiedlicher könnten ihrer beider Leben nicht sein: sie, die privilegierte Frau aus einer angesehenen Adelsfamilie, und dort die junge Mutter von niederer Herkunft, die vermutlich nie die Chance auf ein besseres, ein komfortableres Leben bekommen würde.
Mélanie zog ihre Geldbörse hervor, die am Gürtel unter dem Jackett befestigt war, und nahm ein Geldstück heraus. Um nicht reden zu müssen, machte sie eine Handbewegung, die ihr selbst herablassend erschien. Dabei meinte sie es gar nicht so.
Sie bedeutete der jungen Frau, die Hand zu öffnen, und legte die Münze hinein.
Die Frau machte große Augen, errötete und knickste erneut. »Merci, Monsieur. Merci beaucoup.« Zum ersten Mal hob sie das Gesicht und schaute Mélanie an. Die beiden tauschten einen Blick, und in den bernsteinfarbenen Augen der jungen Mutter glomm etwas auf: Überraschung und Erkennen. Ein ungläubiges, flüchtiges Lächeln huschte über ihr Gesicht, und sie nickte unmerklich.
Mélanie war zunächst erschrocken, dann aber erwiderte sie ein wenig zögernd das Lächeln. Merci, dass Sie mich nicht mit einem Ausruf verraten haben.
Die junge Frau bedankte sich ein weiteres Mal und wandte sich ab. Mit dem kleinen Jungen an der Hand lief sie zu den anderen zurück, die mit der Arbeit weitergemacht hatten. Das Geldstück hatte sie in ihrer Rocktasche verschwinden lassen.
Mélanie gab Edouard ein Zeichen und rutschte nah ans Fenster, ihren Skizzenblock im Schoß. Mit geübtem Strich zeichnete sie den kleinen Julien, seine zerzausten Locken und die großen dunklen Augen.
Sie lächelte, weil sie an den Mann denken musste, den sie an der Académie kennengelernt hatte, und der ebenfalls Julien hieß.
Wie jung wir damals waren, dachte sie und wunderte sich über das eigenartige Gefühl, das sie beschlich.
Julien hatte mehr als ihr guter Freund sein wollen, doch sie hatte ihm rasch zu verstehen gegeben, dass seine Bemühungen zwecklos waren.
Vor ein paar Jahren waren sie sich zufällig wiederbegegnet, und Mélanie hatte erfahren, dass er inzwischen verheiratet und Vater von vier Kindern war.
Und ich bin noch immer allein.
2. Kapitel
Köthen, etwa zur gleichen Zeit
Samuel Hahnemann saß in seinem ausgeblichenen, inzwischen auch recht unkomfortablen Sessel und schaute teilnahmslos aus dem Fenster. Im Hinterhof spielten Kinder und machten dabei einen solchen Krach, dass er vor ein paar Minuten das Fenster geöffnet und gebrüllt hatte, sie sollten endlich leiser sein.
Samuel schloss den oberen Knopf seines Morgenmantels. Er hätte sich längst anziehen müssen, aber er konnte sich nicht aufraffen.
Es klopfte, und seine Tochter Charlotte kam herein. »Du sitzt ja immer noch da. Sagtest du nicht gestern, dass du heute Vormittag eine Patientin hast?«
»Nein.«
»Doch, das sagtest du, ich erinnere mich noch sehr gut. Komm, steh auf und zieh dich an. Oder willst du den ganzen Tag im Morgenrock dasitzen?«
Er unterdrückte ein Seufzen. Sie neigte dazu, ihn wie ein kleines Kind zu behandeln, und das konnte er auf den Tod nicht ausstehen.
»Hast du die Post schon durchgesehen?«, fragte sie, während sie mit einem Leinentuch, das sie aus der Schürzentasche gezogen hatte, über den Tisch neben ihm wischte.
»Nein.«
»Früher hast du das gleich nach dem Frühstück gemacht.«
»Ja, früher.« Er stand schwerfällig auf und ging zur Tür.
An manchen Tagen würde er am liebsten im Bett bleiben, dann wieder juckte es ihn derart in den Fingern, in seine Praxis zu gehen und Patienten zu empfangen, dass er das Schild »Heute Sprechstunde« ins Fenster stellte.
Charlotte folgte ihm und strich im Vorbeigehen hier und da über Möbelstücke und Bilderrahmen. »Heute Mittag gibt’s Kohleintopf.«
Schon wieder.
»Den magst du doch so gerne.«
Samuel schwieg, ging in seine Kammer und zog seinen Morgenrock aus. Er überlegte kurz, ihn einfach auf dem Bett liegen zu lassen, um sie zu ärgern.
Ach nein, im Grunde war er ja froh, dass seine Töchter sich entschlossen hatten, ihm den Haushalt zu führen. Auch wenn er sich oft wie ein Gefangener in den eigenen vier Wänden fühlte. Sie wachten mit Argusaugen über ihn, eifersüchtig auf jeden, der sich ihm näherte und nicht sein Patient war.
Samuel zog das Jackett an, das am Schrank hing, ohne darauf zu achten, ob es sauber war oder zur Hose passte. Wen interessierte das?
Als er seine Kammer verließ, erwartete Charlotte ihn bereits. Sie stand im Flur, das Kinn gereckt, die Stirn gerunzelt.
Den Blick kannte er: sie war ungehalten. Das musste nicht an ihm liegen, aber zweifelsohne würde er der Prellbock sein.
»Vater.« Sie schnalzte mit der Zunge und zupfte an seinem Hemdkragen. »Und dieses Jackett ist scheußlich. Habe ich dir nicht gestern erst gesagt, dass es längst ins Feuer gehört?«
»Ins Feuer? Bist du zu retten?«
»Dann verschenk’ es. Das Armenhaus wird sich freuen.«
»Armenhaus.« Er schnaubte und ging an ihr vorbei in sein Ordinationszimmer. Der Raum war wie eine Zuflucht für ihn.
Sie hatten selbst lange Zeit nicht viel gehabt, hatten oft von der Hand in den Mund gelebt, auch wenn er jede erdenkliche Arbeit – und nicht immer war es ein Zuckerschlecken gewesen – angenommen hatte.
»Was sollen deine Patienten sagen?« Charlotte war hinter ihm hergekommen und blieb in der Tür stehen. »Oder die Nachbarn.«
»Was kümmern mich die Leute?« Er setzte sich an seinen Schreibtisch und tat so, als müsse er Krankenjournale ordnen.
»Gut, dass Mutter dich nicht so sehen kann.«
Samuel schlug mit der Faust auf den Tisch. »Es reicht, Lottchen! Behandle mich gefälligst nicht, als wäre ich nicht mehr ganz richtig im Kopf!«
Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab. »Davon kann doch gar nicht die Rede sein, Vater.«
»Wenn du jetzt so gut sein willst …«
Sie zögerte, dann jedoch nickte sie ergeben und schloss die Tür hinter sich.
Samuel lehnte sich zurück und atmete auf. Herrlich, diese Ruhe! Kein Gezeter, kein »Hast du schon …?« und »Du wolltest doch …«, nur Stille.
Als seine Frau noch lebte, hatte sie ein strenges Regiment geführt. Regeln und Ordnung waren Henriette wichtig gewesen, und in diesem Sinne hatte sie ihre gemeinsamen Kinder erzogen. Frohsinn hatte es in ihrem Haus nicht gegeben. »Für so etwas habe ich keine Zeit, Samuel«, hatte sie behauptet, als er eine Bemerkung gemacht hatte. »Disziplin, Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl, das sind Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben müssen, nicht Frohsinn und Unbeschwertheit.« Sie hatte mit der Zunge geschnalzt. »Frohsinn! Als käme es darauf an!«
Kopfschüttelnd erhob Samuel sich und ging zum Bücherschrank. Er würde ein paar Seiten lesen, zu Mittag essen, ein kleines Schläfchen und anschließend vielleicht einen Spaziergang machen.
Sein immergleicher Tagesablauf seit Jahren.
3. Kapitel
Elf Tage waren sie nun unterwegs, und an diesem frühen Nachmittag hatte Edouard die Kutsche angehalten, damit die Pferde ausruhen konnten. Er ließ sie grasen und holte von einem nahegelegenen Bach Wasser. Die Erschöpfung war ihnen anzusehen.
Mélanie hatte sich auf einen umgestürzten Baumstamm gesetzt und massierte ihre Füße, die grässlich schmerzten, dabei war sie seit Stunden keinen einzigen Schritt gelaufen.
Sie befanden sich am Eingang eines Buchenwäldchens, das zu durchqueren einige Zeit in Anspruch nehmen würde, wie Edouard gemeint hatte. »Danach kommt ein Dorf mit einem Gasthof, in den wir einkehren.«
Mélanies Magen knurrte, und sie legte die Hand darauf. Gottlob waren die Leibschmerzen nicht zurückgekehrt.
Edouard stand an einen Baum gelehnt da, die Arme vor der Brust verschränkt.
»Warum setzen Sie sich nicht einen Moment, Edouard?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich sitze den ganzen Tag, Mademoiselle.«
»Sie haben recht. Ich sollte auch ein paar Schritte gehen.« Mélanie erhob sich, schnürte ihre Schuhe und machte sich auf, die nahe Umgebung ein wenig zu erkunden.
Doch nicht ohne Edouard, wie sie bemerkte. Der Kutscher hatte sich wortlos an ihre Fersen geheftet.
»Ist es nicht herrlich hier?«, sagte sie, als sie zum Bach kamen, der leise gluckerte und in dem sich die späten Sonnenstrahlen fingen. Ein Feuersalamander saß auf einem Stein, das Köpfchen gereckt, die Augen geschlossen.
Mélanie wollte etwas näher herangehen, um ihn später zeichnen zu können, als sie glaubte, ein Geräusch gehört zu haben. Ein Rascheln und Knacken, als ob Füße über Laubboden schleichen.
Sie gab Edouard ein Zeichen und legte den Finger auf die Lippen. Geduckt liefen sie zurück zur Kutsche.
Edouard spannte die Pferde an, die unruhig geworden waren, sprach ihnen mit leiser Stimme zu, saß auf und zog an den Zügeln.
Mélanie war unterdessen lautlos eingestiegen und hatte die Tür geschlossen. Die Kutsche fuhr an, und sie warf einen Blick aus dem Fenster. Möglicherweise hatte sie sich geirrt, und es war nur ein Tier gewesen.
Oder aber eine Räuberbande hielt sich in der Nähe auf und wartete nur auf einen geeigneten Moment. Mélanie hatte ihre Pistole dabei, sie reiste nie ohne. Dass sie nicht nur schießen konnte, sondern auch ihr Ziel nur selten verfehlte, hatte sie bereits mehrfach bewiesen.
Vor Jahren – sie ärgerte sich noch heute, dass sie nicht damals schon als Mann gereist war – hatten zwei Landstreicher sie überfallen und ihr die Geldbörse und den Schmuck, den sie am Leib trug, gestohlen.
Edouard trieb die Pferde an, und sie legten an Tempo zu.
Mélanie wurde ins Polster gedrückt und musste ihren Hut festhalten. Furcht spürte sie nicht, für sie war es mehr ein Abenteuer. Sollten die Diebe ruhig kommen, sie würden ihr blaues Wunder erleben.
Als die Pferde noch schneller wurden, erhob sie sich schwankend und warf einen Blick aus dem hinteren Fenster.
Zwei Männer folgten ihnen auf Pferden, die unruhig die Köpfe hin und her warfen.
Wunderhübsche Tiere, dachte Mélanie bekümmert. Ein Jammer, dass ausgerechnet zwei Burschen ihre Besitzer waren, die ihre Schönheit wahrscheinlich kaum zu schätzen wussten.
Als kleines Mädchen war Mélanie wie ein Wirbelwind über die Weiden des Vaters geritten, das Haar offen und wie eine Fahne hinter ihr her wehend. »Um Himmels willen, Mélanie!«, hatte ihr Vater oft gerufen. »Nicht so schnell! Du wirst dir noch den Hals brechen.« Doch sie war nicht einmal gestürzt. Das Reiten lag ihr im Blut.
Mélanie nahm ihre Pistole, öffnete die Tür, klammerte sich mit der einen Hand am Rahmen fest und richtete die Waffe auf einen der Männer. Die Pistole war nicht geladen, das war hoffentlich auch gar nicht nötig. Meistens genügte der bloße Anblick. Vermutlich waren die beiden zwei Schlitzohren, die das Überraschungsmoment für sich nutzten und ihre Opfer plump überrumpelten und ausraubten. Und die einzige Waffe, die sie bei sich hatten, waren ihre Fäuste.
Mélanie sah, wie der Mann, auf den sie die Pistole gerichtet hatte, verblüfft und erschrocken die Augen aufriss. Er stieß einen Ruf aus, zerrte am Zügel und brachte sein Pferd zum Stehen.
Auch sein Begleiter hielt an. Die beiden sprachen laut miteinander, gestikulierten fluchend und machten kehrt.
Mélanie musste sich das Lachen verkneifen. Sie sammelte Mantel, Reisetasche und Schirm wieder ein, die während der holprigen, rasanten Fahrt vom Sitz gerutscht waren, und rief Edouard zu, er möge langsamer weiterfahren. »Es sieht so aus, als hätten wir unsere Verfolger abgeschüttelt!«
Je näher sie ihrem Ziel kamen, der kleinen Ortschaft Köthen, die im Osten Deutschlands lag, desto bildlicher versuchte Mélanie, sich den Mann vorzustellen, den sie dort aufsuchen wollte. Wie mochte Hahnemann aussehen? Was war er für ein Mensch? Das Wichtigere jedoch: Würde er ihr helfen und sie von ihren Leibschmerzen befreien können?
Durch den englischen Arzt Frederic Foster Quin hatte sie von der Homöopathie erfahren und Hahnemanns Buch »Das Organon der Heilkunst« gelesen. Mélanie war zutiefst angetan und voller Hoffnung, dass ihr geholfen werden konnte. In ihrer Verzweiflung hatte sie bereits etliche Ärzte konsultiert und einsehen müssen, dass es mit der Schulmedizin nicht weit her war.
Die Ärzte rieten zu Klistieren und scheußlichen Brechmitteln, um den Magen und die Gedärme zu reinigen – als ließen sich Krankheiten einfach aus dem Körper spülen –, oder sie nahmen einen Aderlass vor, der angeblich den Körper stärkte.
Ihren Leibschmerzen hatte das alles nichts anhaben können, sie waren weiterhin gekommen und gegangen, ohne dass sich daraus eine Erkenntnis hatte gewinnen lassen.
»Sie essen zu fett, Mademoiselle«, hatte einer der Doktoren gemutmaßt, während ein anderer genau das Gegenteil gemeint und sie dazu aufgefordert hatte, unbedingt fettreichere Nahrung zu sich zu nehmen. Ein dritter hatte behauptet, sie bewege sich zu viel, ein weiterer, sie brauche mehr Bewegung.
Hahnemann dagegen, so hatte sie gelesen, war davon überzeugt, dass nur in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnen könne. Fühle sich der Patient in seinem Inneren nicht wohl, trage er zu viele Sorgen und Nöte mit sich herum, wirke sich das über kurz oder lang auch auf den Organismus aus.
Mélanie faszinierten diese Ansätze. So lange schon quälten sie die Schmerzen, so vieles hatte sie bereits über sich ergehen lassen müssen. Wie oft hatte sie sich gefragt, was nur mit ihr war. Samuel Hahnemann war ihre große, ihre letzte Hoffnung.
Sie vernahm Edouards Lautes »Brr!«, und die Kutsche hielt an.
Mélanie öffnete die Tür und warf einen Blick hinaus. »Ist etwas geschehen?«
»Die Pferde brauchen eine Pause, Mademoiselle.« Er war vom Kutschbock gesprungen.
Mélanie stieg ohne seine Hilfe aus und sah sich um. Sie hatten an einem Feldrain auf einem schmalen grasbewachsenen Weg gehalten. »Ich weiß wirklich zu schätzen, was Sie für mich tun, und ich verspreche, Sie reich zu entlohnen, sobald wir wieder in Paris sind.«
Über sein müdes Gesicht huschte ein Lächeln. »Als Sie mich fragten, ob ich Sie nach Deutschland bringen würde, sagte ich sofort zu, erinnern Sie sich?«
»Gewiss erinnere ich mich.« Sie ging ein paar Schritte und atmete die frische, kühle Luft ein, die nach Moos und feuchtem Acker roch.
Mélanie streckte die Arme über dem Kopf aus und machte ein paar Kniebeugen. Ihre Gelenke knackten.
Es hatte einiger Überredungskunst bedurft, ihrem Vater mitzuteilen, dass sie allein leben wollte. Sie und ihre Mutter unter einem Dach, das ging einfach nicht.
Schließlich hatte er eine Wohnung in der Rue des Saint-Pères für sie gemietet, und sie hatte ihn gebeten, ihr eins der Dienstmädchen zur Verfügung zu stellen – und Edouard. Wie meistens hatte ihr Vater zunächst gemurrt und Einwände erhoben und sich schließlich geschlagen gegeben.
Während ihre Wohnung hergerichtet wurde, war Mélanie wieder – diesmal nur vorübergehend – bei ihrer Tante und ihrem Onkel untergekommen.
»Möchten Sie eine Kleinigkeit essen, Mademoiselle?« Edouard hatte den Proviantkorb hervorgeholt und begann, die Sachen auszupacken, die sie sich im letzten Gasthof hatten einpacken lassen. Darunter ein kleiner Laib Käse, der sehr verführerisch roch, ein Fässchen gesalzene Butter, ein Brotlaib und ein Stück gepökeltes Fleisch. Er blickte sich nach einer geeigneten Sitzgelegenheit für sie um, doch Mélanie setzte sich einfach ins Gras.
»Soll ich nicht lieber …?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist nicht nötig. Das Gras ist trocken.«
Er brach ein Stück Brot ab und reichte es ihr. Mit seinem Messer schnitt er ein dickes Stück Käse ab. »Butter?«
»Nein, aber ein Schluck Wasser wäre fein.«
Edouard holte den Lederschlauch, und sie trank gierig ein paar Schlucke.
Nach dem kleinen, aber sättigenden Mahl machte sich Mélanie zu einem kurzen Spaziergang auf. Sie hatte Edouard versprochen, in der Nähe zu bleiben. Für alle Fälle hatte sie ihre Pistole dabei.
Sie entdeckte ein Rudel Rehe und duckte sich hinter einer Eiche, um sie in Ruhe beobachten zu können. Ihr Vater hatte sie früh mit auf die Jagd genommen, aber sie hatte sich nicht sehr viel daraus gemacht. Es widerstrebte ihr, auf Tiere zu schießen. Das hatte sie ihrem Vater jedoch nie gesagt.
Als sie zurückkam, hatte Edouard die Pferde bereits wieder angespannt und saß auf dem Kutschbock, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Mélanie hätte nicht sagen können, ob er schlief.
»Edouard?«, fragte sie leise.
Er setzte sich auf, rückte den Hut zurecht und wollte absteigen, um ihr behilflich zu sein. Doch sie winkte ab.
Mit einem verhaltenen Seufzen setzte sie sich wieder und streckte die Beine aus, so gut es ging.
Bis Köthen war es noch eine Tagesreise.
4. Kapitel
Köthen, am Tag darauf
Über Nacht schien es Herbst geworden zu sein.
Samuel saß am Fenster und schaute nach draußen. Ein mehliger Nebel lag über den Gassen und hüllte die kleinen Häuser ein, die sich aneinanderschmiegten.
Samuel runzelte die Stirn, er konnte Nebel nicht ausstehen.
»Setz dich doch ein bisschen nach draußen vor die Tür«, hatte Charlotte nach dem Frühstück vorgeschlagen und nach seinem Arm gegriffen. Vorgeschlagen! Ihre »Vorschläge« verstand sie als Aufforderung, der man besser nachkam.
»Am Ende schleifst du mich noch auf die Straße«, hatte er geschimpft.
»Etwas frische Luft täte dir ganz gut, Vater. Du hast seit einem Jahr das Haus so gut wie nicht mehr verlassen.« Sie hatte in der Tür gelehnt, die Arme vor der Brust verschränkt.
Hatte sie recht? War er tatsächlich zum Stubenhocker geworden?
Ohne anzuklopfen kam sie herein, den Staublappen in der Hand, mit dem sie seinen alten Sekretär bearbeitete. »Vater.« Sie schnalzte mit der Zunge. Was hatte er nun wieder verbrochen?
Sie lief weiter umher und verrückte seine Medizinfläschchen und Bücher.
»Lass das Buch dort liegen, Lottchen«, bat er. »Es hat seinen Grund, weshalb es auf dem Pflanzenkundebuch liegt.«
Sie schnaubte missbilligend über seine ganz eigene Ordnung. »Da müht man sich Tag für Tag ab …«
Samuel setzte sich auf. Es reichte! Scharfe Worte waren immer seine Waffe gewesen, und er war noch nie vor einer Auseinandersetzung zurückgeschreckt. Seine Töchter konnten von Glück sprechen, dass er bislang immer alles geschluckt hatte, doch nun war es genug. »Was willst du damit sagen, Lottchen?«
Sie war blass geworden. »Ich wollte nur … Nichts für ungut, Vater.«
»Nichts da.« Er wedelte mit der Hand.
Sie wirkte betreten und ein wenig schuldbewusst. »Ich wollte dich nicht verärgern, Papa.«
Papa. Er schmunzelte in sich hinein. »Du hast mich verärgert. Du findest also, ich sei undankbar.« Er ließ es nicht wie eine Frage klingen.
Charlotte verzog den Mund zu einem schiefen, verkrampften Lächeln. »Nein, nein, das musst du missverstanden haben.«
»Ich bin vielleicht alt, Tochter, aber hier oben …« Er tippte sich an die Stirn. »… ist noch alles in Ordnung. Oder willst du etwas anderes behaupten?«
»Darum geht es doch gar nicht«, murmelte sie.
»Ihr behandelt mich wie einen unzurechnungsfähigen Mann, der nicht mal seine Dankbarkeit zeigen kann, das missfällt mir.« Um ein Haar hätte er losgepoltert, konnte sich aber gottlob zurückhalten. »Ihr seid mir lieb und teuer, das weißt du, aber ich dulde nicht, dass ihr euch mir gegenüber derart respektlos verhaltet. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
Seine Tochter zog den Kopf ein und nickte.
Samuel rieb sich vergnügt die Hände, nun wieder ganz gelassen. »Du gehst doch sicher zum Markt. Wenn du mir weiße Rübchen mitbringen würdest, wäre ich dir sehr verbunden.«
Sie schaute ihn verwundert an, dann huschte ein erleichtertes Lächeln über ihr Gesicht. Ein hübsches Gesicht, würde sie doch nur häufiger lächeln und nicht immer so missmutig dreinblicken. »Kann ich dann jetzt gehen, Vater?«
»Natürlich, Lottchen, geh nur.« Er amüsierte sich königlich, hätte jedoch gut daran getan, es nicht so deutlich zu zeigen. Früher oder später würde sie es ihm unter die Nase reiben.
Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, nahm Samuel die Samtkappe ab, mit der er seit einigen Jahren sein kahles Haupt bedeckte – ihn fröstelte immer so leicht – und legte sie neben sich auf den kleinen Tisch.
Dann bettete er die Füße auf den Hocker und schloss mit einem wohligen Seufzen die Augen.
Er wurde wach, als er die aufgeregten Stimmen seiner Töchter vernahm. Ächzend richtete er sich auf. Wie lange mochte er geschlafen haben? Eine Stunde, zwei?
Er zog seine Taschenuhr aus der Weste und warf einen Blick darauf.
Es war bereits nach zwölf. Zeit fürs Mittagessen.
Sein Magen knurrte in freudiger Erwartung, heute etwas anderes zu bekommen als Kohleintopf.
Die Tür wurde geöffnet und Luise kam herein. »Das Essen ist gleich fertig, Vater. Lotte war auf dem Markt, und als sie am Bunten Fasan vorbeikam, sah sie, wie ein fescher junger Mann aus einer Kutsche stieg«, plapperte seine Tochter, während sie neben ihm her durch den Flur ging. »Er muss einen eigenen Kutscher haben, es war nämlich keine Postkutsche, musst du wissen. Sehr vornehm sah er aus, der feine Herr.«
»Wie kann sie am Bunten Fasan vorbeikommen, wenn sie auf dem Markt war?«, fragte er.
»Sie hat Frau Neuhofer das Medizinfläschchen vorbeigebracht«, erinnerte Luise ihn, und er nickte. Richtig, er hatte Lotte darum gebeten.
Sie kamen in die Küche, wo Charlotte am Herd stand und in einem Topf rührte. Ohne sich umzudrehen, sagte sie: »Eine eigene Kutsche muss man sich schon leisten können.«
»Allerdings.« Luise rückte ihm den Stuhl zurecht und lehnte seinen Stock an den Tisch. »Erzähl Väterchen, wie gut er ausgeschaut hat.«
»O ja, das kann man laut sagen. Elegant gekleidet war er, sogar sein Kutscher war herausgeputzt.« Charlotte kicherte. Es klang ein wenig beschämt. »Ich bin stehen geblieben und hab ihn angestarrt.«
Luise lachte. »Wann kriegt man auch schon mal so ein Mannsbild zu sehen?«
Die beiden warfen sich einen bedeutungsvollen Blick zu.
Sie benehmen sich wie Backfische, dachte Samuel und wusste nicht, ob er amüsiert oder fassungslos sein sollte.
Luise war bereits verheiratet gewesen, mit Theodor Moßdorf, einem Arzt, doch die Ehe war rasch wieder geschieden worden. Charlotte dagegen hatte keinen Mann finden können, den sie ehelichen wollte – möglicherweise war es auch umgekehrt. Sie begründete es damit, dass sie lieber für ihn da sein wollte.
»Wenn ihr zu Ende getratscht habt, würde ich mich freuen, wenn wir endlich essen könnten.« Er hatte es bereits gerochen: Es gab Senfbraten. Den gab es sonst nur sonntags.
Singend lief Charlotte umher und füllte die Teller. »Senfbraten mit weißen Rübchen und dunkler Soße«, trällerte sie. »Genauso, wie du es magst, Vater.«
Luise gluckste. »Du solltest dich sehen, Lotte.«
Charlotte drehte sich zu ihr um, die Wangen gerötet. »Was meinst du?«
»Deine Wangen glühen, und wie deine Augen leuchten! Der feine Herr muss dich ordentlich durcheinandergebracht haben.«
Charlotte wurde feuerrot. Sie schien etwas erwidern zu wollen, tat es jedoch nicht. »Guten Appetit allerseits«, sagte sie stattdessen und setzte sich zu ihnen an den Tisch.
Eine ganze Weile aßen sie schweigend, dann kicherte Charlotte erneut. »Ihr hättet sehen sollen, wie Gerlinde und Heinrich aus dem Haus gerannt kamen. ›Der Herr möchte ein Zimmer für die Nacht?‹ Gekatzbuckelt haben sie, alle beide. Gerlinde hat so oft geknickst, dass ich wetten möchte, dass ihr heut Abend die Knie schmerzen.«
Luise lachte prustend.
»Und als sie gehört hat, dass der fesche junge Mann mehrere Nächte bleiben will, hat sie ausgerufen, dass sie sofort alle Hebel in Bewegung setzen und er das schönste Zimmer in ganz Köthen bekommen wird. Schmeckt es dir, Papa?«
»Es ist sehr gut, Lottchen.« Das leckerste Mahl, das er seit Langem gegessen hatte. Ob der feine fremde Herr seine Tochter beflügelt hatte?
Sie lachte ein glockenhelles Lachen, und er warf ihr einen überraschten Blick zu. »Mir war danach, dich heute ein bisschen zu verwöhnen.«
Erst jetzt ging Samuel auf, dass seine Töchter möglicherweise glaubten, der junge Herr könne auf Brautschau sein.
5. Kapitel
Am Tag darauf saß Samuel wie immer in seinem Ordinationszimmer und blätterte in einem Buch, als es zaghaft klopfte. »Ja?«
Luise kam herein und blieb vor ihm stehen. »Darf ich dich stören, Papa?«
Sie fragte sonst nie, ob sie ihn störte. »Was ist denn, Lieschen? Ich lese, wie du siehst.«
»Draußen ist eine elegante junge Frau«, wisperte sie. »Sie fragt, ob du sie empfangen würdest.«
»Nein. Sag ihr, ich habe heute keine Sprechstunde.«
»Das habe ich bereits, aber sie lässt fragen, ob du eine Ausnahme machen würdest.«
Samuel unterdrückte ein Seufzen. »Na schön.« Er klappte das Buch zu und legte es zu den anderen auf den Stapel. »Bitte sie herein.«
Seine Tochter lief zur Tür und kehrte kurz darauf mit einer strahlend schönen Frau zurück, die in der Tat äußerst elegant gekleidet war. »Monsieur.« Aufrechten Ganges kam sie ins Zimmer und zog im Gehen ihre weißen Handschuhe aus. »Ich hörte, dass Sie der französischen Sprache mächtig sind«, sagte sie auf Französisch, und er nickte. »Merci, dass Sie mich anhören wollen.«
»Woher kommen Sie, Mademoiselle? Oder Madame?«, fragte er auf Französisch.
»Aus Paris. Sie beherrschen meine geliebte Sprache sehr gut, Monsieur Hahnemann. Und bitte Mademoiselle. Mein Name ist Marie Mélanie d’Hervilly.«
»Mademoiselle d’Hervilly.« Er kam nicht umhin, sie fortwährend anzuschauen und anzulächeln. »Ich spreche mehrere Sprachen, es hat mir stets Freude gemacht, sie zu erlernen.«
»Welche Sprachen beherrschen Sie noch?«, fragte sie interessiert.
»Englisch, Griechisch und natürlich Latein.«
Sie schien beeindruckt. Dann räusperte sie sich kurz, bevor sie fortfuhr. »Ich habe eine mehr als zweiwöchige Fahrt auf mich genommen, um Sie zu sehen.« Sie lachte leise, und Samuel stellte verblüfft fest, wie ihn dieses Lachen gefangen nahm. »Pardon, das muss sich seltsam für Sie anhören, Monsieur. Ich hatte sagen wollen: Ich bin unendlich froh, mit Ihnen sprechen zu dürfen.« Sie nahm Platz, bevor er sie bitten konnte, sich zu setzen.
Eine selbstbewusste junge Dame, dachte er amüsiert.
Ein wenig verstohlen musterte er sie. Sie war ungewöhnlich groß für eine Frau, sie hatte den Hut abgenommen und richtete mit einer Hand ihre Frisur. Ihr Haar war blond, und Samuel stellte sich für einen winzigen Augenblick vor, wie er die Hand ausstrecken und über ihre Locken streichen würde.
Alter Narr, schalt er sich. »Was führt Sie den weiten Weg zu mir, Mademoiselle d’Hervilly.«
»Darf ich zuerst meinen Umhang ablegen?«
Samuel wollte aufstehen und ihr behilflich sein. »Pardon, Mademoiselle. Normalerweise nimmt meine Tochter meinen Patienten die Garderobe ab.« Er ärgerte sich über Luises und auch seine Unaufmerksamkeit.
Noch bevor er sich erheben konnte, hatte Mademoiselle d’Hervilly ihren dunklen Wollumhang gelöst und war aufgestanden. »Wo darf ich ihn ablegen?«
Samuel zeigte hinter sie. »Dort auf den Stuhl, bitte.«
Es schien ihr nicht das Geringste auszumachen, dass sie es selbst erledigen musste.
Nachdem sie sich wieder gesetzt hatte, kam sie sofort auf den Punkt. »Ich leide seit mehr als drei Jahren unter unerklärlichen Leibschmerzen. Unerklärlich deswegen, weil die Doktoren mich aufgegeben haben.«
Samuel verkniff sich ein Schnauben. Das sah der Ärzteschaft ähnlich, er war keineswegs überrascht. Er bat Mademoiselle d’Hervilly, ihm die Schmerzen genauer zu beschreiben und notierte sich zunächst ihren wohlklingenden Namen, während sie berichtete.
Sie hatte die Hand auf ihre rechte Unterbauchseite gelegt. »Dort sitzt der Schmerz. Als er das erste Mal kam, dachte ich, ich hätte nur etwas Falsches gegessen. Doch er kam wieder, diesmal sogar noch heftiger. Es ist ein Ziehen und Pochen, manchmal drückt es von innen, als befände sich dort etwas, das nicht hineingehört.« Sie errötete leicht. »Ich weiß, wie furchtbar töricht das klingt …«
Samuel schüttelte den Kopf. »Nein, Mademoiselle, für mich klingt das nicht töricht. Ich bat Sie um eine möglichst präzise Beschreibung, damit ich mir ein Bild machen kann. Gibt es Unverträglichkeiten, Nahrung, die Sie schlecht vertragen, Allergien?«
»Non, nichts dergleichen.«