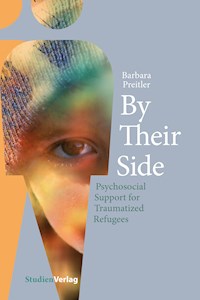Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ich will helfen!" Das denken sich viele angesichts der Situation zahlloser geflüchteter Menschen, die in anderen Ländern Schutz suchen müssen. Und sie stellen sich die Frage: Wie gehe ich richtig mit traumatisierten Menschen um? Wie baue ich ein Vertrauensverhältnis auf? Und wie kann die Begegnung funktionieren? Das vorliegende Buch widmet sich genau jenen Fragen, ist Ratgeber und Leitfaden für freiwillige und ehrenamtliche HelferInnen und bietet Grundlage für einen funktionierenden Umgang mit geflohenen Menschen. Auf einfache und verständliche Weise vermittelt die Autorin Barbara Preitler Grundwissen zur Traumatisierung und Flucht aus psychologischer Sicht und zeigt Möglichkeiten zum Verständnis und für Handlungsmöglichkeiten in der zwischenmenschlichen Begegnung auf. Ziel ist es, Mut zu machen, die Begegnung zu wagen, und Beziehungen zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Lebensgeschichten zu ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Barbara Preitler
An ihrer Seite sein
Barbara Preitler
An ihrer Seite sein
Psychosoziale Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Klaus Ottomeyer
Einleitung
1. Flucht – psychische Verletzungen, psychische Stärke
Heilsame Beziehungen
Posttraumatische Belastung
Kritische Anmerkungen zur PTBS
Latenzzeit – Zeit der inneren Ruhe
Schmerzhafte Erinnerungen – Zuhören hilft
Möglichkeiten der Distanzierung
Distanzierung von Alpträumen
Innere HelferInnen
Beruhigung
Konzentrations- und Merkstörungen
Traumatische Erlebnisse können ein Leben lang wirksam sein
Kohärenzgefühl
2. Zehn Folgen von Traumatisierungen und wie wir diesen in der psychosozialen Arbeit begegnen können
2.1 Chaos – Sicherheit
Chaos – Zusammenbruch aller Sicherheiten
Sichere Begegnungen
Informationen geben Sicherheit
Sichere Beziehungen
Vertrauen in einen sicheren Ort
Sichere Umwelt
Sicherheit in die eigene Person wiedergewinnen
Innere und äußere Sicherheit
2.2 Kontrollverlust – Wiederherstellung von Kontrolle
Verlust von Kontrolle in traumatischen Situationen
Information hilft Situationen zu kontrollieren
Den gegebenen Raum gut nutzen
Kommunikation mit den Angehörigen
Kontrolle über den eigenen Körper
Sportliche Aktivitäten
Schmerz und Schlafstörungen kontrollieren
2.3 Grenzverletzung – Wiedergewinnen von guten Grenzen
Trauma und Grenzen
Konsequenzen von Grenzverletzungen
Re-Etablierung von Grenzen
Klare Rahmenbedingungen
Selbstreflexion der HelferInnen
Kulturelle Unterschiede – gute Mittelwege finden
Vermeidung von Beziehungsabbruch
2.4 Sprachlosigkeit – Rückgewinnung von Kommunikation
Trauma fragmentiert Sprache
Das Namenlose benennen
Verlust von Sprache
Zusammenhänge in den Fragmenten finden
Die Wichtigkeit des Erzählens
Re-Inszenierungen verstehen und zuordnen
Die Hilfe der Imagination – oder was ist objektive Realität?
Das Interview im Asylverfahren
Neue Sprache als neue Möglichkeit des Ausdrucks
2.5 Schmerz – Verständnis und Strategien des Schmerzmanagements
Schmerz im Krieg und auf der Flucht
Schmerz als Folge von Menschenrechtsverletzungen
Schmerz und Kontrolle
Reden dürfen
Schmerz ohne medizinische Evidenz
Schmerz als Symbol des Erlittenen
Wunden dürfen nicht heilen, solange das Asylverfahren offen ist
Selbstverletzung als Möglichkeit sich selbst zu spüren
Schmerz und Kommunikation
2.6 Aggression – anerkennen, zuordnen und Aggressionskontrolle
Anerkennen
Wem gehört die Aggression?
Strategien, mit der Aggression umzugehen
Externe Ich-Kontrolle
Grenzen geben Sicherheit
Transformation
2.7 Schuld und Schuldgefühle – Verstehen, Annehmen, Trauer
Schuldgefühle
Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen
Religiöse Rituale
Weitere Rituale
2.8 Verletzter Selbstwert – Selbstwert stärken
Verletzung des Selbstwerts
Reinigungsrituale
Selbstverteidigung
Künstlerischer Ausdruck
Anerkennen und positives Feedback
Sichere Orte der Regression, um wieder selbstsicher werden zu können
2.9 Verlust – Trauer
Trauer – die lebensnotwendige Reaktion auf Verlust
Gelungene Integration der Trauer
Trauervermeidung
Trauer braucht Rituale
Rituale nachholen
Rituale modifizieren
Rituale neu erfinden
Trauer begleiten
Die schwierige Situation der Angehörigen von „Verschwundenen“
2.10 Regression – Begleitung zurück zu altersadäquaten Bewältigungsformen
Regression als Antwort auf Gewalt und Flucht
Abholen auf Augenhöhe
Rückgewinnung eines altersentsprechenden Lebens
Subsidiaritätsprinzip
Übergangsobjekte
Integration in einen neuen Sprach- und Kulturraum
2.11 Zusammenfassung: Hilflosigkeit – Empowerment
Erweiterte Kapitel
3. Der/die Dritte im Bunde – Die Kommunikation mit DolmetscherInnen
Interaktion zwischen KlientIn und HelferIn
Interaktion zwischen DolmetscherIn und HelferIn
Interaktion zwischen DolmetscherIn und KlientIn
Interaktion zwischen KlientIn, DolmetscherIn und HelferIn
Ein Dankeschön an all unsere DolmetscherInnen
4. Leitfaden für Outdoor-Aktivitäten mit Flüchtlingen
Ermächtigung als Antwort auf Hilflosigkeit
Aktiv sein, gewinnen können!
Gefahr von Re-Traumatisierungen
Re-Traumatisierung vorbeugen
Wenn jemand in traumatische Vorerfahrungen abgleitet
Selbstwert stärken – einander vertrauen
5. Verletzte Kinder – Starke Kinder
Traumatische Belastungen
Trauma und Trauer
Sichere Orte und Beziehungen
6. Schlussbemerkungen
Literatur
Anhang
Informationen zu rechtlichen und sozialen Fragen
NIPE – Netzwerk für Interkulturelle Psychotherapie nach Extremtraumatisierungen
Information bei Akuten Krisen
Vorwort
Klaus Ottomeyer
Das vorliegende Buch wird gerade jetzt dringend gebraucht und es wird gerade in dem Format und in der verständlichen Form dringend gebraucht, in dem es abgefasst wurde. Man muss schon jahrzehntelange Erfahrung in der Begegnung mit extrem traumatisierten Menschen aus verschiedenen Weltregionen und zugleich einen umfassenden Überblick über die internationale Forschung zum Thema haben, damit ein Text entstehen kann, der so gut lesbar, emotional eindrücklich und praxisnah ist.
„Emotional eindrücklich“ heißt, dass der schwierige Versuch der Einfühlung in die von den Flüchtlingen erlebten Schrecknisse und albtraumartigen Erfahrungen so weit gelungen ist, wie er aus der Sicht der PraktikerInnen und interessierten Menschen, die sich mit dem extremen Trauma befassen wollen, überhaupt gelingen kann. Die Geschichten und Fallvignetten, welche Barbara Preitler in ihre Erklärungen und den Leitfaden eingebaut hat, sind für die LeserInnen „gerade richtig dosiert“ und führen nicht zu dem lähmenden Schrecken, der mit einer Überdosierung oder einer falschen Wortwahl in Bezug auf Traumata leicht verbunden sein kann. Der lähmende Schrecken führt dann erst recht zur Abwehr und Verleugnung des Traumatischen, des real gewordenen Albtraums und der „Abgrunderfahrung“ – einer Abwendung, zu der wir alle (auch die Professionellen) in der Lage sind, wenn wir den Schrecken nicht aushalten. Eine solche Abwendung hat es ruckartig nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht 2015/2016 gegeben – so als hätte etwas in uns schon darauf gewartet, den belastenden Versuchen der Einfühlung in das unsägliche Leid der Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und anderen Ländern ein Ende zu setzen. Nachdem im Sommer und Herbst des Jahres 2015 viele die im Konsumkapitalismus weitgehend unbekannte Erfahrung machen konnten, wie gut und kraftgebend es sich anfühlt, mit dem Rückenwind des Über-Ichs oder des Gewissens zu handeln, wurde spätestens zu Jahresbeginn „Gutmensch“ wieder zu einem Schimpfwort. Es wurde, wie bereits schon einmal vor 20 Jahren, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise infolge der jugoslawischen Kriege, zum Unwort des Jahres gewählt.
Die Veränderung der Sprache im Dienste der neuerlichen Verhärtung und Gewissensabwehr hat manchmal etwas Orwellhaftes. Die „australische Lösung“ einer abschreckenden Gefangensetzung von aufgegriffenen Flüchtlingen auf irgendwelchen Inseln im Mittelmeer gilt als menschenfreundliche Maßnahme zu Verhinderung von weiterem Leid und Tod durch Ertrinken. Wehrhaftigkeit und die Anschaffung von Waffen, zu denen man sich „bekennt“, gelten als Vorbereitung auf die neuen Herausforderungen. Politiker bereiten uns in einer Art von neuem Heroismus darauf vor, dass wir auf schreckliche Bilder von weinenden Kindern vor den Grenzzäunen gefasst sein müssen und uns von ihren Gesichtern nicht erpressen lassen dürfen. In Wirklichkeit zielt diese Rhetorik auf die Abwehr des eigenen Gewissens, das so gut wie alle Menschen noch haben.
Den Hilfsprojekten unter dem Motto „Wir schaffen das“ wurde vielfach das Scheitern vorausgesagt. Die Situation werde bald „kippen“. Aber das Scheitern und das massenhafte Burnout sind nicht eingetreten. Wenn ehrenamtliche HelferInnen erschöpft sind, machen sie einfach eine Pause. Einige hören auch auf. Aber dafür kommen neue. Neue professionelle und ehrenamtliche HelferInnen werden eingeschult und erhalten Supervision und Fortbildung – zum Beispiel durch ExpertInnen wie Barbara Preitler. Nicht wenige sind dankbar für die wichtige Arbeit, die sie machen dürfen. Gerade auch angesichts der Häufung von Amokläufen und islamistischen Attentaten im Sommer 2016, an denen einzelne Flüchtlinge und junge Migranten der zweiten Generation beteiligt sind, haben wir auch gar keine andere Wahl, als die psychosozialen Hilfsprojekte für Kriegsflüchtlinge und Folterüberlebende wirksam zu unterstützen und auszubauen. Die geduldigen Bemühungen um Einfühlung, um Beruhigung und um gezielte Selbstwertstärkung für Flüchtlinge nach den traumatischen Erfahrungen, die viele von ihnen gemacht haben, sind auch ein Beitrag zur Gewaltprävention. Explosive Racheaktionen, die sich gegen eine vermeintlich heile Umwelt richten, können auch eine Art „Schiefheilung“ von unbehandelten Traumata und persönlichen Kränkungen sein.
Der Ton von Barbara Preitlers Darstellungen ist, das werden die LeserInnen bald merken, angenehm beruhigend und zeigt uns allen, dass „man etwas machen“ kann. Lamentieren hilft nicht. Man muss die traumatisierten Flüchtlinge auch nicht zu den weit entfernten Psycho-ExpertInnen schicken – was früher oft passiert ist und auch eine Form der Trauma-Abwehr sein kann. Das traumapsychologische und traumatherapeutische Wissen ist inzwischen so gut abgesichert und durch zahlreiche Erfahrungen konkretisiert, dass es auch von anderen Berufsgruppen und von ehrenamtlich Tätigen aufgenommen und kreativ angewendet werden kann. Einiges können nur ausgebildete TraumatherapeutInnen machen, etwa die sogenannte Trauma-Exposition oder Trauma-Konfrontation, mit dem Ziel einer methodisch behutsamen Reintegration der zuvor abgespaltenen Horrorerfahrungen in die Lebensgeschichte einer Patientin oder eines Patienten. (Es hat zumeist gute Gründe gegeben, die schrecklichen Erfahrungen erst einmal abzuspalten.) Aber Ressourcenstärkung, Trösten, Loben, Verstehen der Trauma-Verarbeitungsmechanismen und das schlichte „Aushalten“ eines Menschen, der die Hölle erlebt hat – das können auch viele andere, die Mut zur Begegnung haben. Auf Rückschläge muss man gefasst sein. Fast immer kann man sich heutzutage fachlichen Rat holen. Inzwischen gibt es z. B. eine eigene Traumapädagogik, die auf den Ergebnissen der psychologischen und psychotherapeutischen Traumaforschung beruht, aber eigenständig arbeitet. Zahlreiche Organisationen sind bemüht, Flüchtlingen auf eine traumasensible Weise zu einem neuen Selbstbewusstsein zu verhelfen. Ich hatte und habe das Glück, mit Barbara Preitler über viele Jahre hinweg zusammenzuarbeiten. Sie gibt auch in Krisenzeiten und Krisengebieten nicht auf. Ich wünsche dem Buch eine möglichst große Verbreitung.
Einleitung
Seit einigen Monaten bin ich immer froh, wenn in den Nachrichten einmal nicht über Flüchtlinge gesprochen wird. Das war noch vor kurzer Zeit anders: Wir haben uns mehr öffentliche Aufmerksamkeit für unsere KlientInnen gewünscht. Sie sollten aus einer kaum wahrgenommenen Ecke herauskommen und damit sollte auch das Verständnis für die Flüchtlinge größer werden – so die Annahme.
Aber die Bilder, die von Flüchtlingen gezeichnet werden, sind meist schwarz oder weiß, lassen ein differenziertes Verständnis nicht zu. So ist im Frühling 2015 das Bild derer, die mittels Schlepper illegal in die EU einreisen, ein negativ gefärbtes: illegal, Wirtschaftsflüchtling, Asylmissbrauch sind die dazugehörigen Schlagwörter. Und dann sterben 71 Menschen bei dem Versuch, illegal nach Österreich zu kommen auf unglaublich brutale Weise, eingepfercht in einen LKW. Kurz darauf sehen wir das Bild des am Strand liegenden ertrunken kleinen Jungen, gestorben, wie auch sein nur etwas größerer Bruder und seine Mutter, beim Versuch aus der umkämpften Stadt Kobane ins sichere Europa zu entkommen. Und auf einmal gibt es die Willkommenskultur als Phänomen in mehreren europäischen Ländern. Vielen reicht es mit der Verunglimpfung von Schutzsuchenden. Auf einmal hat sich die öffentliche Stimmung gedreht. Menschen engagieren sich, Geschichten von berührenden und positiven Begegnungen werden erzählt und publiziert. Das Bild von der großen Verständigung ist schön, blendet aber doch wieder einen Teil der Realität aus. Dieser dunkle, verstörende Teil wird schlagartig hochgespielt, als sexuelle Übergriffe von Migranten auf Frauen in Deutschland in der Silvesternacht 2015/16 bekannt werden. Wie weggewischt ist auf einmal das große Verständnis für Flüchtlinge. Und wer doch noch etwas dagegen sagt oder schreibt, wird als „Lügenpresse“ verunglimpft. Selbst die fast täglich eintreffenden Berichte über ertrunkene Kinder können nichts mehr daran ändern – Flüchtlinge werden als gefährlich wahrgenommen, Selbstschutz vor der vermeintlichen Gefahr steht unhinterfragt im Mittelpunkt. Gebetsmühlenartig wird unsere Überforderung medial beschworen.
Daran, dass die Gesellschaft im Allgemeinen überfordert ist, kann ich, seit über 20 Jahren in der Arbeit mit Flüchtlingen in Österreich tätig, einfach nicht glauben. Statistiken und Analysen zeigen einen Anstieg der Flüchtlingszahlen, aber weit entfernt von dem, was Anrainerstaaten im Nahen Osten und Afrika stemmen. Der Türkei muten wir drei Millionen Flüchtlinge zu und ganz EU-Europa ist mit knapp einer Million überfordert? Die Bankenrettungen dürfen Milliarden kosten ohne dass viel darüber geredet wird, aber die Versorgung von schutzlosen Menschen führt uns an den Rand des Ruins?
Überforderung nehme ich schon wahr, aber woanders: Viele, die sich für Flüchtlinge engagieren, brauchen Unterstützung und Know-how, um mit den Problemen, die diese Menschen mitbringen und denen sie auch hier in Europa ausgesetzt sind, umgehen zu können. Es braucht Hilfestellung, um das Miteinander zwischen den Neuangekommenen und denen, die sie willkommen heißen, zu unterstützen – und so Überforderung zu vermeiden.
Flüchtlinge sind normale Menschen. In einer so großen Gruppe finden wir alle Ausprägungen, die menschliches Dasein hervorbringt. Gemeinsam ist allen, dass sie existenziellen Stress erlebt haben und zum Teil nach wie vor erleben. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie extrem viel Aggression und Gewalt ausgesetzt waren. Gemeinsam ist fast allen, dass die Lebensart und Kultur in Europa sehr verwirrend ist und es schwerfällt, sich in einem so anderen Alltag zurechtzufinden. Aber wie sie mit diesen Erfahrungen und mit ihren Hoffnungen und Erwartungen an Europa umgehen, ist so verschieden, wie Menschen eben verschieden sein können.
Die Herausforderung war und ist sicher da – aber vielleicht geht es ja um ein realistischeres Bild der Flüchtlinge und um das Wissen, was die Ursachen für gewisse Verhaltensweisen sein könnten.
Was lässt sich also sagen über die Gemeinsamkeiten dieser Menschen, die in den letzten Monaten zu uns nach Europa gekommen sind? Aus meiner nun mehr als 20-jährigen Erfahrung als Psychotherapeutin für schwer traumatisierte Flüchtlinge, aus Einsätzen in Krisengebieten in Asien und der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dieser Thematik will ich in diesem Buch versuchen, einen kompakten Überblick über die großen Problemfelder zu geben, Erklärungsmodelle, wie dies zu verstehen ist, anbieten und verschiedene mögliche Handlungsansätze vorstellen.
Trauma heißt übersetzt (aus dem griechischen) Wunde, Verletzung. Ein Begriff aus der Medizin wurde in die Psychologie übernommen und lässt sich auch vielfach gut übertragen.
Und so wie ein Mensch, der sich das Bein gebrochen hat, trotz dieser Verletzung der gleiche Gesprächspartner bleibt, wie vor der Verletzung, so gilt dies auch für psychisch verletzte, traumatisierte Menschen. Allerdings wird der Freund mit Beinbruch für einige Zeit kein idealer Wanderpartner sein. Es gilt herauszufinden, wo der psychisch verletzte Mensch für einige Zeit nicht „mitgehen“ kann. Das wird natürlich etwas schwieriger: Ist das gebrochene Bein aufgrund des Gipsverbands gut sichtbar, so ist es die psychische Verwundung nicht und muss erst verstanden werden – von den Außenstehenden, aber auch vom verletzten Menschen selbst.
Traumatisierungen heißen also nicht, dass Menschen per se andere Umgangsformen brauchen als Menschen, die nicht traumatisiert sind. Wichtig ist genaues Hinhören und ein respektvoller Umgang. Dieses Buch soll Mut machen einander zu begegnen – rücksichtsvoll und offen. Fertige Lösungen habe ich keine anzubieten, hingegen Hintergrundwissen und viele Beispiele und Ideen, was schon gelungen ist und möglicherweise auch in anderen Fällen hilfreich sein kann, zusammengetragen.
1. Flucht – psychische Verletzungen, psychische Stärke
Heilsame Beziehungen
Menschen, die durch andere Menschen schwer verletzt worden sind, brauchen vor allem eines: heilsame Beziehungen. Und diese können überall dort stattfinden, wo Menschen einander begegnen.
Im Rahmen der Posttraumatischen Belastungsstörung kennen wir die Vermeidung von „Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten“ (ICD 10). Zur Erklärung dieses Phänomens ist es leichter, kurz zu anderen Auslösern von traumatischen Erlebnissen zu wechseln, wie Naturkatastrophen. Nach dem großen Tsunami von 2004 wussten alle, dass Menschen, die diese schreckliche Flut erlebt haben, Angst vor dem Meer oder großen Gewässern haben werden. Es brauchte gar keine ExpertInnen, die erklären mussten, was psychologisch vorgeht – es ist ureigenes menschliches Wissen, dass wir vermeiden, was uns verletzt hat. Und im Fall des Tsunamis war es eben das Meer. Und wir verstehen auch, dass die Überlebenden nicht nur Angst vor dem indischen Ozean in Thailand, Indonesien oder Sri Lanka haben, sondern sich diese Vermeidung auch auf den Atlantik, das Mittelmeer und vielleicht sogar auf den Bodensee oder Wörthersee erweitern kann.
Was ist aber, wenn es nicht die Verschiebung von Erdplatten und das Meer ist, das die schwere psychische Verletzung verursacht, sondern andere Menschen? Es ist schon erstaunlich, dass wir hier viel mehr Schwierigkeiten haben, Vermeidung zu verstehen. Tatsächlich ist die Angst vor anderen Menschen, die in irgendeiner Form an die TäterInnen erinnern, ein häufiges Phänomen nach Traumatisierungen. Dies können z.B. Menschen in Uniform sein oder alle Menschen, die eine bestimmte Sprache sprechen oder auch Menschen einer ethnische Gruppe oder eines Geschlechts. Im schlimmsten Fall wird ganz generalisiert und die Angst umfasst alle Menschen.
Gehen wir nochmals zurück zur Naturkatastrophe, dem Tsunami. Wer die Katastrophe als mitteleuropäische/r Tourist/in überlebt hat, kann die Vermeidung aufrechterhalten. Ein erfülltes Leben ist durchaus möglich, ohne jemals wieder ans Meer fahren zu müssen. Der Alltag findet im Binnenland statt und Urlaube können in den Bergen, am Land oder in Städten verbracht werden. Aber für Fischerfamilien, die ihr Haus in unmittelbarer Nähe zum Strand hatten, sieht es anders aus: Die Vermeidung des Meeres würde sie ihrer Erwerbsmöglichkeiten, ihrer Wohnung und ihrer Heimat berauben. Es braucht also Strategien, um wieder am Meer leben zu können.
Ähnlich ist es, wenn Menschen die Ursache der schweren Traumatisierungen waren: Es braucht Strategien, um wieder unter Menschen leben zu können, um nicht in die soziale Isolation gehen zu müssen.
Das Bild einer Balkenwaage kann hier hilfreich sein: Eine schwere Traumatisierung fällt wie ein ganz schweres Gewicht in die eine Waagschale, alltägliche Erfahrungen auf der anderen Seite hingegen sind Leichtgewichte. Es braucht also sehr viele ganz normale, alltägliche Erfahrungen, um wieder in Balance zu kommen. Gute Begegnungen wiegen schon etwas schwerer. Und so können heilsame Beziehungen zu anderen Menschen, wo immer sie stattfinden, wichtige Bausteine für ein gutes Leben nach traumatischen Ereignissen werden.
Psychotherapie stellt per Definition eine Begegnung zweier Menschen dar, die diese heilsame Beziehung in den Mittelpunkt stellt. Aber heilsame Beziehungen bzw. Begegnungen können überall dort stattfinden, wo Menschen aufeinandertreffen.
Manchmal sind es nur kurze Begegnungen, die als Kraftquelle in schwierigen Zeiten helfen können. So hat es mich berührt, dass mehrere meiner KlientInnen berichtet haben, dass sie in Zeiten, als es den Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres an der grünen Grenze zwischen Österreich und Ungarn gab, von den österreichischen Grundwehrdienern so gut in Empfang genommen worden sind. Auch viele Jahre später wurde dieser freundliche Empfang durch die jungen Soldaten von vielen als besonderer Moment beschrieben und erlebt. Für wenige Stunden haben sie sich willkommen und als Menschen mit Bedürfnissen ernst genommen gefühlt. Diese schöne Erfahrung konnte als Kraftquelle genutzt werden, als es danach wieder schwierig und belastend geworden ist.
Neu angekommene Flüchtlinge berichten, wie schlimm es war, nur mehr Teil einer großen Masse gewesen zu sein und das Gefühl gehabt zu haben, als individueller Mensch nichts mehr zu zählen. Wie gut war es dann, wenn eine Helferin einmal freundlich war, nach den Namen gefragt hat und wie es derzeit geht, oder wenn ein Helfer sich ernsthaft um die schmerzenden Füße gekümmert hat und nicht vermittelt hat, dass dies jetzt nur den geregelten Ablauf stört!
Diese kurzen Begegnungen sind wie Oasen, die das psychische Überleben gesichert haben und auch noch Jahre später in guter Erinnerung sein können.
Posttraumatische Belastung
Die Diagnose der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ (PTBS) stellt die psychiatrische/psychologische Hauptdiagnose für traumatisierte Flüchtlinge dar. Erstmals wurde sie im Diagnosemanual der American Psychiatric Association (APA) im Jahr 1980 (DSM III-R) beschrieben und zuletzt im Jahr 2013 in der Revision des Manuals, dem DSM V modifiziert. (APA, 2013)
Symptome in den vier Hauptsymptomgruppen:
1. quälende Erinnerungen an das traumatische Geschehen (tagsüber und nachts),
2. Vermeidung dieser schmerzhaften Erinnerung und von allem, was diese auslösen könnte,
3. Übererregung,
4. negative Gefühle wie tiefe Traurigkeit, Verzweiflung, Gefühle der inneren Leere, keine Zukunftsperspektive
kennen wir von fast allen unserer KlientInnen.
Mit der Diagnose haben wir eine gemeinsame Sprache gefunden, die nicht nur innerhalb des medizinischen/psychologischen Betreuungsteams Verwendung findet, sondern auch einen Konsens mit Behörden und betreuenden NGOs darstellt und, vielleicht sogar am wichtigsten, mit den KlientInnen selbst.
Viele können die psychische Symptomatik nicht zuordnen und haben Angst, dass sie ein weiterer Schicksalsschlag getroffen hat und sie jetzt psychisch krank geworden sind. Die Erklärung der Diagnose ist daher sehr entlastend: Es gibt einen Namen für das, was jetzt erlebt wird, es ist nichts, was zusätzlich passiert, sondern die Reaktion auf in der Vergangenheit Geschehenes. Es ist eine Verletzung, keine Erkrankung! Die Gewalt, der die betroffene Person ausgesetzt war, war so groß, dass es zu Verwundungen gekommen ist, auch wenn die dazu gehörenden Symptome und Schmerzen erst mit Verzögerung spürbar geworden sind.
Psychoedukation, im Sinne einer Erklärung was eine Posttraumatische Belastung ist und wie sie sich auswirkt, stellt daher eine wichtige Entlastung für die Betroffenen dar.
Kritische Anmerkungen zur PTBS
Aber es gibt auch viele kritische Anmerkungen zu dieser Diagnose zu machen. Es beginnt bereits beim Namen. Der vierte Buchstabe, das „S“ in der PTBS, steht für Störung. Wir sagen mit der Diagnose also der betroffenen Person, dass sie eine Störung hat. Meiner Meinung nach ist dies eine Entwertung der Opfer und auch eine Opfer/TäterInnen-Verschiebung. Ja, es gab eine Störung. Die liegt aber bei Menschenrechtsverletzungen immer bei den TäterInnen und nicht bei den Menschen, die aufgrund der ausgeübten Gewalt verletzt worden sind! Traumatische Reaktionen sind normale Reaktionen auf abnormale, gestörte Gewalt.
Auch das „P“ für „post“ muss in der Arbeit mit AsylwerberInnen hinterfragt werden: Post – danach – suggeriert, dass die traumatische Situation vorbei und abgeschlossen ist. Aber gerade AsylwerberInnen wissen nicht, ob sie nicht wieder in die Krisenregion zurückmüssen, sie wieder erneut gleichen oder ähnlichen Situationen ausgesetzt werden. Ihre Lebenssituation ist von massivem akutem Stress gekennzeichnet. Es gibt nicht genug Energie, um sich mit den traumatischen Erfahrungen, die zur Flucht geführt haben, auseinanderzusetzen. Aber auch dann, wenn nach wie vor Angehörige in der Krisenregion leben, kommt es immer wieder zur Aktualisierung der Traumata. Es bleibt oft ein frommer Wunsch, dass für unsere KlientInnen die traumatischen Situationen bereits vorbei sind und sie sich nun an die psychische Bewältigung der Vergangenheit machen könnten. Jede Form der therapeutischen und der psychosozialen Aufarbeitung der traumatischen Vergangenheit wird durch akute Stresssituationen immer wieder erschwert.
Latenzzeit – Zeit der inneren Ruhe
Unmittelbar nach traumatischen Ereignissen kommt es zur akuten Belastungsreaktion. Diese wäre grundsätzlich diagnostizierbar, wird aber fast nie gebraucht. Es ist viel zu klar und menschlich verständlich, dass Menschen auf belastende Reaktionen unmittelbar mit Zittern, Erstarren, Weinen etc. reagieren.
Nach der akuten Belastung kommt es bei vielen Menschen zu einer Zeit, in der sie psychisch relativ stabil mit der Situation umgehen können, gerade dann, wenn viel zu tun ist, die ganze Aufmerksamkeit dem Alltag gewidmet werden muss. Diese Zeit ohne Symptome der posttraumatischen Belastung wird als Latenzzeit beschrieben. Dies gilt natürlich auch für Menschen auf der Flucht. Jeder Tag erfordert Anpassung an eine neue Situation, für Gedanken an die Vergangenheit gibt es keinen Raum und keine Energie. Aber nach einiger Zeit – und dies kann auch einen sehr langen Zeitraum umfassen – werden die alten traumatischen Erfahrungen wieder zentral: in den Erinnerungen und den Versuchen, diese zu vermeiden. Nervosität, Traurigkeit, Konzentrations- und Merkstörungen treten auf und beeinträchtigen den Alltag. Die Latenzzeit ist vorbei, es kommt zu Posttraumatischen Belastungen und Leiden.
Die Latenzzeit kann individuell sehr verschieden sein. Spätestens seit die Holocaustüberlebenden alt geworden sind, wissen wir, dass diese sogar mehrere Jahrzehnte umfassen kann. Viele, die die Shoa als Jugendliche oder junge Erwachsene überlebt haben und danach „mit beiden Beinen“ im Leben gestanden sind, entwickelten mit dem Einsetzen des Alters eine PTBS. Oft war es ein Lebensereignis wie das Erreichen des Pensionsalters, der Auszug des letzten Kindes, das sie auf die unbewältigten traumatischen Erlebnisse zurückgeworfen hat.
„Wir haben so viel gearbeitet und am Abend war ich immer so müde, dass ich schon geschlafen habe, bevor mein Kopf den Polster berührt hat“, beschreibt eine Klientin die aktiven Jahrzehnte, nachdem sie das Arbeitslager überlebt hatte. Aber im Alter kamen viele körperliche Erkrankungen, die sie dazu zwangen, weniger aktiv zu sein. Mit der körperlichen Ruhe tauchten die Bilder der extrem schwierigen Kindheit und Jugend auf. Sie fühlte sich den alten Erinnerungen an massive Menschenrechtsverletzungen, der Ermordung des Vaters, der Verzweiflung der Mutter, dem Gefühl des Hungers, der Angst … ausgeliefert. Die Symptomatik der schmerzhaften Erinnerungen, der Vermeidung, der Übererregtheit waren alle auch so viele Jahre später vorhanden.
Der therapeutische Prozess war allerdings ein ganz anderer als der mit Menschen, deren traumatische Erlebnisse Wochen oder Monate zurückliegen. Immer wieder ging es um die gesamte Lebensgeschichte und um die Anerkennung, es trotz dieser schweren traumatischen Erfahrungen geschafft zu haben, viel Gutes im Leben danach geleistet zu haben. Genaues Zuhören und Interesse an der gesamten Biografie sind hier zentrale Momente.
Schmerzhafte Erinnerungen – zuhören hilft
Die Erinnerung an schwere traumatische Erfahrungen kann sehr aufdringlich sein und trotz intensiver Versuche, sie zu unterdrücken, massiv in den Alltag Einfluss nehmen. Das kann in Form von schmerzhaften Erinnerungen passieren. Betroffene beschreiben diese als „Wie ein Schleier der sich über das ganze Leben legt“ oder das Bild von damals ist „wie in die Netzhaut eingebrannt“.