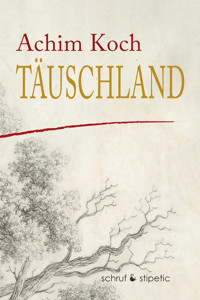Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist man Deutscher oder Däne? Unter den Bewohnern einer norddeutschen Kleinstadt entwickelt sich vor mehr als 150 Jahren sehr langsam eine bisher nicht gekannte Feindschaft. Sie macht Freunde und selbst Familienangehörige zu Gegnern, die sich eines Tages sogar in Kriegen gegenüberstehen. Diese Feinschaft wird geschürt durch die Jagd auf archäplogische Dokumente, die mit einem Segelschiff im Mahlsand vor der Küste verschollen sind. Dem Geheimnis dieser Papiere ist nicht nur die Bevölkerung der kleinen Stast auf der Spur, sondern es wird zu einer staatlichen Angelegenheit erklärt. All das wirkt sich aus bis nach Kopenhagen, London, Paris und Ägypten. Die Bewohner der Stadt geraten in kurzer Zeit in die Sphären europäischer Politikinteressen und werden letztlich zu Opfern höherer Politik, deren Ideologie sie zuvor selbst mit großer Überzeugung verbreitet hatten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
An Willem
Titel SeiteAchim Koch An Willem
„E tukamst hiirt e dåmp.“
Momme Pedersen, 1826
1. Kleine Schritte zu mir
Nun wird es bald dunkel werden.
Ich liebe es, zu beobachten, wie das Licht langsam nachlässt. Bei dieser Dunkelheit und morgens in der schwachen Hellzeit spüre ich die vergangenen Jahre am besten.
In diesem Raum, den niemand außer Thor kennt, habe ich alles gehütet. Auch das alte Schießgerät von Anders. Es ist - wie immer - sauber geputzt und liegt glänzend vor mir auf dem grünen Filz. Lange hatte es eine gleichberechtigte Bedeutung mit den vielen anderen Dingen, die ich hier aufbewahre. Doch heute Abend strahlt es eine besondere Stärke aus, einnehmender als je zuvor.
Alles andere ist nur um es herum.
Der Tag, an dem Anders geboren wurde, blieb einigen als ein besonderer Tag in Erinnerung. Ich war damals noch nicht einmal gedacht.
Für seine Mutter Sieke war es wie für alle, fast alle, gewordenen Mütter der glückliche Tag einer ersten Geburt, deren Schmerz nach wenigen Wochen einer eher verklärten Erinnerung gewichen war. In dieser Erinnerung tauchte nur am Rande ihre Jugendfreundin Agata auf, die einen ersten Besuch hatte machen wollen, von der Hebamme aber barsch abgewiesen worden war. Der Vater, Boye Deletre, empfand diesen Tag als, wie er nicht müde wurde zu sagen, „Stolzestag“. Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, dass er Mutter und Sohn Stunden nach der Geburt weder besuchte, noch sich nach ihrem Zustand erkundigte.
Dies konnte möglicherweise einer moralischen Haltung der Männer dieser Zeit zugesprochen werden. Doch so war er nicht.
Seit Beginn der Wehen hatte er sich in seine Kleinschmiede zurückgezogen. Er hielt das Feuer heiß, hämmerte und feilte stur und stundenlang vor sich hin, bis er - nun eigentlich stolz - mit einer Leiter, einer Kelle, einem Eimer voll englischem Mörtel und der Quelle seines heroischen Stolzes, einer großen, eisernen Platte, auf die kleine Straße hinaustrat. Vor der Haustür stellte er die Leiter an der Wand auf, stieg hinauf und schlug, nichts anderes wahrnehmend, ein Loch in die Hauswand.
Dort hinein arbeitete er sehr, sehr sorgfältig das Eisenschild und verankerte es gut, damit mit ihm nicht dasselbe wie mit der Kanonenkugel in der Kirchenwand am frühen Morgen des gleichen Tages geschehen würde.
Nachdem Anders schon drei Stunden auf dieser Welt war, auf der er nichts als ohrenbetäubende Klopfgeräusche zu hören bekam, nachdem Sieke nach ihren Schmerzen eingeschlafen war und die Hebamme mit dem ungewöhnlichen Namen Wieglinde unaufhörlich auf den Rabenvater geschimpft hatte - und das zum Glück in einer absolut unverständlichen Mischung aus Dänisch und Friesisch -, nach all dem also stand der Vater im starken Regen auf dem glänzenden Kopfsteinpflaster vor seinem Haus und starrte klitschnass sein Schild an, auf dem stand:
„Jenes sei dessen Vaterland, in welchem nicht er arbeite, sondern in welchem er geboren sei.“
Die Schrift war wie die Platte aus Eisen. Beides war grau, so grau, dass man es im Regen mit sehr guten Augen erkennen, jedoch kaum lesen konnte. Doch für den Schöpfer war es der Mittelpunkt der Stadt. Und wie alle Schöpfer bildete er sich von nun an ein, dass jeder es ebenso empfinden müsse. Dabei gab es zunächst außer ihm nur einen, der auch so empfand - trotz der Undurchdringlichkeit des Textes, der unbeholfenen Grammatik und des nahezu Unergründlichen der offensichtlich hintergründigen Gedankenwelt des Schmiedemeisters.
Erst nach dieser Arbeit stiefelte Boye in das Schlafzimmer seiner Frau. Und er flog gleich wieder hinaus, wohl wegen seiner triefenden Nässe, so weit Wieglinde zu verstehen war. Erst mit trockener Kleidung gelang es ihm, wenige Minuten in dem Zimmer zu bleiben. Er sagte: „Alles gut?“ zu seiner Frau und rief viel zu laut zu seinem Sohn, während er ihm einen schwarzen Fingern auf die Nase drückte: „Mein Stummel!“ Daraufhin wurde er vor die Tür gesetzt.
Für Pastor Klaasen blieb dieser Regentag des Jahres 1820 vor allem in Erinnerung, weil er seinen nicht endenwollenden Dienst in der Stadt antreten sollte. Und weil er dieser Dienst nicht antreten konnte. Denn sein Vorgänger, der in den vernebelten Altersruhestand versetzte Pastor Ebsen, wollte nicht weichen. Er verstand aus seinem Nebel heraus nichts, war er doch im hohen Alter vieler falscher Meinungen wie unter anderen der, er wäre knabenhaft jung, oder zum Beispiel einer anderen, nach der er sich immer noch um die Seelen seiner Anbefohlenen kümmerte, statt dass seine Anbefohlenen sich eher ernsthafte Sorgen um seine Seele machten. Immerhin war er wiederholt halb nackt und laut singend vom Friedhof bei nahezu jeder Tageszeit weggeführt worden.
Für Pastor Klaasen blieb dieser Tag aber auch denkwürdig, weil er der Abschluss einer viertägigen Reise von Kopenhagen aus gewesen war. Es war eine Reise, die zwei Tage dauern sollte, die bis weit über die Stadt Schleswig gut verlief, dann aber in Sichtweite des Reiseziels ins Stocken geriet. Der Pferdewagen des Pastors war auf der verlehmten und eingewässerten Landstraße nahezu versunken. Niemand seiner zukünftigen Seelen hatte einen und einen halben Tag lang auch nur im Entferntesten daran gedacht, den neuen Pastor zu befreien. Schließlich erfuhr der ansässige Apotheker von dem Ungeschick und bestach mit Geld einige Landarbeiter und Fischer, um Klaasen ausgraben zu lassen.
Der untersetzte, korpulente Klaasen kam in der Stadt an wie ein Schwein, und seine Helfer hatten diesen Zustand zusätzlich verschlimmert. Dies prägte Klaasens Sicht auf die Mitglieder seiner neuen Gemeinde für die folgenden Jahrzehnte, nach denen er die Stadt in ähnlicher Weise wieder verlassen sollte. Hätte er es gewusst, dann wäre er gleich im Morast geblieben - viel lieber jedoch in der fernen Hauptstadt.
Der junge Apotheker Jasper Jaspersen, ein schlaksiger, haarloser, ernsthafter Frühwitwer, nahm Klaasen freundlich auf und ließ ihn zunächst bei sich wohnen, bis Ebsen nach Wochen gut gefesselt aus dem Pastorat getragen wurde.
Diese Umstände, aber auch das Wissen darüber, dass sich nun endlich zwei gebildete Menschen in dieser Stadt getroffen hatten, die auch zum Glück Junggesellen waren und zusätzlich den vom Apotheker mit hundertprozentigem Alkohol versetzten Fliederbeersaft sehr liebten, machten aus den beiden zunächst ein stets etwas brüchige Männerfreundschaft. Sie begann am Tage der Ankunft mit der Erörterung, inwiefern Boye Deletre das Recht zu der schon erwähnten Wandtafel mit der genannten Schrift haben könnte. Ebenfalls setzte man sich darüber auseinander, ob der Inhalt dieser Schrift bedeutete, Heimat sei nur dort, wo man geboren worden sei. Der Unterschied zwischen Heimat und Vaterland blieb dabei unberücksichtigt. Schließlich erhob sich die Frage, ob diese Schrift nicht ein Affront gegen all diejenigen wäre, die diese Stadt ebenfalls als Heimat begreifen, da sie dort leben und arbeiten würden, auch wenn erst das Schicksal sie hier hergeführt habe. Der Apotheker schien der einzige gewesen zu sein, der den Inhalt der Schrift verstanden hatte. Doch auch das blieb eigentlich immer unklar.
Obwohl die Aktion des Schmieds wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgegangen war, verblieb allgemein die Auffassung, dass Boye damit erstens die Geburt seines Sohnes würdigen wolle und er zweitens sowieso einen leichten Dachschaden habe, was schon seit seiner frühen Kindheit für niemanden ein Geheimnis gewesen war.
Zu der ersten Ansicht sollte sich Boye in seinem viel zu kurzen Leben nie äußern. Doch zu dem zweiten Einwand ließ er hören, ihm seien nur zwei mit einem Dachschaden in der Stadt bekannt, und das seien der alte Pastor Ebsen und der Gemeindeausrufer Lorenzen. Diese Aussage wurde allgemein verurteilt, nicht weil man sich über Ebsen nicht einig gewesen wäre, sondern weil Lorenzen indirekt ein Opfer Deletres geworden war. Denn Boye war es gewesen, der im Auftrag des alten Pastor Ebsen die alte Kanonenkugel aus der angeblich schwedischen Belagerung der Stadt an ihrem Einschlagort, der nördlichen Kirchenwand, eingemauert hatte. „Zur mahnenden Erinnerung“, hatte Ebsen betont. Dies hielten viele für unverständlich, denn zu den Schweden hatte niemand mehr so ein rechtes Verhältnis.
Zwar war allen der Kosakenwinter vor sieben Jahren, an dem die russische Armee, eigentlich eher gegen Napoleon und Kopenhagen, mehrere unverbesserliche Monate lang die Stadt und die Bürger malträtiert hatte, in bester Erinnerung. Doch war man sich über die tatsächliche Verbindung dieser Soldaten zu den Schweden nicht so recht im Klaren. Und auch die Schlacht von Sehestadt, wo auch immer das lag, war nur aus wirren und widersprüchlichen Erzählungen Ebsens bekannt.
Wenn man schon international dachte, dann eher gegen die Franzosen mit ihrem Napoleon. Sie waren zwar Bündnispartner der Dänen gewesen waren, hatten aber zu ihrem großen Nachteil mit den Spaniern den für fast jeden Anwohner gut florierenden Schmuggel mit den Engländern zu unterbinden versucht. Sie hatten damit - wie auch immer das gehen sollte - den gesamten Kontinent absperren wollen - ein ziemlich unsinniges Unterfangen.
Nach einigen grundsätzlichen Gesprächen in der Stadt bei jeder guten Gelegenheit einigte man sich gegen die Franzosen und in der Tendenz für die Engländer. Denn sogar als diese die Elbe blockiert hatten, damit kein französisches Schiff seine Ladung dorthin befördern konnte, hatten sie immer einen regen Schiffsverkehr mit dem kleinen Hafen der Heimatstadt aufrechterhalten.
Hier waren nun einmal grundeigene Bedürfnisse angesprochen, und die Schweden hatten für den Schmuggel nun wirklich nichts geleistet, was bekannt und erwähnenswert war.
Jaspersen hatte zu dieser speziellen Frage der Außenpolitik einen eigenen Standpunkt, für den sich aber nun tatsächlich niemand interessierte.
Dass sich der Gemeindeausrufer Lorenzen in seiner abgewetzten Uniformjacke nun gerade an dem Morgen des Stolzestages unter dieser Kugel an der Kirchenmauer herumdrücken musste und dass sich ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt die rostige Kugel eigenwillig aus der Wand lösen musste, dafür machte Boye Deletre andere Kräfte verantwortlich.
„Und sonst“, ließ er einmal und dann nie wieder zu diesem Problem verlauten, „bin ich Kleinschmied und eigentlich Schlosser, aber überhaupt nicht Maurer.“
Damit war Pastor Ebsen nicht nur auch für diese Angelegenheit schuldig gesprochen worden. Er hatte zusätzlich in der Stadt einen Gleichgesinnten, den überaus debilen Gemeindeausrufer Lorenzen, der allerdings durch den gesamten Vorgang keinen Einschnitt in sein berufliches Leben erfuhr.
Der junge Apotheker Jaspersen aus dem dunklen Jütland hatte für die Leiden des Ausrufers einige Salben zur Auswahl, und der neue Pastor diente mit dem zweiten Buch Mose: Wem ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig; und wes ich mich erbarme, des erbarme ich mich.
Ansonsten beschäftigten sie sich an diesem verregneten Stolzestag jedoch schon mehrere Stunden mit dem Inhalt der Schrifttafel und dem Wort Heimat. Während der genügsame Pastor den Schlosser ebenfalls fürsans faconhielt, bestand Jaspersen aufgeregt darauf, dass der Ausspruch einer 1767 erschienenen Schrift Eiler Hagerups mit dem TitelBrev om Kierlighed til Faedrelandetentliehen sei, die er aus der von seinem Apothekervater ererbten Bibliothek herauszog.
Er wies dem zunehmend gelangweilten Gast nach, dass die Ähnlichkeit der Gedanken Hagerups mit denen des Handwerkers den subtilen Geist dessen aufdecken würde. Zusätzlich würde Deletre das Gedankengut schamlos verdrehen, indem er den Hintergrund dieser Gedanken, die sich einst gegen die übermäßige Einflussnahme deutscher Ausländer in Dänemark gerichtet hatten und somit als Gedanke dänisches Nationalgut seien, verfälschen würde.
Da aber der Schlossermeister so weit gegangen sei, dieses dänische Nationalgut gegen ihn, den Mann aus Skagen, zu wenden, würde er mit Tyge Rothe, dem Sohn deutscher Einwanderer und Deutschtümler kontern:
„Das Volk, worunter der Mensch lebt als Bürger, das ist sein Vaterland.“
Nach langer und stets durch Müdigkeit unterbrochener Überlegung konnte Pastor Klaasen mit diesem Satz leben, da er gerne, was er dem Apotheker lieber nicht anvertraute, Jasper Jaspersen und Boye Deletre auf die gleiche Ebene als Bürger und Besitzer einer gleichen Heimat stellen wollte.
Jaspersen ließ eine neue Eingangstür für die Apotheke anfertigen, in die der Satz von Tyge Rothe in dänischer Sprache eingeschnitzt wurde. Auch Jaspersen glaubte vergebens, dass dies den Kunden der einzigen Apotheke der Gegend unbedingt ins Auge stechen müsste, vergaß aber, dass nicht alle Dänisch sprachen oder gar lesen konnten.
Und ohnehin dachte niemand auch nur im Geringsten daran, dass diese Tür das Ergebnis eines heimlichen Geistesstreites zwischen dem Apotheker und dem Schlossermeister sein könnte. Am wenigsten aber schien Boye dies vermutet zu haben. Immerhin betrat er öfter die Apotheke, um Salben zu kaufen oder angefertigte Gestelle für die, wie er sagte, Apothekerhölle abzuliefern. Damit war Jaspersens Laboratorium gemeint, das er stets erweiterte, aber auch renovierte, weil es in ihm häufig brannte.
Es ist auch nicht bekannt, ob es Boye auffiel, dass Jaspersen ihn seit dem Stolzestag besonders häufig zu sich bestellte und bei diesen Besuchen abwartend lächelte. Allerdings mehrten sich die Arbeiten und Einkünfte der Kleinschmiede auffallend durch die nicht endenden Aufträge aus der Apotheke, und häufiger als früher wurde Boye in die Apotheke gerufen, um Zeichnungen, veränderte Zeichnungen für immer neue Stellagen, anzunehmen oder auch nur beratend tätig zu werden. Dabei wurde ihm niemals der Fliederbeersaft gereicht.
Doch immerhin wurde die Ladentür der Apotheke benutzt. An die Tür des Schlossers aber traute sich niemand mehr, nachdem das drohende Schild darüber hing, von dem man nicht wusste, ob es nicht auch eines Tages den Geist eines Menschen verwirren würde. Über viele Jahre verlor das Holz der Haustür die Farbe, und niemand strich die Tür, die, vielleicht weil sie für immer ruhen konnte, die Zeit und die Bewohner überlebte, während die Apothekertür eines Tages verbrennen sollte.
Das schmale Trottoir vor der Haustür des Schlossers blieb ebenfalls ungenutzt. Es veränderte sich in einem kleinen Halbkreis unter dem Eisenschild im Sommer zu einem blühenden Vorgarten, in dem Löwenzahn, Gänseblümchen, Hahnenklee und eine noch nie in der Gegend gesehene, schwarz blühende Pflanze stand, die Jahr für Jahr nach dem letzten Frost des Winters bis zum Frost des kommenden Winters unwiderstehlich ihre Pracht zeigte. Und als niemand mehr misstrauisch das schwere Eisenschild betrachtend vom Trottoir abwich, tat man es aus Respekt vor dieser Pflanze, die so lange erhalten blieb wie die alte Haustür und das Schild an der Wand.
Nur zwei Schritte habe ich mich fortbewegt von Anders Schießgerät. Mein Zurückdenken zog während dieser Schritte unaufhaltsam an mir vorbei. Es ist die Erinnerung an eine Zeit vor meinem Leben. Ich erinnere mich an das Erzählte und nicht an das Erlebte. Heute ist es vielleicht durch Besuche geweckt worden, den Besuch von Gustav und den seiner beiden Söhne einige Stunden später.
Wahrscheinlich sind diese schnellen Gedanken durch das, was Gustav mir gebracht hat, und das, was seine Söhne mir gesagt haben, ausgelöst worden. Würde man das Rätsel, wodurch Gedanken und deren Verlauf beeinflusst werden, lösen können, dann wäre die Macht über die Menschen grenzenlos.
Jetzt blicke ich auf das Schießgerät, und die Gedanken fliegen wieder zurück zu der Zeit um den Stolzestag.
In der Stadt standen in diesen Tagen ganz andere Themen im Mittelpunkt oft stundenlanger Plaudereien am Hafen, auf dem Marktplatz, beim Einkauf, an Gartenzäunen oder in den Wohn- und Schlafzimmern als das Thema Heimat.
Im Zusammenhang mit der über den Kanal von Kopenhagen gekommenen, auf dem Weg nach Altona, ebenfalls am Stolzestag, in der Flussmündung gesunkenen Dreimastbark CAROLINE MATHILDE entwickelten sich in kürzester Zeit Umstände, die sich - ohne Übertreibung - über Schleswig nach Kopenhagen und über Holstein bis weit hinter Hamburg herumsprachen.
Der Untergang der Bark war zunächst ein großes Rätsel, weil das Schiff als sicher galt. Es hatte noch unter englischer Flagge und dem Namen CAROLINE zurzeit der für diese Gegend recht vergeblichen Sperre des Kontinents die wildesten Manöver gefahren, wenn es von dänischen und französischen Schiffen verfolgt worden war. Der CAROLINE wurde wegen ihrer großen Erfolge viel nachgesagt. So sollte sie sogar mehrfach ungesehen den schmalen Kanal zur Ostsee passiert haben, ja, ernsthafte und angesehene Bewohner der Stadt schworen, als Zeugen mehrfach dem Schauspiel beigewohnt zu haben, bei dem die CAROLINE, verfolgt von einer beträchtlichen Anzahl verschiedener Kriegsschiffe, auf offenem Meer tatsächlich unsichtbar geworden war. Die auf diesem Schiff transportierten Schätze wurden mit jedem weiteren Jahr der Erzählungen reichhaltiger und wertvoller.
Dann gelang es den Dänen, die Bark eines Tages bei eindeutiger Sicht aufzubringen.
Sie wurde umgeflaggt und auf den Namen CAROLINE MATHILDE umbenannt. Das konnte einerseits als Versuch der Hauptstädter gewesen sein, sich als Erbe des ehemaligen Ruhms dieses Schiffes auszugeben. Andererseits aber wurde dies auch als späte Anerkennung für die im Exil lebende Königin Caroline Mathilde gewertet. Immerhin hatte Dänemark diese Dame lebenslang in die Stadt Celle verbannt, weil sie ein Verhältnis mit einem Altonaer, dem Berater des schwachsinnigen Königs, angefangen hatte, statt treu ihren Schwachsinnigen zu lieben.
Für die Bewohner der Stadt aber hieß das Schiff weiterhin CAROLINE.
Das eigentliche Interesse galt jedoch weniger dem Schiff als vielmehr der Ehefrau des Lotsen Pauls, Agata. Volquard Pauls war ein erfahrener Lotse, der sogar Navigation an der Lotsenschule unterrichtete und der während seines kurzen Ehelebens voll Gram an dem freiheitlichen Umgang seiner Frau litt. Agata, sonst eine sehr quirlige Frau, hatte scheinbar kurz nach der Hochzeit ein für die Stadt ungewöhnliches, offensichtlich unsittliches Leben geführt. Angeblich sollte sie, sobald ihr Mann ein Schiff bestieg, ihre Tür ganz unbekümmert jedem auf Reede liegenden Seemann geöffnet haben.
Mehrfach auf diesen Lebenswandel und den zunehmenden Verfall ihres Mannes angesprochen hatte sie Verwünschungen ausgestoßen, die - wie man behauptete - nach oft reiflicher Zeit auch tatsächlich eintrafen. Zur Erhaltung der Moral in der Stadt erhielt Agata somit den Zunamen „De Hex“ und ein Schicksal.
Das tat der Freundschaft zwischen Sieke Deletre und Agata Pauls keinen wesentlichen Abbruch, obwohl Boye diese Verbindung nicht gerne sah. Er verließ sogar das Haus, wenn Agata zu Besuch kam. Bei langen Frauengespräche, bei denen sich die beiden Freundinnen ständig und sehr laut ins Wort fielen, sodass es Boye ohnehin ein Rätsel war, wie sie sich verständigen konnten, klagte Agata ihr Leid über den sturen und gewalttätigen Ehemann, mit dem sie auch keine Kinder bekommen konnte. Die üblen Gerüchte über ihren angeblich unsittlichen Lebenswandel wies sie zurück und erklärte diese als rachsüchtig in die Welt gesetzte Verleumdungen des gehassten Mannes. Sieke glaubte ihrer Freundin.
An dem Morgen, an dem der Lotse Pauls die CAROLINE besteigen wollte, um sie sicher um die Sandbänke herum ins offene Meer zu manövrieren, war ein erneuter Streit unter den Eheleuten ausgebrochen. Dabei hätte Agata, wie die Nachbarn später bezeugten, dem Lotsen nachgerufen:
„Heute sinkst Du mit Deiner Bark. Dein nasser Tod, Volquard Pauls!“
Tatsächlich fuhr die Bark auf eine Sandbank und verschwand dicht vor der südwestlichen Küste mit allem und jedem so schnell im Mahlsand, dass bei Ebbe nicht einmal mehr die Mastspitzen zu sehen waren.
An diesem Tag hatte Agata - wie schon erwähnt - ihre Freundin am Kindbett besuchen wollen, um das Kind, das ihr in ihrer Ehe versagt blieb, zu sehen. Doch Wieglinde, die Hebamme, fürchtete den bösen Blick der Freundin. Agata wurde auch von Boye, der sich seinem Eisenschild hingab, keines Blickes gewürdigt.
Zu Hause lag Agata in Tränen über ihre Einsamkeit und Verzweiflung, als der örtliche Amtsdiener in Begleitung des Stockschließers erschien, um sie zu inhaftieren. Die Männer waren zwar irritiert über den Zustand der Lotsenfrau, führten dies aber später als Beweis für die Verdorbenheit der Frau an. Denn zu diesem Zeitpunkt konnte sie noch nichts über das Missgeschick ihres Mannes erfahren haben. Sie wusste es aber vielleicht schon übersinnlich und spielte dem Kommando die Tränen und die Trauer nur vor, um einer möglichen Strafe zu entgehen. Diese Argumentation, so verquer sie auch war, schien sehr überzeugend zu sein, weil man sie gern so akzeptieren wollte.
Schließlich kam es zu einer Anklage gegen Agata Pauls, bei der ihr die moralische und ehrabschneidende Zerstörung des Geistes ihres Mannes zugeschrieben wurde. In Folge dessen war er daran gehindert worden, seinem für den Staat verantwortungsvollen Beruf erfolgreich nachzugehen. In Wirklichkeit aber standen hinter der Anklage die Furcht vor übersinnlichen Kräften Agatas und der Wunsch nach einer nun endlich zum Zuge kommenden Bestrafung unsittlicher Handlungen. Denn davor war jede andere ehrbare Frau zu retten.
Dieses nun allgemein anerkannte Problem war ein Grund für die Verzögerung der anstehenden Taufe im Haus Deletre. Der neue Pastor Klaasen war nach seiner kurzen und wenig überzeugenden Antrittspredigt ganz von seiner ihn erfassenden Aufgabe durchströmt, moralisch-sittlicher und religiöser Berater bei den Verhandlungen gegen Agata zu sein. Darüber hinaus konnte er seine Amtsgeschäfte nur bedingt verfolgen, solange der alte Pastor Ebsen das Pastorat belagerte, auf dem Friedhof sang oder tief schlafend und fast erfroren auf der Kanzel vorgefunden wurde.
Auch Sieke hatte das Interesse, die Taufe hinauszuzögern. Sie war verwirrt von den Umständen um Agata und wartete außerdem auf eine Nachricht ihres Zwillingsbruders Bendix, der nicht wie gewohnt vor Einbruch des Winters von der Grönlandfahrt heimgekehrt war. Ihr Vater, der Lehnsmann Pedersen, drängte zwar darauf, trotz der Ungewissheit über den Verbleib seines Sohnes Bendix den neuen Enkelsohn in den Kreis der Christen aufzunehmen. Doch zusammen genommen sprachen alle Umstände dagegen.
Dies änderte sich nach einigen Wochen mit der Hinrichtung Agatas im Februar des neuen Jahres.
Auf dem Hundsberg am Hafenausgang, ein Hügel am Deich nicht höher als eine gut gebaute Warft, der dennoch die höchste Erhebung des Ortes war und in allgemeiner Unkenntnis der Bergwelt eben Berg genannt wurde, auf dem die erlegten Seehunde oft im Jahr in Reih und Glied ausgelegt wurden, auf diesem Berg hatten Zimmerleute ein zweistöckiges Gestell errichtet. Am Fuße des Hügels hatten sich an diesem lurigen Tag nahezu fünfhundert Menschen versammelt.
Viele Bauern waren wegen der Unpassierbarkeit der morastigen Straßen mit Kähnen über die Bootsfahrten gekommen. Der Fährverkehr von Holstein aus war an diesem Tag vorsorglich verdoppelt worden. Außer den Seeleuten, die wegen der Windstille auf dem Fluss vor Anker lagen, waren auch sehr viele Bewohner der Stadt gekommen. Unter ihnen befand sich Boye, der neben seinem Schwiegervater einen Platz in der ersten Reihe erhalten hatte, da der alte Lehnsmann Pedersen besondere Privilegien in der Stadt genoss.
Nachdem der Scharfrichter mit seinen drei Gehilfen das obere Stockwerk des Blutgerüstes betreten hatte, erstiegen der Oberstaller, der Bürgermeister, Pastor Klaasen und die Ratsmänner der Stadt, unter ihnen auch der Apotheker Jaspersen, die untere Etage. Schließlich wurde Agata, die in ein weißes, bodenlanges Gewand gekleidet war, vor sie gestellt, während die Zuschauer so still wurden wie der Wind, der an diesem Tag fehlte. Als ein Ratsmann das nach Landesrecht gefällte Urteil verlesen hatte, wurde Agata, die im Gesicht so bleich war wie ihr Gewand, zu dem Scharfrichter hinaufgeführt.
Bevor sie sich aber ihren Kopf auf den Holzbock legen ließ, trat sie an die Kante des Blutgerüstes vor und sah enttäuscht, voller Hass und mit abfälligem Blick in die Menge. Dort erspähte sie Boye, der wegen seines langen, schwarzen, widerspenstigen Haars, des bartlosen Gesichts und der großen, dunklen, eingefallenen Augen leicht von allen anderen zu unterscheiden war. Ihm rief sie mit heller, klarer Stimme zu: „Mein Mann musste sterben, als dein erster Sohn geboren wurde, Boye Deletre. Und du wirst das Schiff nicht kriegen. Und dein Sohn auch nicht. Nichts werdet Ihr bekommen! Immer wieder nichts!“
Dann trat sie zurück, legte ohne weitere Hilfe ihren Kopf auf den Bock und ließ ihn sich abschlagen, wobei ein tiefes Ausatmen durch die bewegungslose Zuschauermenge ging. Die Honoratioren in der unteren Etage hatten zuvor ihren Platz verlassen, um von dem auslaufenden Blut nicht befleckt zu werden. Die Gehilfen des Scharfrichters legten den Körper mit dem roten Gewand und anschließend den Kopf sorgfältig in eine bereitgestellte Holzkiste, vernagelten sie und trugen sie an einen geheimen Ort außerhalb des Friedhofs, wo der Sarg vergraben werden sollte.
Boye hatte die Ansprache Agatas lächelnd zur Kenntnis genommen, verharrte jedoch mit diesem Gesicht, das ihn auch hinunter zum Fluss begleitete, wo er lange stand und weit in die dunstige Flussmündung starrte. Es war nahezu still. Die Flut drückte das braune Wasser in den Fluss, begleitet von unzähligen Eisschollen, die sich stauten, aneinander rieben und infolgedessen manchmal senkrecht wie die Mastspitzen eines Schiffes aus dem Wasser gedrückt wurden, um dann laut zerbrechend wieder hineinzufallen. Das waren die einzigen Geräusche, die zu hören waren, und es hätte nicht gewundert, wenn das Eis angefangen hätte zu sprechen.
Erst einen Monat später konnte die Taufe stattfinden, weil Pastor Klaasen für sich in Anspruch genommen hatte, ausführlich den moralisch-sittlichen und religiösen Zustand seiner Gemeinde zu überprüfen, bevor er einen Neuen in die Christengemeinde aufnehmen wollte. Erst der Besuch Pedersens bei Klaasen beendete diese Prüfung abrupt, wobei niemand in Erfahrung bringen konnte, wie sie verlaufen und zu welchem Ergebnis Klaasen gekommen war.
Für manchen Bürger verblieb ein fahler Nachgeschmack und eine stets wieder aufkeimende Verunsicherung, denn Klaasen hatte trotz mehrmaliger Nachfragen seine Untersuchungen immer nur mit einem Satz aus dem fünften Buch Mose kommentiert: „Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehern sein, und die Erde unter dir eisern.“
Sieke hatte sich nach dem Verlust und der stets zu hinterfragenden Glaubwürdigkeit ihrer toten Freundin langsam wieder gefangen, obwohl sie zu den wenigen gehörte, die an der Gerechtigkeit des Urteils zweifelten. Mittlerweile beschäftigte sie ein ganz neuer und tröstender Gedanke. Trotz der Sorge über den verschollenen Bruder wollte sie eine schnelle Taufe des ersten Sohnes.
Den Taufvorgang selbst hatte der unscheinbare Klaasen nicht beherrscht, und so war er auch nicht Mittelpunkt der anschließenden Feier der Schlosserfamilie, bei der außer Klaasen die Verwandtschaft Siekes anwesend war. Boyes Verwandtschaft war entweder verstorben oder einfach nicht zu erreichen gewesen. Da das Kind ohnehin nicht im Mittelpunkt stehen konnte, weil es ja auch an den komplizierten Gesprächen nicht teilnehmen konnte, wäre diese Rolle Sieke und Boye zugefallen.
Doch Sieke hatte sich um die nicht ablassenden Anfragen nach Eiergrog zu kümmern, und Boye schwebte auf einer anderen Ebene, weil seine Frau ihm zwischen zwei aufgeschlagenen Eiern nüchtern ihre erneute Schwangerschaft mitgeteilt hatte.
So musste Pedersen zum Zentrum des Geschehens heranrücken und eröffnete die Feier mit einem „Wohl-Sein“ auf das Enkelkind und auf seinen bei Grönland verschollenen Sohn Bendix sowie der von allen geteilten Gewissheit, sein Junge würde schon bald wiederkommen.
Pedersen, eher ein nüchterner, ernsthafter alter Herr mit einem wuchtigen Körper, einem kreisrunden, meist roten Gesicht, verschwindend kleinen, blauen Augen und einem haarlosen, rosaroten Schädel war ein perfekter Gastgeber.
Durch seine verschiedenen Ämter, unter anderem auch als Deichgraf, hatte er gelernt, sich und seine Sprache auf jeden einzustellen. Er verstand es, seine Partner geschickt zu tiefen und ernsthaften Gesprächen zu verführen. Nachdem er sich auf sein Altenteil gesetzt, den Hof seinem ältesten Sohn übergeben und den restlichen Kindern ein großes Geldgeschenk gemacht hatte, die Quelle auch der Schlosserei, hatte Pedersen sich seinen Vorlieben, der Verwaltungsarbeit, der Staatstheorie sowie der Literatur hingegeben. Zu einigen Persönlichkeiten des Gesamtstaates hatte er kraft seiner Interessen überraschend gute Kontakte aufgebaut.
Er stand im Briefwechsel mit dem noch jungen Uwe Jens Lornsen, der gerade von Holstein nach Kopenhagen wechselte, und hatte auch den Holsteiner Carsten Niebuhr kennengelernt und sich mit ihm über dessen Expedition nachArabia felixauseinandergesetzt, die ein absolutes Debakel gewesen war, von der Niebuhr aber als einziger Überlebender wichtige Abschriften mitgebracht hatte. Über Themen dieser Art konnte Pedersen lange Gespräche zu führen, die er wegen seiner umfangreichen Bibliothek wahllos erweitern oder konzentrieren konnte.
Im Verlauf der Feier zog er Boye, der immer noch nicht zu wissen schien, dass er der Gastgeber des Festes war und - wie so häufig - ganz mit sich allein zu sein schien, auf den kleinen Hofplatz zwischen Wohnhaus und Schlosserei hinaus und eröffnete ihm überraschend: „Ich hab sie gekauft.“
Boye brauchte hinter seinen großen Augen, die beim Nachdenken aussahen, als würden sie nach innen sehen, einige Zeit, um sich auszumalen, was Pedersen wohl alles gekauft haben könnte, da dessen Interessen ja weit gefächert waren.
Auch als Pedersen ihm noch eindeutiger erklärte, er habe das versunkene Schiff gekauft, konnte Boye dies nicht recht wahrhaben. Erst als Pedersen ihm sagte, er habe ihm - Boye - das Schiff offiziell überschrieben, damit ein kräftiger und tatenlustiger Mann es hebe, klärten sich die Gedanken des Schlossers. Als Pedersen ausführte, die Bark habe unbekannte Schätze an Bord, unter anderem die Schriftrollen von Carsten Niebuhr aus Persepolis sowie deren 1802 in Kopenhagen gelungene Entschlüsselung, trat Boye so hart auf den Boden einer Wirklichkeit zurück, dass er ab sofort die Taufe wie auch die erneute Schwangerschaft seiner Frau in eine der vielen Nebenkammern seines Kopfes sperrte.
Von diesem Tage an bereitete er seine Expedition zum Mahlsand an der südwestlichen Küste vor. Er beschäftigte sich mit dem grundsätzlichen Bau von Dreimastbarken, mit Gezeiten und dem sichtbaren Bild des Mondes, entwickelte den Plan einer Schienenkarre und las die Reiseerinnerungen Carsten Niebuhrs. In der verbliebenen Zeit erledigte er die Aufträge der Kleinschmiede und sammelte alles Geld, was ihm zur Verfügung stehen konnte.
Sieke, die nicht nur das Äußere ihres Vaters erhalten hatte, sondern auch dessen Ruhe und Gelassenheit, beobachtete die Rastlosigkeit ihres Mannes. Sie wunderte sich nicht, dass Boye nach der Geburt seines zweiten Sohnes Lorenz, auch ohne eine Eisentafel anzufertigen, nur kurz und viel zu spät in das Schlafzimmer gepoltert kam und „Alles gut?“ zu ihr sagte. Dem Neuen drückte er einen schwarzen Finger auf die Nase und rief viel zu laut „Mein Stummel!“. Daraufhin wurde er von Wieglinde wieder vor die Tür gesetzt.
Er hatte gerade feststellen können, dass der zweite Sohn aussah wie der erste. Und der wiederum sah aus wie die Mutter. Sie hatten nichts von ihm und alles von Sieke, und er liebte sie alle.
Ich muss mich wirklich in Acht nehmen. Wenn ich diese Zeit denke, dann denke ich das, was mir erzählt wurde. Vielleicht ist es nicht immer die Wahrheit. Doch es passt. Es passt in alles, was kommen sollte und geschehen würde. Einiges mag etwas anders gewesen sein. Auch die Erinnerungen der Erzähler sind verfälscht. Aber letztlich ist das nicht wichtig. Wichtig ist, dass alles passt.
Einige Monate nach der zweiten Geburt stand im Juni des Jahres 1822 zur Überraschung aller endlich Bendix Pedersen, der Zwillingsbruder Siekes, auf dem Hofplatz. Gemeinsam mit Bendix war Bootsmann eingetroffen. Er würde nie mehr so richtig fortgehen.
Die Ankunft des Schwagers hatte für Boye einige Verzögerungen in seiner Planung zur Folge, weil Bendix sich einquartierte und in den folgenden Tagen große Besuchergruppen hinter dem Haus standen, um sich immer wieder das Abenteuer und die Rettung des Grönlandfahrers anzuhören. Einige waren allerdings auch nur gekommen, um Bootsmann zu studieren, der deshalb großes Aufsehen erregte, weil er die Gewissheit einer Kleinstadt darüber, wie ein Hund eigentlich aussah, durch sein übertriebenes Da-Sein in Frage stellte.
Bendix war vor zweieinhalb Jahren wie immer beim Biikefeuer am Vorabend des Petritages mit einem kleinen Segler nach Glückstadt gefahren, um auf Walfang zu gehen. Er hatte auf der Brigg DOROTHEA unter dem Kommandeur Reimers aus Sylt angeheuert. Schon die Abreise der Brigg war vom Unglück verfolgt gewesen, weil sich das Schiff nur schwer aus dem Eis des Hafens und der Elbe hatte lösen können und Werbanker und Trossen verloren gegangen waren. Im Eismeer dann angekommen hatte die Brigg bereits etliche kleine Lecks. Auf 69° 18´ nördlicher Breite wurde das Schiff zunächst vorn und hinten von großen Eisschollen eingeschlossen, die immer mehr verfroren und weitere Lecks am Rumpf verursachten. Man versuchte zwar, mit Haken, Kabeltauen und Eisbäumen die DOROTHEA frei zu bekommen, doch als ein sehr großes Leck am Hintersteven entstanden war, schien auch unaufhörliches Schöpfen nicht mehr helfen. Als letzte Rettung begann man, Strümpfe und Beutel mit Grütze zu füllen und diese in die Lecks zu stopfen in der Hoffnung, die Grütze würde so weit aufgehen, dass das Wasser nicht mehr eindringen könnte.
Doch auch dies war vergeblich gewesen, sodass man einen Schiffsrat abhalten musste und sich entschloss, das Schiff seinem Schicksal zu überlassen und die Schaluppen auf die Eisschollen zu setzen. Die anschließende Nacht hatte die Mannschaft noch in der Nähe des Schiffes verbracht, indem sie unter Zelten aus Segeltuch geschlafen hatte.
Als die DOROTHEA jedoch am nächsten Morgen vor ihren Augen sank und alles noch schwimmende Gut vom Eis zermalmt worden war, entschloss man sich, den ungewissen Weg zur nächsten Küste zu nehmen. Zum Glück und dank der Navigationskenntnisse des Kommandeurs erreichte man nach ungezählten Tagen ausgehungert und verfroren die aufragende Felsenküste Islands, konnte aber wegen der starken Brandung nicht anlanden. Lange und vergeblich hatten die Seeleute eine flache Stelle gesucht, bis sie aufgeben mussten und sich in ihrer Verzweiflung mit den Booten an Land und in die Felsen werfen ließen. So erreichten sie durchnässt und ausgekühlt Island, und einige hatten erfrorene Füße und Knochenbrüchen.
Vor ihnen lag noch ein langer Weg durch die Schneemassen der Insel, wobei man vier der Seeleute tragen und etlichen die Zehen amputieren musste. Dennoch erreichte die gesamte Gruppe ausgemergelt eine kleines Fjorddorf mit dem Namen Akureiry, wo sich alle ausruhten und auskurierten und Bendix die Bekanntschaft mit Bootsmann machte. Daraus wuchs eine wirkliche Männerfreundschaft. Nach langem Warten auf ein Schiff, das im Sommer nach Süden fahren sollte, konnten sie mit der FAEDRELANDET aus Kopenhagen bis in den Heimathafen Bendix Pedersens gelangen.
Fast jeder außer Sieke glaubte Bendix, der allen versicherte, er würde nie mehr nach Grönland fahren, obwohl er ohne Verdienst zurückgekehrt war. Und es war Boye, der diesen Glauben für sich sofort in ein Wissen ummünzte.
Nachdem der Rummel hinter dem Haus abgeklungen war, man ein großes Fest auf dem Hof der Pedersens im südwestlichen Teil der Landschaft gefeiert und Bendix seinen ersten Sommer seit vielen Jahren genossen hatte, hielt Boye es endlich nicht mehr aus und weihte den Schwager in sein Geheimnis ein, auf das Bendix unerwartet reagierte.
Er hatte in seinem Leben schon sehr viele Geschichten aus der Seefahrt gehört und wies alle Erwartungen an die CAROLINE, die sein Vater dem gutgläubigen Boye in den Kopf gesetzt hatte, als Fantasien eines ehrbaren, aber schon sehr alten Mannes zurück.
„Ansonsten“, erklärte er Boye unangebracht leise, „weiß ich viel über Robben, Wale und das Eis. Über den Mahlsand weiß ich nichts.“
Er verweigerte jegliche Hilfe oder Unterstützung und flüsterte: „Aber mein Vater, Boye, weiß von all dem gar nichts.“
In den folgenden Wochen wurde zwischen den Männern nicht mehr über das Thema gesprochen. Boye ging stur seiner Arbeit nach, und das offene Feuer in der Werkstatt erlosch Tag und Nacht nicht. Er fertigte an Feilbank, Schraubstock und Amboss Schrauben, Schlüssel und Schlösser, Scharniere, Truhen und allerlei Eisenzeug für die Apotheke.
Am Abend jedoch widmete er sich einer selbst konstruierten, sehr großen Pumpe, die von sechs Männern zu bedienen wäre. In diesen Wochen lief er meist mürrisch und nicht ansprechbar herum, was Sieke immer wieder mit einem Spruch aus einem alten Handwerkslied kommentierte: „Schlosser, Schmied und Zimmerleut wissen nichts von Höflichkeit.“
Bendix beschäftigte sich in der Küche bei Sieke mit der Schnitzkunst an Walknochen, aus denen er Lineale, Knöpfe und wunderschön verzierte Dosen und Kästchen herstellte, von deren Verkauf er einigermaßen gut leben konnte, bis er eines Tages eine Nachricht seines Vaters erhielt, ihn doch bitte in den nächsten Tagen aufzusuchen.
Am folgenden Vormittag eines sehr stürmischen Herbsttages traten er und Bootsmann einen zweistündigen Fußmarsch zum Altenteil des Vaters an. Sie wählten nicht die vermatschte Landstraße, sondern trotz des böigen Westwindes den Außendeich Richtung Flussmündung. Über dem aufgerissenen Hochwasser schwebten Silbermöwen und Seeschwalben, und weit draußen in der Fahrrinne quälte sich kreuzend eine Galiote gegen den beginnenden Sturm.
Bendix fand seinen Vater in der Bibliothek vor, die ihm gleichzeitig als Amtsstube diente. In der Mitte des Raumes vor einem massigen Schreibtisch stand ein sehr großer Globus, um den man herumgehen konnte. Pedersen begrüßte den vom Wind zerzausten Sohn mit den Worten: „Du hast ja so`n Backbordkopp wie ich. Wirst mir immer ähnlicher.“
Er machte durchaus nicht den Eindruck, den Bendix Wochen zuvor Boye gegenüber geschildert hatte, drückte Bendix auf einen Stuhl vor eine Bücherwand und begann sofort, direkt und laut das Gespräch: „Wovon lebst Du jetzt? Willst du Knochenschnitzer werden? Das passt doch nicht.“
Bendix, der sein Leben immer gern ohne die Ratschläge seines Vaters geführt hatte, sich aber vielleicht deshalb nun plötzlich durch diese Ansprache in seine Kindheit zurückversetzt fühlte, trat dem nach kurzer Pause entgegen, indem er versuchte, die Unkenntnis des Vaters über den Walfang auszunutzen: „Ich bin ein guter Seemann, und seit Jahren flense ich nicht nur, sondern bin Harpunier und Partgänger. In Kürze könnte ich selbst ein Kommando übernehmen.“
Die Täuschung über den Zustand des Vaters war groß, denn Pedersen konnte diese Argumente fachkundig entkräften und wies darauf hin, dass der Walfang mit jedem Jahr nachlasse und die Erträge immer schlechter würden, denn das Gebiet um Spitzbergen sei endgültig abgefischt. Dies sei der Grund, warum immer weniger Schiffe ins Nordmeer fahren würden. Im Übrigen wisse auch er, dass man nicht einfach Kommandeur werden könne, wenn man nicht die Navigationsschule besucht habe.
Bendix blieb sehr ruhig, war jedoch innerlich aufgewühlt, da er für sich behaupten wollte, zumindest in seinem beruflichen Bereich dem Vater überlegen zu sein. Dies spürte Pedersen, der sich leicht auf die Debatte einließ, um sein eigentliches Ziel zu erreichen.
Bendix schilderte die tatsächlich schlechte Ertragslage, beschrieb dann aber die viel weiter entfernte Fahrroute bis in die Davidsstraße und die bis zu einhundert Tonnen schweren Wale in diesem Gebiet. Weiterhin räumte er ein, er würde sich gerade mit dem Gedanken anfreunden, die örtliche Navigationsschule zu besuchen, sehe im Übrigen kein Problem darin, das Examen zu bestehen, da er schon jetzt perfekt mit Chronometer und Oktanten umgehen könne. Sollte aber der Walfang tatsächlich ständig nachlassen, dann könne ja auch er mit der dann erworbenen Vorbildung ein weiteres Examen zum Flusslotsen ablegen und habe damit die Grundlage einer dauerhaften Existenz gelegt.
Pedersen zeigte sich erfreut über die Zukunftspläne des Sohnes und übergab ihm einige Lehrbücher aus der Bibliothek wieDas System der praktischen SeemannskundeundDas System der praktischen Schifferkunde, warnte Bendix aber davor, eine Entscheidung zu lange hinauszuschieben, denn er habe aus guten Quellen erfahren, dass bei einer stärkeren Erkrankung des örtlichen Navigationsexaminators oder gar mit seinem Tod der Plan bestehe, die Schule zu schließen und in der Folge die Ausbildung und Prüfung nur noch in Kopenhagen zu ermöglichen. Dies allerdings sei doch für Bendix eine noch größere finanzielle Belastung als schon jetzt, wenn er die örtliche Schule aufzusuchen gedenke. Pedersen schloss mit der Frage, wie Bendix sich denn überhaupt die Finanzierung seiner Unternehmungen vorstellen würde.
Der Sohn, der sich tatsächlich in diesem Gespräch zum ersten Mal mit den Gedanken einer Ausbildung konfrontiert sah und dies auch nur, um dem Vater auszuweichen, konnte ihm nur undeutliche Antworten geben. Dennoch gab er sich sicher, schilderte seine Pläne, in den kommenden zwei Jahren große Fahrten als Partgänger anzustreben, weil er große Erträge erwarte und somit eine gute finanzielle Grundlage haben könne, um in die Ausbildung zu gehen.
Hier fand Pedersen einen neuen Zugang, ging in die Offensive und wies dem Sohn nach, er würde seine gesamten Zukunftspläne nur auf Glück und Zufälle bauen, statt einmal eine sichere und erfolgversprechende Unternehmung zu beginnen, die ihn mit einem Schlag von Zukunftssorgen befreien würde. So würde er auch nicht verstehen, warum Bendix ganz entschieden das Angebot Boyes, die CAROLINE gemeinsam zu heben, abgelehnt habe und er gar nicht auf das Gespür und die sicheren Informationen des Vaters vertraue. Anschließend legte Pedersen seinem Sohn die Kaufurkunde der Kopenhagener Reederei vor sowie eine von der gleichen Reederei geschickte Aufstellung der Schiffsladung, die vor allem aus Produkten aus den dänischen Kolonien, jedoch auch aus einer im Auftrag des dänischen Staates in verbleiten Plomben mitgesendeten, geheimen Abschrift aus Persepolis und deren Entschlüsselung bestand.
Der weitere Brief eines befreundeten Mitarbeiters einer Kanzlei aus Kopenhagen an Pedersen beschrieb, dass diese Dokumente mit der CAROLINE hätten nach Altona geschickt werden sollen, weil dort eine neue Expedition vorbereitet werde. Man habe aller Wahrscheinlichkeit nach Hinweise auf ungeahnte, bisher unbekannte Erkenntnisse inArabia felixerhalten.
Zusätzlich zeigte Pedersen den Brief eines anderen Freundes aus Altona, der bestätigte, dass dort eine Expedition nach Arabien vorbereitet werde, was nun allerdings wegen des Untergangs der CAROLINE ins Stocken geraten sei, insgesamt aber auch große Geldmengen verschlingen würde, sodass der Verlust der Dokumente eventuell zu einer Revidierung der Expeditionsentscheidung in der Hauptstadt führen könne.
Schließlich legte Pedersen die Urkunde vor, in der er das Schiff auf Boye Deletre überschrieben und in der er die weitere Vererbbarkeit des Eigentums sichergestellt hatte.
Bendix teilte dem Vater sein Erstaunen über dessen sorgfältige Recherche mit und erntete dafür den Rat: „Kauf niemals etwas, von dem Du nicht auch alles weißt.“
Er verließ das Haus mit dem Versprechen, alles nochmals gut zu durchdenken und mit Boye zu beraten, wobei er die angebotenen Lehrbücher in der Bibliothek vergaß.
Vor der Tür wurde er nochmals von seinem Vater zurückgerufen, der sehr, sehr leise zu ihm sprach: „Sag mal, Bendix, dieser Hund, was ist eigentlich mit dem? Ich meine, er sieht irgendwie aus wie ...“
„Wie ein Ferkel. Ich weiß“, antwortete Bendix. „Aber er ist ein guter Wachhund. Er ist sehr schlau und gut auf See.“
Bootsmann hob gerade das Bein und pinkelte gegen die Freitreppe.
„Na, wenn Du meinst!“, antwortete der alte Pedersen. „Er pisst ja immerhin wie ein Hund.“
Bootsmann bellte auch wie ein Hund. Das geschah allerdings nur in Situationen größter Aufregung und war ein unangenehm helles, fast quiekendes Gebell. Ansonsten hatte Pedersen natürlich recht. Unter vielen Ferkeln wäre Bootsmann sicher nicht einmal der Muttersau aufgefallen.
Den Sturm im Rücken wurden beide so sehr in Richtung der Stadt getrieben, dass sie ihre gesamte Kraft aufwenden mussten, um nicht ins Rennen zu geraten, was mit einem wahren Flug von der Deichkrone geendet hätte.
Pedersen sah dem Sohn über das flache Land lange nach und war nun sicher, seinem Ziel ein gutes Stück näher gekommen zu sein.
Bendix brauchte keine Zeit zur Überlegung, weil er seine Pläne immer dann umsetzte, wenn er gerade begonnen hatte, über sie nachzudenken. In den folgenden Wochen kam es abends zu immer neuen Gesprächen zwischen ihm und Boye. Sieke stand der Angelegenheit skeptisch gegenüber, ließ dies jedoch nicht durchblicken, holte sich aber von Boye das Versprechen ein, nicht die Arbeit und die Einkünfte aus der Schlosserei zu vernachlässigen.
Die beiden Männer planten, nach Beendigung der Frühjahrsstürme die Unglücksstelle des Schiffes aufzusuchen und den Winter zu nutzen, um gemeinsam die Arbeit an der großen Pumpe zu beenden.
Bendix unterstützte von dieser Zeit an Boye in der Schlosserei, war zunächst Handlanger, lernte sehr schnell mit Zirkel, Winkel, Schmiege, Reißnadel und Körner aber auch mit den verschiedenen Feilen und Hämmern, ja, sogar mit Biegehaken und Obergesenken umzugehen, sodass er bald viele Aufträge eigenständig erledigen konnte.
So verblieb genug Zeit, die Arbeit an der Pumpe voranzutreiben, die im März des folgenden Jahres auf dem Hofplatz montiert wurde und so viel Platz einnahm, dass Sieke am Waschtag die Wäsche nicht mehr aufhängen konnte und der Weg zwischen Schlosserei und dem Wohnhaus nur noch unter großen Mühen zu begehen war. Das stellte sich als sehr unangenehm heraus, war das Wohnhaus seit einiger Zeit ja nur noch auf diese Weise zu erreichen. Der große Schwingarm der Pumpe, der zwanzig Fuß lang war, reichte von Hauswand zu Hauswand und die beidseitig an der Pumpe angesetzten Lederschläuche, die ein Vermögen gekostet hatten, mussten sogar über das Hausdach gelegt werden, weil für sie kein Platz mehr vorhanden war. Auch dies ertrug Sieke mit Gelassenheit.
Als die beiden Männer aber eines Spätnachmittags im April die Pumpe ausprobieren wollten und dafür sechs kräftige, junge Leute in den Hof bestellten, die den Pumparm bedienen mussten, war Sieke zum ersten Mal sehr ungehalten geworden. Boye hatte für dieses Experiment den Ansaugschlauch in den Hofbrunnen und den Schlauch zum Abführen des Wassers zur Straße hin verlegt. Nachdem er einige Eimer Ansaugwasser in das Gerät gegossen hatte, gab er Bendix den Befehl zum Pumpen. In weniger als einer Minute war der Hofbrunnen bis auf den tiefen Grund entleert. Das Wasser aber lief die Straße hinunter, als wenn eine Sturmflut das Innere der Stadt erreicht hätte, und es förderte am Schluss so viel Schlamm aus dem Brunnen mit, dass die Straße in den folgenden Tagen nicht mehr zu begehen war, bis mehrere Regenschauer langsam die Spuren verwischt und weiter fort getragen hatten.
Trotz des Ärgers, den Boye und Bendix mit Sieke bekamen, die sich in den folgenden Tagen das Frischwasser von Bekannten zu besorgen hatte, und trotz der Anfeindungen der Nachbarn, deren Wasserspiegel in den Brunnen ebenfalls gesunken war, die aber auch wie Sieke den Schlamm auf ihre Höfe und in ihre Häuser trugen, waren die beiden Männer überglücklich und begegneten allen bösen Worten mit Humor. Allerdings erhielten sie von Sieke die Auflage, sofort die Unglückspumpe abzubauen und vom Grundstück zu schaffen.
Dem beugten sie sich ohne Mühe, montierten das Gerät wieder auf der Straße, versahen es mit vier großen, eisernen Rädern und transportierten es erst mit einem, später mit drei Pferden bei ohrenbetäubendem Lärm über das Kopfsteinpflaster zum Hafen, wo unter Anwesenheit des alten Pedersen ein weiterer Beweis für die Funktionstüchtigkeit der Pumpe abgelegt und dem Hafen Wasser entnommen und wieder zugeführt wurde.
Der örtliche Rat der Stadt überlegte in der Folge, Boye die Pumpe abzukaufen, um sie dem Brandaufseher zur Verfügung zu stellen. Man löste sich aber nach langem Abwägen von diesem verlockenden Gedanken, weil man rechtzeitig erkannte, dass die schwere Pumpe ein Feuer erst dann erreicht haben würde, wenn es seine Aufgabe erledigt hätte. Dennoch gab man eine Offerte ab, um die Pumpe bei größeren Sturmfluten einsetzen zu können. Boye aber schüttelte wortlos den Kopf.
Er hätte das Gerät niemals verkauft, denn nur er, Bendix und Pedersen hatten nicht nur gesehen, was die Zuschauer am Hafen bemerkten, dass die Pumpe ein großes Wasservolumen transportieren konnte. Ihnen war vor allem aufgefallen, dass sich an der Stelle, wo das Wasser angesaugt worden war, eine tiefe Kuhle im Hafenschlick gebildet hatte. Die Pumpe konnte somit ein großer Erfolg im Mahlsand werden.
Als Boye und Bendix mit Bootsmann in den folgenden Monaten mehrfach bei Hohlebbe den Unglücksplatz im Mahlsand aufsuchten, waren sie erstaunt, dass die Masten manche Male fast zehn Fuß aus dem Sand hervorstachen, andere Male aber nichts von der Bark zu sehen war. Ihre Ausflüge sprachen sich schnell herum, und dies wurde dann auch mit dem merkwürdigen Verhalten der Männer in Verbindung gebracht, die sich geweigert hatten, eine so umwerfende Erfindung wie die Pumpe zu verkaufen.
Langsam wurde immer klarer, dass sie vorhatten, die Bark CAROLINE zu heben.
Einige würdigten dieses Vorhaben mit allergrößter Bewunderung und boten sogar ihre Partnerschaft, zumindest aber ihre Hilfe an. Andere verwiesen schon einmal rechtzeitig auf den ja allen bekannten Geisteszustand des Schlossers, über den man sich schon immer einig gewesen war, auch wenn dieser Zustand zu einer so erstaunlichen Erfindung wie die der Pumpe geführt habe. Nur zwei, vielleicht aber auch nur einer in der Stadt, machten sich ganz andere Gedanken über das Vorhaben.
In der Hölle der Apotheke, die nun auch das Wohnzimmer Jaspersens eingenommen hatte, äußerte dieser allergrößte Bedenken über das Vorhaben Deletres gegenüber Klaasen, denn er hatte durch angeblich verlässliche Quellen Auskunft über die Schiffsladung erhalten. Quellen dieser Art waren in der Stadt keine Seltenheit. Manche wussten mit Sicherheit von der Zollinspektion, dass die Bark Goldbarren transportiert hatte. Andere hatten über den Postmeister erfahren, dass sich Waffen und hochexplosive Stoffe an Bord befanden, die beim Heben des Schiffes eine weit hörbare Explosion herbeiführen und jeden zerreißen würden, der sich in der Nähe aufhalten würde.
Jaspersen allerdings war berichtet worden, dass archäologische Funde aus Kopenhagen transportiert worden waren, um sie andernorts Interessierten vorzuführen. Dabei konnte es sich nur um Funde aus dem nordischen Altertum handeln, folgerte Jaspersen, weil er an gar keine anderen nennenswerten Funde als die aus der nordischen Heroenzeit denken konnte. Er hatte als Student immer wieder das neu entstandene Museum für das nordische Altertum in Kopenhagen besucht und einen unverschüttbaren Zugang zur Geschichte seines Volkes und zu dessen Ursprünglichkeit gefunden.
An langen Abenden in der Hölle hatte er Klaasen, der allerdings das Museum kannte, die einzigartigen Entdeckungen und gut erhaltenen Fundstücke im Detail geschildert. In seiner Bibliothek befanden sich sowohl Johann Friedrich Camerers BändeBriefe von einigen merkwürdigen Gegenden der Herzogthümer Schleswig und Hollsteinund auch DenDanske Atlasdes Bischofs Erik Pontoppian. Bei den langen Referaten über die Zeiten der Vorväter nahm Jaspersen gern die Sammlung alter dänischer Volkslieder, Balladen und Märchen von Wilhelm Grimm, den er zu dieser Zeit noch verehrte, sowie eine neu erworbene Ausgabe derDanske Folkesagnhervor, um lang und umständlich zu rezitieren.
So war es für Klaasen zwar nicht besonders verwunderlich, dass Jaspersen sich nach dem ihm zugeführten Bericht ebenfalls Gedanken über die CAROLINE MATHILDE und die Mahlsand-Expedition machte. Nachdem aber der Apotheker, der jetzt fast immer eine viel zu große, verschmutzte und verätzte Schürze trug, dem Pastor eine Ballade vorgetragen hatte, die sich nach vielen dramatischen Wendungen schließlich doch dem Ende genähert hatte, weckte er Klaasen plötzlich mit der Behauptung, die Hebung des Schiffes durch die ganze Bagage um Boye Deletre sei ein staatsfeindlicher Akt.
Klaasen, der diese Äußerung zunächst noch im direkten, thematischen Zusammenhang mit den gerade gehörten Titanengeschichten wähnte, wurde der krasse Themenwechsel erst langsam bewusst, als Jaspersen erörterte, die Zeugnisse der Urkräfte eines Volkes wie der Dänen dürften unmöglich von einem Schlosser und einem Walfänger geborgen werden. Noch weniger wäre daran zu denken, dass diese Schatzheber auch noch den Anspruch erheben dürften, dieses Volksgut in ihr privates Eigentum eingehen zu lassen. Klaasens zaghafter Einwurf, man könne diese Männer doch den Schatz heben lassen, um ihn dann von dänischer Staatsseite aus wieder käuflich zu erwerben, quittierte Jaspersen mit einer abfälligen Handbewegung, bei der er wegen der Enge des Raumes eine Flasche übel riechender Flüssigkeit von einem Regal fegte. Damit war dieser Abend beendet.
In der folgenden Zeit ließ sich Jaspersen alles zutragen, was mit den Vorbereitungsarbeiten zur Schatzhebung im Zusammenhang stand. Die meisten dieser Informationen erhielt er vom Postmeister, der schon seines Amtes wegen über alles in der Stadt Bescheid wusste. So erfuhr Jaspersen auch von dem Kaufvertrag zwischen Pedersen und der Reederei und von der eigentlichen Funktion, die Pedersen bei dieser Sache zu haben schien. Aus diesem Grunde begann er, ein scheinbar zufälliges Treffen zwischen sich und Pedersen vorzubereiten, wobei er auf die Unterstützung des Postmeisters zurückgriff.
Jedem war bekannt, dass die Lehnsleute der Halbinsel monatlich zu einer Landesversammlung in der Stadt zusammentrafen. Vom Postmeister aber erfuhr Jaspersen nicht nur die Zeit des Sitzungsbeginns und den zeitlichen Verlauf der Sitzungen, sondern auch die Gewohnheiten des Lehnsmanns, die darin bestanden, am Morgen des Tages zunächst die Familie seiner Tochter zu besuchen und nach der Versammlung noch bis in die Nacht mit den Lehnsleuten im gleichen Lokal weiterzutrinken, bis er dann sehr spät die Heimreise antreten würde. Und diesen letzten Zeitpunkt wollte Jaspersen eines Tages ausnutzen, weil er sich versprach, einen von dem Tag ermüdeten Mann anzutreffen.
Die Arbeit im Mahlsand aber verzögerte sich und wurde in den folgenden Monaten allgemein fast vergessen, weil Boye und Bendix mit den Vorbereitungsarbeiten nur langsam vorankamen. Zum Teil fehlte Geld, doch auch die Schlosserei forderte viel Zeit. Die Arbeit an dem gesamten Unternehmen lief allerdings weiter. Während Boye eine Schüttkippe baute, die auf Spuren laufen sollte, vertiefte sich Bendix in zwei technische Errungenschaften, über die in dieser Gegend noch nicht viele Erfahrungen vorlagen, das Eisengießen und der Dampfantrieb.
Für diese Arbeiten war die Schlosserwerkstatt schon viel zu klein geworden.
Als Boye seine Eisenspuren auf Holzbalken genagelt, aus dem Garten und um die Nebengebäude herum bis zur Straße verlegt und die Schüttkarre abendelang mit grollenden Geräuschen hin und her geschoben hatte, war er schon auf den Protest seiner Frau gestoßen. Es gelang ihm jedoch, diesen abzuwenden, indem er Sieke zeigte, mit welcher Leichtigkeit nun Brennholz, Torf, Kartoffeln, Schweinefutter und Schlossermaterial transportiert werden konnten. Auch als sich Bendix immer weiter ausbreitete, große Sandhaufen im Gemüsegarten aufschüttete, den Schweinestall mit Holzformen zustellte und einen großen Brennofen auf dem Hofplatz baute, blieb Sieke, die mehr Toleranz dem Bruder als dem Ehemann entgegenbrachte, noch relativ ruhig. Als aber schließlich ein zweiter Ofen mit einem großen Wasserkessel darüber auf dem Grundstück entstand, dieses Wasser erhitzt wurde und der Dampf zischend aus wild über den Hof verlegten Rohren entwich, sodass nicht nur das Grundstück, sondern das gesamte Viertel bis zur Kirche außer in Rauch auch in dichten Nebel gehüllt war, forderte Sieke ein grundsätzliches Gespräch.
Es war ein warmer Sommerabend, an dem sie Stühle und einen Gartentisch auf den verbliebenen Platz des Hofes gestellt und zwischen Schienen, Rohren, Sand und Holz eine Bowle bereitet hatte. Nachdem beide Männer verschwitzt und verschmutzt am Tisch saßen, stand Sieke vor ihnen wie vor kurzer Zeit Pedersen, als er anlässlich der Taufe eine Ansprache gehalten hatte. Sieke hatte große Ähnlichkeit mit ihrem Vater. Pedersen war zwar massiger und hatte kaum noch Haare. Doch auch Sieke strotzte wie ihr Vater vor Kraft und Gesundheit, hatte seinen breiten Körper und seinen großen Kopf mit den kleinen, blitzenden, blauen Augen. Ihre vollen Haare waren rotblond, glatt und sehr dick. Der Zopf, den sie sich daraus um den Kopf band, schien endlos lang zu sein.
So stand sie dicht vor den beiden schmutzigen Männern und wies darauf hin, dass sie die Hebung des Schiffes immer unterstützt habe und auch anerkennen müsse, dass die Schlosserei trotz aller übrigen Interessen der Männer weiterhin floriere. Sie erwähnte auch ihre Freude darüber, dass es so ein enges Vertrauensverhältnis zwischen den beiden und zu dem alten Vater gäbe. Noch größer aber sei ihre Freude darüber, dass Bendix durch die gemeinsamen Pläne nun keine der gefährlichen Grönlandfahrten mehr plane. Andererseits aber sei sie durch die Ausweitung der Arbeit in ihrer häuslichen Tätigkeit stark eingeschränkt, würde keinen Platz mehr für das Trocknen der Wäsche finden, hätte kaum noch Zugang zum Schweinestall, zum Brunnen und der Latrine und müsse nun auch noch auf den Gemüseanbau im Garten verzichten. Sie teilte dann mit, sie würde ihre Hausarbeit demnächst einstellen, da sie zwar noch in der Lage sei, diese durchzuführen, aber durch die geschilderten Umstände weitaus mehr Zeit benötige, als der gesamte Tag ihr gäbe. Im Übrigen könne sie sich nicht genügend um die Kinder kümmern, die auf dem Grundstück ohnehin keinen Platz mehr zum Spielen finden würden.
Obwohl Boye und Bendix sofort eine große Einschränkung ihrer Tätigkeit darin erkannten, wenn sie von nun an eventuell selbst einkaufen, kochen, waschen und reinigen müssten, begannen sie zunächst damit, die herausragende Bedeutung ihrer Arbeit zu erklären.
Boye betonte nochmals die allgemeine Nützlichkeit seiner Schüttkarre für den Haushalt, hatte dieses Argument aber schon zu häufig benutzt, als dass es ihm in diesem Gespräch noch Vorteil verschaffen konnte und verstummte zunehmend.
Dagegen gelang es Bendix, ein Bild des zukünftigen Wohlstands durch seine neuen Erkenntnisse zu malen. Von englischen Seeleuten hätte er von der unglaublichen Wirkung der Feuermaschinen gehört, die in Werkstätten andere Maschinen antrieben, Schiffe und Schienenwagen bewegten und den Bauern das mühselige Dreschen abnehmen würden. Diese Entwicklung werde unterstützt durch die Eisengießerei, bei der man Formen herstellen könne, die ein Schmied, Schlosser oder Wagenbauer nur nach sehr langer Arbeit oder auch niemals erschaffen könne. Der Bruder verstieg sich sogar in den Gedanken an fliegende, vom Dampf angetriebene Apparate, mit denen man aus der Luft heraus auf Walfang gehen könne, indem man über dem Wal schwebe wie eine Möwe.
Boye, der sich in diesem Fall einmal eher und etwas näher im Bereich des Ausführbaren aufhielt, verband in einem erneuten Redebeitrag die Erfindung seiner Pumpe mit der Erfahrung um die Dampfausnutzung, Eisengießerei und Schienenkarre. Er schilderte Sieke die Möglichkeit einer dampfbetriebenen Brandwehr in der Stadt, die schnell und auf Schienen zu jedem Haus des Ortes gelangen könne.
Obwohl die Männer immer neue und fantasiereichere Umsetzbarkeiten ihrer Arbeiten aufzeigten und sogar auf den schon erprobten Nutzen in anderen Ländern hinwiesen, schienen sie damit Sieke nicht umstimmen zu können, die darauf hinwies, sie würde ihre Hausarbeit trotz allem in Kürze komplett einstellen, wenn sich nicht grundsätzlich etwas ändere.
Damit waren Boye und Bendix nun vor existentielle Probleme gestellt, die sie noch weiter als die sich zunehmend verzweigenden Vorbereitungsarbeiten von ihrem Plan, der Schiffshebung, abbrachten. In langen und tiefschürfenden Debatten versuchten sie, eine für alle tragbare Lösung zu finden, die ihnen sowohl die Arbeitskraft Siekes wie die Fortführung ihrer wegweisenden Entdeckungen sichern sollte.
Doch erst ein Gespräch mit Pedersen brachte ihnen einen zeitlichen Aufschub der Arbeitsniederlegung Siekes.
Pedersen schickte ein junges Mädchen von vierzehn Jahren in die Stadt, Ingke Ketels, die Sieke nun im Haus half. Außerdem schlug er den beiden Männern vor, sich ähnlich wie mit der Kippkarre mehr Gedanken darüber zu machen, wie die neuen technischen Erkenntnisse auch für die Hausarbeit Siekes nützlich werden könnten. Damit eröffnete Pedersen bei Boye und Bendix zwar einen neuen Beschäftigungsbereich, der nichts mehr mit dem eigentlichen Plan gemein hatte, hoffte aber, mit einiger Verzögerung den großen Traum umso günstiger und schneller verwirklicht sehen zu können.
Der gesamte Sommer und Herbst 1824 verging damit, Erfindungen für den Haushalt auszudenken und wieder zu verwerfen. Dabei war man auf die Idee gestoßen, mit einem Räderwerk wie bei einer Uhr eine Bewegung fortzusetzen, die die Wäsche in einem Bottich sich drehen ließ, bis sie gesäubert war, die aber auch gleichzeitig eine Mangel, einen Webstuhl, ein Mahlwerk und rotierende Messer bedienen konnte.
Zur technischen Weiterbildung reisten die beiden Erfinder sogar in die umliegenden Städte, besuchten Uhrmacher und hielten sich stundenlang in den Uhrwerken der großen Kirchen auf. Ebenso erkundeten sie die umliegenden Mühlen und untersuchten genau den Mechanismus, der durch das Drehen der Flügel in Gang gesetzt werden konnte, studierten die Übergänge von der Flügelwelle und dem Kammrad auf das Kronenrad und die Königswelle und schließlich auf das Spindelrad und die Spindel. Zu Hause saßen sie dann zusammen, um die Geheimnisse der Übersetzung von Zahnrädern rechnerisch und zeichnerisch zu entschlüsseln. Dabei kamen sie auf den Gedanken, die Drehbewegungen auch zum Antrieb einer Scheibe zu nutzen, auf der die Kinder im Garten spielen könnten und auf der kleine Pferdewagen und Segelschiffe langsam im Kreis fahren würden. Schließlich reifte in den beiden Männern aber ein Vorhaben, das – so weit bekannt - in den Herzogtümern Schleswig und Holstein und weit darüber hinaus nicht seinesgleichen fand.
Es war die Idee einer kombinierten Wasser-, Heißwasser- und Heizversorgung des Wohnhauses, ein Vorhaben, die sofort in Angriff genommen wurde.
Zunächst jedoch mussten Gartengrundstücke aus der Nachbarschaft erworben werden, um mehr Platz zu schaffen und Siekes Ablehnung weiter zu mindern. Dafür nahm Boye Geld bei seinem Schwiegervater auf. Dann begann man mit der Errichtung eines Lagerplatzes für Holz, Torf und englische Steinkohle sowie eines Heizkessels mit darüber liegendem Wasserkessel. Außerdem wurde ein neuer und sehr tiefer Brunnen gegraben. Bendix beschäftigte sich mit der Herstellung und Verlegung der Rohre, weil Boye eine neue Pumpe konstruierte, die das Wasser sowohl zum Kessel wie auch zum Wohnhaus drücken und nicht mehr von einem Menschen, sondern durch Wasserdampf bewegt werden sollte.
Als die weitere Arbeit in dem strengen Winter unterbrochen wurde, hatte sich das gesamte Grundstück verändert. Der Hof, der Stall und die Latrine waren wieder frei zugänglich. Nur die ehemaligen Gärten sahen für einen ungeübten Betrachter aus wie ein Schlachtfeld. Der für die Rauchabführung geplante Schornstein ragte schon zehn Fuß aus allem hinaus und deutete den Anwohnern und zufälligen Besuchern an, dass sich hier etwas sehr Bedrohliches anbahnen würde.
Eine gesamte Wandlänge meines Raumes fasst die Bibliothek Jasper Jaspersens. Hinter großen, verglasten Türen habe ich mir diese Bücher erhalten, von denen sehr viele aus dem Besitz seines Vaters, eines alten jütischen Apothekers aus Skagen, stammen. Alle Bücher haben einen Wasserschaden. Noch wertvoller sind mir aber die Bücher Pedersens und natürlich die von Anders. Sie stehen ebenfalls hinter Glas an der anderen Wandseite. Es sind Schätze – was immer daraus wird.
Im neu angebrochenen Jahr 1825 hatte sich Jasper Jaspersen ein Herz gefasst, um endgültig das Gespräch mit Pedersen einzufädeln. Trotz einer drohenden Sturmflut hatten sich die Lehnsleute unter Vorsitz des Pfennigmeisters in den ersten Februartagen versammelt, um über die Hebung der Abgaben und die allgemeine Rechnungsführung für die einzelnen Kirchspiele zu beraten. Jaspersen hatte an diesem Tag die Apotheke geschlossen, weil er sich mithilfe seiner Bibliothek gut auf das Zusammentreffen vorbereiten wollte. Nach Einbruch der Dunkelheit zögerte er aber sein Fortgehen immer weiter hinaus, bis er sich endlich entschloss, sich neu ankleidete und in großer Hast durch den Sturm zur Gaststätte, dem Ort der Versammlung, peste.
Zum Glück saß Pedersen noch dort vor einem dampfenden Grog und befand sich in einem langsam auslaufenden Gespräch mit mehreren Kleinbauern der Umgebung. Auf den ersten Blick registrierte der Apotheker, dass die Bauern vor leeren Gläsern saßen und sich offensichtlich auf den Nachtweg vorbereiten wollten. Jaspersen, dessen Erscheinen in der Gaststube für ungewöhnlich gehalten wurde, weil er solche Orte in der Regel mied, erregte sofort großes Aufsehen und wurde von Pedersen zu einem starken Getränk eingeladen, während die Bauern planmäßig ihren Rückzug durchführten.
Von Pedersen auf die Wirtschaftlichkeit der Apotheke angesprochen pries er den guten Ruf seines Geschäftes und seiner eigenen Erfindungen, über die tatsächlich viel gesprochen wurde. Dann versuchte er, den alten Mann sehr geschickt auszufragen und sich nach dem Wohlergehen der Familie Deletre zu erkundigen, wobei er, wie jeder andere auch, die Vokale des Nachnamens breit aussprach. Auf seine Frage, woher wohl dieser ungewöhnliche Name käme und ob etwa ein französischer Soldat oder Seemann dahinterstecken würde, erntete er einen langen Vortrag über die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich und über die schon immer liberale Grundhaltung der Menschen in diesem Teil des Landes, die offen gegenüber Fremden seien und jedem Tüchtigen eine gute Chance gäben, so auch dem Apotheker, der sich ja prächtig eingelebt habe und sehr schnell Ratsmann geworden war.
Diese Äußerung empfand Jaspersen als boshaften Angriff, wollte aber wegen der Verfolgung seines eigentlichen Ziels nicht darauf eingehen. Dennoch verlor er zunächst sein Konzept, denn immer wieder mischte sich der ketzerische Gedanke des Altbauern in seine Strategie ein.
Bei einem weiteren Grog verließ ihn schon seine Diplomatie, und er fragte geradeheraus, wo denn die versunkene CAROLINE MATHILDE eigentlich liege, auf schleswigscher oder auf holsteinischer Seite des Flusses, und ob es bei dieser Unklarheit nicht rechtlich bedenklich sei, die erhofften Schätze privat vereinnahmen zu wollen. Pedersen antwortete sehr spontan und fragte: „Was geht denn das den Apotheker an?“
Dennoch verlor Jaspersen auch jetzt nicht seine Fassung: „Hier handelt es sich doch um dänisches Nationalgut, Herr Pedersen. Liegt dieses jedoch auf holsteinischer Seite, dann kommt doch eventuell Ihre Abmachung mit Kopenhagen nicht zur Geltung, weil Holstein dem deutschen Bund angehört.“
Pedersen wies darauf hin, dass die CAROLINE MATHILDE ein dänisches Schiff gewesen und mit dänischer Ladung versunken sei. Entsprechend habe er dänische Verträge abgeschlossen, und das Herzogtum Holstein würde - wenn auch Mitglied im Deutschen Bund - von Dänemark verwaltet werden.
Doch gerade das zuletzt genannte Argument nahm Jaspersen zum Anlass weitschweifender Ausführungen. Er ging zunächst darauf ein, dass die Verwaltung großer Teile von Schleswig und Holstein trotz eines 1776 erlassenen Gesetzes, das nur in Dänemark Geborenen erlaubte, Ämter im Königreich einzunehmen, von Deutschen oder deutsch Gesinnten wahrgenommen würde.
„Im Übrigen“, so stellte er weiter fest, „kennen wir doch das deutsche Denken, besonders das der deutschen Professoren, die, nachdem die Geschichte des nordischen Altertums nun wie ein offenes Buch vor uns liegt, uns dieses nehmen wollen, indem sie sich als Teil unserer Geschichte begreifen. Doch unser Volk, mein lieber Pedersen, hat durch seine Vergangenheit eine ganz eigene Prägung. Wir sind Dänen und Skandinavier und haben mit den rückständigen deutschen Kleinstaaten so wenig gemein wie mit den Romanen und Slaven. NORDENS AAND und NORDENS OLDEN, das ist unser, Pedersen. Die Umarmung der Deutschen weisen wir zurück.“
Der Lehnsmann hatte Äußerungen dieser Art schon mehrfach gehört und auch gelesen, sich aber immer einer ernsthaften Auseinandersetzung damit verweigert. Zum ersten Male in seinem Leben nahm er nun aber Stellung: „Mein lieber Jaspersen, ich weiß nicht so genau, was dieses Thema mit der CAROLINE zu tun hat. Wenn Sie aber meine Meinung zu dieser Sache hören wollen, dann sage ich Ihnen: Ich bin Friese!“
Das rief bei Jaspersen einen viel zu hohen und lauten, hysterischen Ton hervor, durch den andere Gespräche in der Gaststube zunächst verstummten. Das allerdings bemerkte er nicht und führte unerschrocken und für alle hörbar das Gespräch fort: „Und ich bin Jüte, Pedersen, und beide sind wir Dänen. Dänen! Wir haben loyal zu unserem König zu stehen. Was auch immer dieses Schiff für archäologische Kostbarkeiten transportiert hat. Es gehört Dänemark.“
Mit dieser Äußerung hatte Jaspersen endgültig die konzentrierte Aufmerksamkeit aller Zuhörer auf sich gelenkt, und alle bemühten sich kräftig, die nun leiser werdenden Sätze des Apothekers auch noch zu verstehen, wenn sie auch nicht zu begreifen waren: „Pedersen, ich biete Ihnen meine Hilfe und Verschwiegenheit an. Wir holen die Sachen aus dem Schiff raus, bevor die deutschen Professoren es überhaupt bemerken.“
Plötzlich kam es zu einer für fast jeden Gast bedauerlichen Unterbrechung, weil der Gemeindeausrufer Lorenzen die Tür der Gaststube aufgerissen hatte und laut hineinbrüllte: „Krebse! Krebse! Auf dem Marktplatz!“
Zunächst verharrten alle in kurzem Nachdenken darüber, ob man dem schwachsinnigen Ausrufer Meldungen dieser Art glauben könne. Dann jedoch fiel einigen ein, dass die übrigen Meldungen, die Lorenzen auszurufen hatte, recht häufig der Wahrheit entsprachen. Sehr schnell zahlten alle Gäste, zogen sich warm an und verließen die Gaststätte, unter ihnen auch Pedersen und Jaspersen. Es war nach zehn Uhr abends, und die Kirchenglocken hatten angefangen zu läuten.
Der stürmische Marktplatz, und nur dieser Platz, war dicht besiedelt mit handgroßen, bräunlichen und hellblauen Krebsen, die entweder still dasaßen oder langsam übereinander herliefen. Da keine neuen Tiere dazukamen, war all den Anwohnern, die herbeigeeilt waren, unklar, woher die Krebse wohl kämen und ohnehin, warum sie sich zu dieser außerordentlichen Versammlung eingefunden hätten. Staunend und stumm standen mehr als siebenhundert Menschen mit Laternen um den Platz herum, bis Klaasen aufgefordert wurde, das überflüssige Geläute endlich abzustellen, denn es seien ja nur Krebse, und es gäbe keine Bedrohung durch Sturmflut, Feuer oder irgendeine angreifende Armee. Nach Beendigung des Glockenlärms lösten sich zunehmend Menschen aus der Menge, holten Säcke und sammelten so viele Tiere ein, wie sie tragen konnten. Doch so viele Krebse auch eingesammelt wurden, schien ihre unglaubliche Menge nicht abzunehmen. Klaasen nutzte diese Nacht für eine kleine Predigt unter offenem Himmel, erzählte von den neun Plagen, über die Moses berichtet hatte und erwähnte besonders ausführlich die zweite Plage, die Frösche.
„Bittet den Herrn für mich“, brüllte er in die Dunkelheit, „dass er die Frösche von mir und meinem Volk nehme, so will ich das Volk lassen, dass es dem Herrn opfere.“
Einige Anwesende nahmen diese Worte sehr ernst, einige aber schüttelten den Kopf, denn Frösche waren doch etwas völlig anderes und nicht so ohne weiteres mit Krebsen zu vergleichen.
Um Mitternacht trennte sich Pedersen von dem verstummten Apotheker, dem er den Rat gab, in der zuvor besprochenen Angelegenheit doch eher Kontakt mit dem Sohn und Schwiegersohn herzustellen.
Am nächsten Morgen wurde kein Krebs mehr auf dem Marktplatz gesehen, und nur die Festessen, die an diesem Tag in vielen Häusern stattfanden, zeugten von dem nächtlichen Ereignis. Noch wochenlang hielt sich hartnäckig das Gerücht in der Stadt, die Tiere seien aus unterirdischen Gängen der vor mehr als hundert Jahren geschleiften Festungsanlage gekommen, denn diese Gänge würden die gesamte Stadt untertunneln, seien aber bei dem Hochwasser in der Nacht vollgelaufen. Gegen Morgen hätten die Tiere dann schnell und unerkannt ihre Behausung wieder eingenommen, wo sie nun weiterleben würden in Gemeinschaft mit vielen anderen Tieren, die nie jemand gesehen habe, die aber sicher eine Bedrohung darstellen würden. Einige verstiegen sich sogar zu der Behauptung, diese Tunnel würden bis zum örtlichen Friedhof führen, wo die verschiedenartigen Tiere reichlich Nahrung vorfinden würden, denn wie sonst könnten sie überleben.