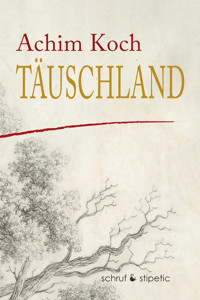9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schruf & Stipetic
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einem abgelegenen kongolesischen Dorf glaubt Kniep Hölstenberger ein sicheres Versteck gefunden zu haben. Doch ein deutscher Diplomat stöbert ihn auf und zwingt ihn zur Rückkehr nach Europa. Im Einbaum fahren sie über den Lomami und den Kongo nach Kinshasa. Von dort geht es zurück nach Hamburg, zurück zu Knieps Vergangenheit und den Gründen für seine Flucht nach Afrika. Zehn Jahre zuvor: Kniep und eine Handvoll Wissenschaftler scharen sich um den charismatischen Viktor Vermehren. Gemeinsam wollen Sie die Welt vor dem unumkehrbaren klimatischen Kipppunkt retten. Bei ihren Aktionen und Recherchen stoßen sie jedoch auf rätselhafte Einzelereignisse, die nichts mit dem Klima zu tun haben. Was zunächst keinen Sinn ergibt fügt sich allmählich zu einem Bild, das eine unvorstellbare Katastrophe ankündigt. Und einer aus ihrer Mitte hat sie ausgelöst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Achim Koch
G.R.A.S.
Achim Koch: G.R.A.S.
© Schruf & Stipetic GbR, Berlin 2015 www.schruf-stipetic.de
Coverfoto © nito / fotolia
ISBN: 978-3-944359-11-3
Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Schruf und Stipetic GbR.
Inhalt
Sababu ya watoto wangu
1. Jahre gleiten hier vor sich hin, reisen ohne Zeit
2. der trügerische Zustand der Schwebe
3. es reichte, gemeinsam zu beobachten
4. uns selbst beherrschen und damit auch das Wetter kontrollieren
5. für den Weisen ein Segen, für den Narren eine Beleidigung
6. welcome in God′s waiting room
7. die eigene Farbe verloren
8. Menschen legen Menschen ins Gras
9. guten Menschen geschehen immer gute Dinge
10. ein äuβerlich unentschiedener Mensch
11. auf der Suche nach dem Lebendigen
12. jeder geht allein in die Nacht
13. Menschen sind gern vergesslich
14. viele können viel tun
15. was kostet ein Mensch
16. sie flogen ins Ungewisse
17. Teil der täglichen Wirklichkeit
18. ein Krieg gegen die Natur
19. der Verlauf der Zeit an mir
20. durch den Horizont blicken
21. weniger Menschen machen viel kaputt
22. nichts regte sich
23. der Schrei des Käuzchens
24. my first, my last, my everything
25. das Ende des Lebens
26. Worte helfen nicht mehr
27. die Menschen suchen die Nähe zueinander
Sababu ya watoto wangu
Wir hatten nur auf unser Wissen, auf die Naturgesetze und auf immer bedeutendere Entwicklungen und Erfolge gesetzt. Es gab nie ein wirkliches Zurück, es gab nur kleine Krisen in der Wirtschaft, in politischen Systemen, in Atomanlagen oder durch unvorhergesehene Naturereignisse.
Immer hatten wir Lösungen gefunden. Immer ging es schnell weiter voran. Bis es dann eines Tages endete und uns all unser Wissen nicht mehr zu helfen schien. Nun ersetzten fatalistische Hoffnung, neu entdeckter Glaube und tiefe Apathie den stets optimistischen und auf die Zukunft gerichteten Pragmatismus. Wären wir nicht dem Zwang des nicht abreißenden Fortschritts gefolgt, dann wären wir besser vorbereitet gewesen. Doch so stürzten wir in einen unbekannten Abgrund, viel tiefer als andere Völker der Erde, die genügsamer geblieben waren.
1.
Jahre gleiten hier vor sich hin, reisen ohne Zeit
Wir wussten schon seit drei Tagen, dass er kommen würde, und waren gut vorbereitet. Nachrichten konnten sich bei uns pfeilschnell verbreiten: Ein Msungu ist mit dem Zug in Kibombo angekommen und sucht Niep. Niemand hätte erwartet, dass irgendwann einmal ein Weißer in diese Gegend kommen würde. Dabei hätte ich es eigentlich wissen müssen. Doch wie hatte er mich gefunden? Fast alle standen am Rande von Tunga und hörten, lange bevor wir etwas sahen, das laute und fröhliche Palaver aus dem Wald anschwellen. Dann entdeckten wir ihn. Er saß auf dem ausladenden Gepäckträger eines alten, schweren, indischen Fahrrads und ließ sich den schmalen Trampelpfad entlang schieben. Das Rad hatte nur noch das, was es wirklich brauchte. Die Pedale waren abgerissen, Schutzbleche abgefallen, die Lampen und die Klingel wahrscheinlich verkauft. Der verbogene alte Handbremshebel diente als Haken zur Befestigung von Transportgütern. Um den Weißen herum erkannte ich Fahrradschieber, Träger, einige Ortskundige, aber vor allem diejenigen, die sich aus den Dörfern, durch die er gereist war, einfach angeschlossen hatten, zunächst sicherlich nur, um vor Ort zu erfahren, warum jemand Niep suchte. Einige hatten ihre Kinder mitgebracht oder schleppten bei dieser Gelegenheit Lasten auf dem Kopf, die vielleicht immer schon einmal nach Tunga transportiert werden sollten. Es war ein lustiger und bunter Haufen. Die Frauen trugen Pagnestoffe in starken Farben und aus den gleichen Stoffen Tücher mit kunstvoll gewundenen Schleifen auf den Köpfen. Ihre Farben vermischten sich mit denen der Männer, dem Pastell der T-Shirts und Shorts, die einmal zum hippen Leben in Europa oder Asien gehört hatten. Die fremden, verblichenen Hemden der Besucher erinnerten mich an längst verworfene Zeiten. Portraits von Madonna, Motive von Lady Gaga und Justin Biber, Werbung für die neue C-Klasse, für Samsung oder Jägermeister, Trikothemden von Lahm, Messi, Balotelli oder andere mit Sprüchen wie Hetz mich nicht, Never say never, Sex me. Ich allein wusste noch, was all das vor vielen Jahren bedeutet hatte. Für die Träger der Hemden hier aber war das unerheblich. Alle gingen barfuß. Schon von Weitem winkten sie und riefen erste Begrüßungen, die aus dem Dorf laut beantwortet wurden. Den Weißen zu begleiten war wahrscheinlich nur der Anlass. Man wollte sich wieder einmal ausführlich besuchen. Der Mann stieg umständlich vom Fahrrad und stakte wie auf Stelzen auf uns zu. Er trug schmutzige Khakihosen, eine mit Außentaschen übersäte fleckige Khakijacke, hohe Tropenstiefel aus Stoff, eine Cap auf der eindeutig DEBAKEL stand und eine viel zu kleine Brille, die in sein rundes Gesicht eingewachsen zu sein schien. Seine dunklen, langen Haare waren am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden. Er schien weitaus jünger zu sein als ich. Vielleicht Mitte dreißig. Aber er wirkte, als würde ihm der gesamte Wald von hier bis zum Kivusee gehören. »Karibu!«, sagte ich. »Das heißt Willkommen«, erklärte ich auf Deutsch. Ja, und dann kam dieser dämliche Stanley-Livingston-Satz: »Dr. Kniep Hölstenberger, I pressume?« Amisi stand würdevoll neben mir. Er hatte seine Tracht angelegt, einen kunstvoll bestickten Umhang mit vielen Federn und trug die traditionelle Kopfbedeckung auf dem immer kahl rasierten Schädel. In der Hand hielt er seinen schweren schwarzen Holzstab, in den Tiermotive eingeschnitzt waren. Um den Hals hatte er sich eine Kette gelegt, an der viele spitze Zähne hingen. Nicht allzu überschwänglich, eher ernst und vornehm winkte er den Besuchern aus den anderen Dörfern zu. Wie immer bei offiziellen Anlässen behielt er Kontenance, denn Amisi war sich seines Amtes bewusst. Ohne den Blick von unserem Besucher zu lösen, raunte er mir möglichst unauffällig zu: »Was ist das denn für ein komischer Typ?« Der Msungu schaute uns abwechselnd und mit leicht geöffnetem Mund an. Dann reichte er mir selbstherrlich aber mit einem leicht debilen Grinsen die Hand: »Ich bin Ronald von der deutschen Botschaft.« Während wir noch Hände schüttelten, wandte ich mich zu Amisi und blickte erwartungsvoll in sein regungsloses Gesicht. Diesen Ausdruck hatte er in Momenten größter Anspannung. »Dieser Herr«, sagte ich zu diesem Ronald von der deutschen Botschaft, »ist der Chef Coutumier, der König hier, wenn Sie so wollen.« »Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen«, sagte er zu Amisi - auf Deutsch. Nichts geschah, bis ich merkte, dass ich übersetzen musste. »Der Typ heißt Ronald, ist von der deutschen Botschaft und freut sich, dich zu sehen.« »Frag den komischen Weißen, ob er Französisch oder Suaheli spricht«, teilte Amisi mir mit einem immer noch versteinerten, fast ablehnenden Gesichtsausdruck mit. »Der König freut sich auch«, übersetzte ich, »und würde gern erfahren, ob Sie Suaheli sprechen.« »Tut mir Leid«, antwortete er, »aber ich spreche Französisch«. »Er spricht nichts von allem«, wandte ich mich fröhlich an Amisi. Daraufhin rief er laut: »>Jambo!« Und deshalb riefen alle um uns herum auch: »Jambo!« Und damit war die Begrüßungszeremonie zunächst einmal beendet und das Besuchsprogramm konnte beginnen. Amisi forderte uns auf, ihn zu seiner Hütte zu begleiten. Er besaß die größte Parzelle im Dorf. Nur seine Hütte trug kein Dach aus Bananenblättern, sondern war mit einer alten, großen Plastikplane bedeckt, auf der das Symbol und der Schriftzug der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR zu erkennen war. Niemand schien mehr zu wissen, wie diese Plane ins Dorf und auf Amisis Dach gekommen war. Pflanzen, die aussahen wir Säulenkakteen, aber Wolfsmilchgewächse waren, fassten seine Parzelle ein. Sie dienten weniger als Zaun, sondern zum Trocknen von Amisis Zweitwäsche, die darüber ausgelegt war. Um seine Lehmhütte herum hatte er von seinen Frauen anbauen lassen, was seine große Familie zum Essen benötigte, vor allem Maniok, doch auch Süßkartoffeln, Erdnüsse und Palmölbäume. Wir nahmen vor der Hütte auf schiefen dreibeinigen Hockern Platz. Auch der alte Simba kam mit seinem Papagei dazu. Er trug ein so verblichenes T-Shirt, dass nicht mehr zu erkennen war, welche Botschaft es einst verkündet hatte. Wie alle im Dorf war auch er barfuß. Er hockte sich auf den Boden vor das vom Regen ausgewaschene Fundament der Hütte. Eine von Amisis Frauen, Onga oder Inga - es waren zu viele -, bot uns Wasser und Erdnüsse an. Niemand sprach, bis der Deutsche all seine vielen Außentaschen durchgefingert hatte, schließlich einen Zettel hervorkramte, ihn umständlich auseinanderfaltete, Amisi bedeutungsvoll zureichte und mit dem gleichen debilen Grinsen sagte: »Bevor ich es vergesse, das ist meine Ordre de Mission. Wenn Sie so freundlich sein könnten, sie mir abzustempeln, zu unterschreiben und das heutige Datum einzutragen.« Amisi hielt das Blatt in der Hand wie die vergiftete Spitze eines Pygmäenpfeils. Nahezu hilflos starrte er mich an. »Was will der Typ von mir?« »Du sollst das abstempeln und das heutige Datum einfügen.« Amisi drehte und wendete das Papier endlos lange in der Hand. »Ich hab′ den Stempel schon seit Monaten nicht mehr gesehen und ich kenn′ auch das heutige Datum nicht.« »Steht das Datum nicht auf deiner Uhr?«, fragte ich laut und die Frauen in der Hütte begannen albern zu kichern. Amisi war der Einzige im Dorf, der eine Uhr trug. Sie war fast so groß wie ein Wecker, glänzte unübersehbar in einem auffälligen Rotgold und wurde von einem breiten, protzigen Metallband gehalten. Es war so lang, dass die Uhr um sein Handgelenk schlackerte. Alle wussten, dass sie nicht lief, denn Amisi kannte weder Zeit noch Datum, um sie zu stellen. »Mensch, Amisi«, sagte ich, »gib das Blatt Inga oder Unga und lass sie etwas Schwarzes draufdrücken. Der Typ sollte bald wieder verschwinden. Findest du nicht auch?« Ohne den Körper und den Kopf zu bewegen, hob Amisi langsam das Dokument, hielt es hinter seinen Kopf in Richtung der Hütte und zischte laut zwischen den Zähnen. Sofort näherte sich eine der Frauen lautlos von hinten. Ohne den Kopf zu wenden, erteilte Amisi den Auftrag so leise, dass auch ich nichts verstand. Schweigend warteten wir, bis die Frau zurückkehrte und Amisi das Papier überreichte. Dabei hielt sie es mit zwei Händen und deutete einen untertänigen Knicks an. Sie blieb in ihrer Wartehaltung, bis Amisi ein Nicken andeutete. Das Papier sah perfekt aus. »Das Datum und Ihre Unterschrift noch«, sagte der Botschaftsmann, nachdem er die Ordre kritisch untersucht hatte. Amisi hatte verstanden und tastete auffällig an seinem traditionellen Umhang herum, als würde er dort seit jeher einen Stift tragen. Der Deutsche half mit einem Kuli aus, auf dem DIPLO KINSHASA stand. »Haben wir heute schon den Fünften?«, fragte Amisi mich scheinbar abwesend und in betonter Langeweile. »Haben wir heute schon den Fünften?«, übersetzte ich. Der Botschaftsmann sah auf seine Armbanduhr. »Nein, den fünfundzwanzigsten.« »Nein, den fünfundzwanzigsten«, übersetze ich. Aus der Hütte war wieder aufsässiges Kichern zu hören, denn in Tunga gab es keine Geheimnisse. Amisi setzte an, um das Datum einzutragen, unterbrach sich aber und sah mich stumm und durchdringend an. Ich gab diesen Blick an den Botschaftsmann weiter, der einige Zeit benötigte, um ihn zu deuten. »Mai«, sagte er dann plötzlich und es hörte sich fast wie eine Frage an. »Fünfundzwanzigster Mai.« »Fünfundzwanzigster Mai«, übersetzte ich. Amisi malte das Ergebnis umständlich über den schwarzen Fleck, unterschrieb, reichte das Papier mit einem abweisenden Blick zurück und schweren Herzens auch den Kuli. Doch der Botschaftsmann zeigte ihm seine offenen Handflächen, um deutlich zu machen, dass Amisi den Kuli behalten konnte. Er ließ ihn irgendwo auf Brusthöhe zwischen seinen Federn verschwinden, ohne danke zu sagen. Wieder sprach niemand. »Schweres Leben hier, was?«, begann der Botschaftsmann nach einiger Zeit. »Sollte man mal ein richtiges Projekt starten. Zur nachhaltigen ländlichen Entwicklung. Neue Anbaumethoden. Verbessertes Saatgut vermehren. Fruchtwechsel. Hier muss man ja nur den Finger in den Boden stecken und schon wächst was. Meine Güte, Sie leben hier wirklich in einem Paradies. Hier gibt es ja alles. Bananen, Ananas, Avocados, sogar Kaffee. Und dann all das Gemüse.« Amisi sah mich fragend an. »Das hier ist ein Paradies, sagt er«, übersetzte ich. Bedeutsam schweigend, doch mit ausladenden Kopfbewegungen nickte Amisi vor sich hin. »Und er meint«, fuhr ich fort, »in Tunga sollte man vielleicht mehr in die Landwirtschaft investieren und moderne Anbaumethoden umsetzen. Es sei sehr fruchtbar hier.« Wieder das gleiche stumme und lange Kopfnicken. »Ich bin diplomierter Agraringenieur und habe in Lubumbashi studiert«, brummte Amisi schließlich ungehalten vor sich hin. »Weiß ich doch«, sagte ich. »Er aber nicht«, erwiderte er. »Sag′s ihm. Und sag ihm auch, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.« »Der König findet Ihren Vorschlag hochinteressant und hat sich schon mit ähnlichen Fragen beschäftigt.« Das Gespräch stockte wieder. Der Botschaftsmann hatte weder die Erdnüsse noch das Wasser angerührt, und Amisi fielen wie häufig bei solchen Treffen die Augen zu. Vielleicht war Anspannung der Grund dafür, vielleicht aber wollte er auch demonstrieren, wie überarbeitet und übermüdet er war. Seine traditionelle Kopfbedeckung, die aus vielen Federn und kleinen eingetrockneten Reptilien bestand, rutschte ihm über die nackte Kopfhaut bis auf den Nasenrücken. Hinter dem Wolfsmilchzaun war Getuschel zu hören. »Ich sollte Ihnen nun unsere Hütte zeigen. In einer Stunde wird es dunkel«, sagte ich schließlich und erhob mich. Amisi erwachte aus seinem Kurzschlaf. Der Botschaftsmann streckte ihm die Hand hin und stammelte: »Vielen Dank, zunächst mal, Herr ..., Herr König. Aksanti.« Amisi blickte mich fragend an. Doch ich hatte keine Lust mehr zu übersetzen. Im Dorf begannen die Trommeln. Der Deutsche holte mich ein. Wir spazierten durch ein Spalier von Frauen, die ein vielstimmiges Begrüßungslied sangen, den Botschaftsmann dabei berührten und immer »Ronad, Ronad« sagten, vielleicht um sich den Namen zu merken. Einige, die es konnten, begannen zu trällern und rhythmisch zu klatschen, und schließlich hörte man in der Savanne um uns herum und aus vielen Kilometern Entfernung auch erste Trommeln. Ihr Rhythmus veränderte sich sehr schnell. Es war eine Antwort, vielleicht eine Kommentar auf den Gesang. So flossen Nachrichten bei uns. »Was sagen Sie?«, fragte ich Simba, der uns begleitete. »Sie feiern mit uns und sagen, schöne Dinge wachsen inmitten der Dornen«, gab er zur Antwort. »Was für Dornen?« Simba zuckte mit den Schultern. »Na, Dornen eben. Was weiß ich. Die Mühsal der Reise vielleicht. Wie soll ich das wissen, Niep?« Ich würde nie begreifen, wie man mit Trommeln eine so komplizierte Nachricht transportieren und verstehen konnte.
Amra hatte vor unserer Hütte ein Feuer entzündet und innen ein weiteres Bett aufgestellt. In einer Kasserolle hatte sie Fleisch und Fufu vorbereitet und war dann verschwunden. Der Mann trat in die Hütte und sah sich um. »So wohnen Sie also«, sagte er überrascht. »Lehmboden, Lehmziegel und ein Blätterdach? Und das seit Jahren schon, seit zehn Jahren. Und wo arbeiten Sie? Kein Schreibtisch, kein Labor, nichts. Nur ein altes Mikroskop auf einem wackligen Tischchen. Kaum Bücher. Überall vergilbtes, zerfressenes Papier. Verschmutzte Reagenzgläser.« »Was haben Sie erwartet?«, fragte ich zurück. »Das Max-Planck-Institut oder das MIT in Tunga?« »Nein«, antwortete er, »aber ein Minimum an wissenschaftlicher Ausstattung. Sie publizieren nichts. Seit Jahren hat man nichts mehr von Ihnen gehört. Kein Aufsatz. Kein Forschungsbericht. Sie haben immer noch einen offiziellen Forschungsauftrag, der von der Weltbank bezahlt wird. Das ist Ihnen doch wohl klar.« »Stimmt«, sagte ich im Rausgehen, »worum ging es dabei noch mal?« Er folgte mir hastig: »Grundlagenforschung zur Zertifizierung von hochwertigen Bäumen. Das wissen Sie doch genau.« »Ja, weiß ich«, erwiderte ich grob und etwas zu laut. »Aber Ihnen ist ja wohl klar, dass das nur ein Vorwand war. Ich bin Botaniker und Mikrobiologe. Fachgebiet Pilzforschung. Taxonomie der Pilze. Ich bin kein Förster. Die Schaffung von Zertifizierungsgrundlagen von Baumholz zur Verhinderung des wilden Einschlagens ist überhaupt nicht mein Fachgebiet. Außerdem wird hier kein Edelholz geschlagen und verkauft. Es gibt keine Transportwege. Das haben Sie ja vielleicht auch schon bemerkt. Dieser Forschungsauftrag war unsinnig. Ein Scheingrund, ein Alibi, ein Deckmantel, um mich los zu werden, um mich möglichst weit wegzuschicken. Und, wenn möglich, für immer. Und die Weltbank, ich weiß nicht, wohin die Geld überweisen. Haben Sie hier eine Sparkasse oder eine Postbank gesehen?« Es verletzte mich immer noch. Nach so vielen Jahren. Wie war das möglich? Hier in Tunga, tausende Kilometer und viele Jahre entfernt von Europa. Ich wusste nicht einmal, wie viele Jahre. Ich hatte sie nie gezählt. Jahre glitten hier vor sich hin, reisten ohne Zeit. Es gab keine Buchhaltung mehr über Regen oder Trockenheit. Die Jahreszeiten waren nicht mehr so klar zu unterscheiden. Leben auf einer Kurve, die ihre jährlichen Sattelpunkte hat, war hier nicht bekannt. Es fand auf einer Geraden statt, die sich irgendwo verlor. Und es interessierte eigentlich niemanden, wo das war. Die Zeiteinheit hieß für mich schon lange nicht mehr Jahr sondern Tunga. Ich hatte mir diesen Ort selbst ausgesucht. Niemand konnte wissen, wo ich war. Tunga war meine Entscheidung gewesen, nicht die der Weltbank. Doch - wie selbstgerecht ich mich diesem Deutschen gegenüber verhielt! Wir saßen am Feuer. Ich wärmte das Essen auf. Amra hatte nicht nur Piri-Piri mit Fufu vorbereitet, sie hatte sogar den sandigen Hof gefegt, die gesamte Parzelle gesäubert. Der Besucher sah sich meinen Garten an. Auch ich baute an, was ich zum täglichen Gebrauch benötigte. Bei mir standen die Papaya- und Orangenbäume allerdings schnurgerade in einer Reihe. Schmale Wege trennten kleine Felder mit Maniok von Erdnüssen oder Süßkartoffeln. Alles wuchs kräftig aus dem Boden, nicht besser oder schlechter als bei allen anderen, nur etwas übersichtlicher. Ich beruhigte mich langsam. Warum hatte ich mich so unbeherrscht aufgeführt? Alles nur, weil hier ein debil grinsender Deutscher auftauchte? Eigentlich hätte das schon viel früher geschehen können. Andererseits wusste niemand, wo genau ich mich aufhielt. Jetzt war es nun einmal geschehen. Nach so viel Tunga. Ich holte die Wasserkaraffe aus der Hütte, nahm Seife und wusch mir die Hände. Der Deutsche beobachtete mich und tat es mir nach. Wir saßen auf niedrigen Hockern. Ich stellte die Kasserolle neben uns auf den Boden, begann mit den Fingern Fufu zu lösen und damit das zerschnittene Fleisch und die Soße aufzunehmen. Der Andere schaute mich etwas unglücklich an. »Sie haben nicht zufällig ...« »Nein«, antwortete ich ein wenig zu laut. »Nehmen Sie die Finger.« Er wollte sich gerade etwas von dem Maniokkloß ablösen, als ich ihn wieder heftig anfuhr: »Rechte Hand!« Wir schwiegen. Hühner scharrten dicht bei uns im Sand. Der alte Simba hatte sich nur wenige Meter entfernt unter einen Mangobaum gehockt und spielte mit Kasuku, seinem Papagei. »Kesho«, rief der Vogel. »Kesho!« »Warum sagt er immer Kesho?«, fragte der Deutsche. Ich schwieg lange und aß. Ich war noch nie so zufrieden mit mir und mit meiner Arbeit gewesen wie hier. Ich bin es immer noch. Und jetzt schrie ich einen an, weil er mit der falschen Hand essen wollte. Ich sollte mich zusammennehmen, freundlich sein und zusehen, dass der Mann bald wieder abreiste. »Das heißt morgen«, antwortete ich schließlich ein wenig versöhnlicher. »Es ist wohl das meist gebrauchte Wort hier.« »Und warum das meist gebrauchte Wort?«, fragte er mit vollem Mund. »Das erklär ich Ihnen morgen«, gab ich zur Antwort. »Verstehe«, sagte er. »Was du heute kannst besorgen, das verschieb erst mal auf morgen.« »So ungefähr. Man sollte es nicht zynisch betrachten. Es ist ein großer Luxus. Man kann ihn sich leisten.« »Die Gegenwart ist ein Luxus?«, fragte er. »Das Morgen ist hier nur wichtig, wenn es darum geht, sich die Gegenwart zu erhalten«, fuhr ich fort. »Die Bedeutung für das Leben liegt im Jetzt. Es gilt, die Gegenwart mit allen Poren des Körpers zu genießen, sie in sich aufzusaugen, wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Glaub′ schon«, sagte der Deutsche. Das Öl, von dem Amra immer reichlich zum Kochen nahm, glänzte um seinen Mund. »Morgen könnte alles schlimm werden«, fuhr ich nach einer Pause fort. »Krankheit, Krieg, Flucht, Tod. Man baut dem zwar ein wenig vor. Doch im Wesentlichen bleibt nur das wertvoll, was gerade erlebt wird. Nur ein Lügner ist in Eile, sagt man hier.« Ich hatte schon lange nicht mehr so viel an einem Stück gesprochen. Er beobachtete mich genau, achtete auf all meine Bewegungen. Und dennoch, er schaute mir immer nur kurz in die Augen. Das war neu für mich. Es fehlten ihm die offenen Augenblicke, an die ich mich in Tunga gewöhnt hatte.Augenblick, ein deutsches Wort. Es war eigenartig, aber im Suaheli existierte es nicht einmal. Es war nicht nötig. Man sah sich offen in die Augen, weil man mit den Augen sprach. Dank, Gruß, Zustimmung, Zweifel, Besorgnis und vor allem: Du bist nicht allein. In Europa gab es Augenblicke unter Freunden. Sonst fast nur die Wörter. Aber Wörter können kaum etwas über Gefühle sagen. Und wenn, dann klingt es immer hart, fremd und ausgedacht. »Das Hier und Jetzt. Geht Ihnen das auch so?«, fragte der Mann von der Botschaft mit vollem Mund. »Ist Ihnen Zukunft auch nicht so wichtig?« Ich ließ mir Zeit mit der Antwort. »Nein, mir geht′s nicht immer so«, sagte ich dann. »Ich werde mich leider nie ganz daran gewöhnen. Und an vieles will ich mich nicht gewöhnen.« »Was denn?«, führte er das Gespräch nach einer Pause fort und taxierte mich verstohlen. Ich überlegte. »Tunga ist nicht das Paradies. Ich vermisse oft den Respekt vor dem Leben, eine noch stärkere Ehrfurcht vor der Natur, vor Pflanzen ...« »Wieso Ehrfurcht vor Pflanzen?«, fragte der Deutsche. »Der Unterschied zu Tieren ist nicht so groß, wie viele denken«, erklärte ich. »Pflanzen reagieren wie Tiere, nur langsamer, leiser, unauffälliger. Sie haben keine Nerven, sondern Botenstoffe. Aber sie können sehen, riechen, schmecken ...« »Und davor empfinden Sie Ehrfurcht, Herr Hölstenberger?« »Ja«, gab ich zögernd zur Antwort. »Und ich kann mich auch nicht an ... fehlendes Mitleid gewöhnen ... zum Beispiel mit Tieren.« »Mit Tieren«, sprach er langsam vor sich hin. »Und gibt es für Ihr Problem mit Menschen auch einen Spruch in Tunga?« Ich ließ mir wieder Zeit mit einer Antwort. Was konnte ich ihm anbieten, damit er es verstand? »Für nahezu alles gibt es hier kleine poetische Weisheiten«, sagte ich dann. »Wie wäre es damit: Wer seinen Hund liebt, der muss auch seine Flöhe lieben.« Er schüttelte den Kopf und lachte laut auf. »Und was heißt Papagei?«, wollte er nach einigen Minuten wissen. »Kasuku.« »Und Wasser?« »Maji.« »Und Reise?« »Safari.« Er suchte nach weiteren Wörtern. »Fluss?« »Mutoni.« »Schiff?« »Merkebu.« »Freunde?« »Rafiki.« »Europa?« »Bulaya.« Zum Glück schien ihm nichts mehr einzufallen. Wir schwiegen wieder. »Und Kinder«, begann er zu meiner Überraschung nach einer langen Pause. »Watoto! Was ist das hier? Ein Suahelikurs?«, herrschte ich ihn mit einem Mal laut an. Simba blickte von seinem Spiel mit Kasuku auf. Ich spürte, wie er mir eindringlich ins Gesicht sah. »Was wollen Sie von mir?«, brüllte ich im Aufstehen. Er sah mich aufmerksam und kühl an. Ein scheinbar offener Blick, der kurz zu Simba wanderte und dann zu mir zurückkehrte. Ich wartete einen Moment. Dann ging ich weg. Im Dorf saßen fast alle vor ihren Hütten und aßen. Freundlich grüßten sie, einige luden mich ein mitzuessen. Es fiel mir schwer, meine schlechte Stimmung zu verbergen. Die meisten hatten mich ohnehin schreien gehört. Schließlich kehrte ich zurück. Versonnen und scheinbar unbeeindruckt kaute der Botschaftsmann vor sich hin. »Haben Sie sich ein wenig die Füße vertreten?«, fragte er in einem Tonfall, als wäre nichts vorgefallen. Ich setzte mich wieder. »Erstaunlich, dass ein so unterspannter Mann wie Sie so ausrasten kann«, fuhr er fort. »Das hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt.« »Also, warum, verdammt noch mal, sind Sie hergekommen?«, fragte ich etwas beherrschter. Kasuku krächzte: »Watoto. Watoto.« Wir schwiegen. Die kurze Zeit, in der die Vögel scheinbar alle noch einmal vor dem Schlafen laut musizierten, hatte begonnen. Ich suchte den Zusammenhang zu den Trommeln. Sie schienen den Takt vorzugeben. Ein gemeinsames Konzert. Wie immer eine Improvisation. »Um Sie abzuholen«, sagte er plötzlich kaum hörbar in die Musik hinein und aß dabei ruhig weiter. »Sie müssen dieses Land verlassen. Sie müssen nach Deutschland zurück.« Das Konzert war abrupt unterbrochen. Ich wäre fast noch einmal ausfallend geworden. Doch ich nahm mich zusammen. »Na dann«, entgegnete ich schließlich, »können Sie ja gleich morgen wieder abreisen, Herr Stanley.« »Ich glaube«, fuhr er ganz gelassen fort, »ich bleibe noch ein, zwei Tage, bis Sie gepackt haben, Dr. Livingston.« »Na dann ...«, wiederholte ich scheinbar gelangweilt, stand wieder auf, wusch mir die Hände, holte zwei Plastikbecher aus der Hütte und schenkte Wasser ein. Auch er wusch sich die Hände und fingerte wieder in seinen vielen Außentaschen herum, bis er eine Tablette Silberionen herauslöste, sie zerbrach und ein Stück davon in seinen Becher warf. Schnell fiel die Dunkelheit über uns her, als wollte sie das Gespräch zudecken. Wir blickten in das niederbrennende Feuer, bis ich es mit Sand abdeckte. »Warum lassen Sie es nicht runterbrennen?«, fragte er. »So haben wir morgen ein wenig Holzkohle«, erwiderte ich. »Wissen Sie«, fragte er mich auf dem Weg zur Hütte, als wäre nichts zwischen uns vorgefallen, »dass Brasilien nach dem Wort für Holzkohle benannt ist? Das Holzkohlenland. Da wird ein ganzes Land abgebrannt.« Ich sah ihn erstaunt von der Seite an und er bemerkte meinen Blick. »Ach, ich vergaß«, fügte er dann schnell, fast zu schnell hinzu. »Sie kennen ja Brasilien. Dort hat man Sie auch gezwungen, das Land zu verlassen. Erst flohen Sie aus Brasilien, dann aus Deutschland und nun aus dem Kongo. Eigenartig. Macht Sie das gar nicht nachdenklich, Doktor Hölstenberger?« Ich ging nicht darauf ein und zeigte ihm stumm sein Bettgestell aus Bambusstangen. Er breitete Kleidungsstücke darauf aus, um etwas weicher zu liegen und befestigte sein Mückennetz. Ich löschte die Petroleumlampe und wir begaben uns zur Ruhe. Draußen begannen die Frösche und Grillen ein neues Konzert. Der Deutsche wollte noch wissen, wie weit der Fluss Lomami vom Dorf entfernt sei. »Vielleicht zwei Kilometer«, antwortete ich wortkarg. Doch dann fügte ich hinzu: »Die Menschen hier sind keine Flussmenschen wie im Norden. Es gibt kaum Boote. Der Lomami ist gefährlich und voller Krokodile und Flusspferde.« Nach einer langen Pause wollte ich meine Erklärung noch beenden: »Und ein bedrohlicher Fisch lebt dort.« »Wie die Piranhas?«, fragte er sehr müde. »Nein, viel größer. Fast wie ein Hai.« »Wie ein Hai?« »Der Goliath Tigerfisch, hydrocinus goliath, aus der Familie der afrikanischen Salmler, eine Teleostei, ein Echter Knochenfisch, eine gefährdete Art. Steht auf der Roten Liste.« »Noch nie gehört«, sagte er schläfrig. »Er kann bis zu eineinhalb Meter groß werden und vierzig oder gar fünfzig Kilo schwer.« »Ist er bösartig?«, fragte der Deutsche gähnend. »Gefährlich an ihm sind seine spitzen Zähne«, fuhr ich müde fort. »Zweiunddreißig von diesen kleinen Speerspitzen hat er im Maul. Sehen Sie sich mal die Kette von Amisi an. Das sind keine Zähne von Raubkatzen, die da hängen. Die sind vom Tigerfisch. Die Kette ist von Amisis Vorfahren. Niemand weiß, wie alt sie ist. Doch bevor Amisi sie anlegt, bittet er seine Vorfahren immer um Erlaubnis. Jedes Mal.« »Na ja«, sagte Ronald, »wenn der Fisch auf der Roten Liste steht. Und der heißt wirklich Tigerfisch? Ich meine, in Afrika gibt es doch gar keine Tiger. Wieso wird er dann sogenannt?« »Die Belgier nannten ihn so. Tigre goliath. Wie alles andere benannten sie auch den Fisch allein aus ihrer Sicht. Hier heißt er Mbenga.« Weit aus der Savanne klangen große Trommeln mit tiefen Klängen. Die Grillen zirpten jetzt noch lauter. So würde es bis zum frühen Morgen bleiben. Brasilien kam mir wieder in den Sinn. Dort hatte ich mich zur Botanik entschlossen. In einem Camp, das wir nach Chico Mendes benannt hatten. Eine internationale Gruppe junger Studenten. Wir glaubten damals, wir könnten die Abholzung des Regenwaldes verhindern. Von den wirklichen Machtverhältnissen im Land hatten wir keine Ahnung. Und auch nicht von der Brutalität der Grundbesitzer. Das Camp wurde niedergebrannt. Viele von uns wurden verletzt. Und ich erhielt Einreiseverbot für fünfzehn Jahre. Aber ich hatte für mich die Botanik entdeckt und die Pilze. In jeder Niederlage lauert eine Chance. Ich dachte, dieser Ronald wäre schon eingeschlafen, als ich ihn plötzlich aus der Dunkelheit hörte: »Ihre Stimme, Hölstenberger, daran hab ich Sie sofort wiedererkannt. Nicht an Ihrem Äußeren. Sie sind zu einem sehr dünnen, unscheinbaren Mann geworden, haben keine Brille mehr mit runden Gläsern. Ihnen fehlt irgendwie dieses elegante Forscherimage, mit dem Sie damals echt Wirkung erzeugten. Und den schicken Anzug tragen Sie natürlich auch nicht mehr. Statt dessen ein zerlöchertes Hemd und einen Vollbart wie einer der Missionare auf alten Fotos. Aber Sie sind immer noch begeistert von Ihrer Biologie.« Aufmerksam hörte ich zu. »Wissen Sie, dass ich all die Sendungen LEBEN gesehen habe. Immer wieder. Schon als Jugendlicher. Vor allem die erste, später die über Wissen und Handeln und dann Ihre letzte Reportage. Die ist unvergesslich. So etwas hat es nie wieder gegeben. Ist Ihnen eigentlich klar, in welcher Weise Sie damals meine Generation beeinflusst haben, Dr. Hölstenberger? Und mit welcher Suggestion? Ich habe alle Sendungen bei mir zu Hause auf dem Rechner. Sie waren unser Held, Kniep Hölstenberger. Wegen Ihnen wurden Freunde von mir Ethnologen, Mikrobiologen, Biochemiker oder Ärzte. Wegen Ihnen bin ich in den diplomatischen Dienst gegangen. Sie haben also selbst Schuld, dass gerade ich es bin, mit dem Sie nun von hier fliehen müssen.«
2.
der trügerische Zustand der Schwebe
Die Idee war genial gewesen. Und sie stammte nicht von mir. Geniale Ideen kamen eigentlich immer von Vermehren, meinem Doktorvater am Botanischen Institut, dem Biozentrum. Er war das Genie. Ich war nur seine Stimme. Ihm blieb damals schon keine Zeit mehr für die Forschung und auch nicht für die Lehre. Er hielt sich kaum noch im Institut auf. Seinen Platz hatte er mir vermacht. Wenn auch nicht offiziell, denn vom Fach her waren wir beide zwar Botaniker, doch mein Spezialgebiet war die Pilzforschung, die Mykologie. Victor Vermehren war Evolutionsbiologe und Ökologe und damit weit über die Botanik hinaus spezialisiert. Als er seine Arbeit in der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen aufnahm und später dann zusätzlich den Internationalen Verband zur Erforschung von Nutzpflanzen, ICRCP leitete, war er zum Politiker geworden, ein Vertreter der Bio-Macht. Er war Mitglied im Umweltrat der EU, schrieb Bücher und Artikel. Vor allem reiste er durch die Welt, um an Konferenzen teilzunehmen. Konferenztourismus nannte er es. Sein ökologischer Fußabdruck war riesig. Im Biozentrum aber hatte er immer noch ein Büro, in dem ich seinen Mailordner pflegte, ihm wichtige Mails an seine aktuellen Adressen nachsandte und neben meiner Forschung an der mikrobiologischen Klassifizierung von Pilzen den Betrieb aufrechterhielt. Wir telefonierten meist einmal in der Woche, und obwohl ich nicht sein Assistent, sondern eher sein Freund war, delegierte der Professor ständig neue Aufgaben an mich. Meine Tage, meine Wochen waren ohnehin immer gleich. Ich fuhr morgens mit dem Rad ins Institut, blieb acht, zehn, manchmal zwölf Stunden, kehrte zurück, kaufte ein, besuchte meine Freunde im Haus, las, hörte Musik. Nur die Wochenenden unterschieden sich ein wenig. So begann ich, zunehmend Artikel für meinen Freund Vermehren zu schreiben, die er immer häufiger ohne sie zu redigieren übernahm, nachdem er mir den meist überraschend genialen Leitgedanken zuvor gemailt hatte. Später schickte er mich sogar in die Öffentlichkeit, wenn er verhindert war. Zunächst hielt ich auf Konferenzen kleine Reden, die wir als seine eigenen ausgaben. Schließlich nahm ich für ihn an einigen Interviews teil, denn die für viele immer noch frappierenden, oftmals kurios anmutenden aber einleuchtenden Gedanken des Professors konnte ich mühelos wiedergeben. Eines Abends rief er mich zu Hause an. Er saß an seinem Schreibtisch in Rom. »Pass auf, Kniep. Ich hab nur drei Minuten. Der Sturm auf den Balearen. Hilfsmaßnahmen, Gelder usw. Das geht noch die ganze Nacht durch. Die bisher größte Katastrophe in Europa. Menorca, Mallorca und Ibiza sind stark betroffen. Auch viele deutsche Opfer. Da ist heute eine Talkshow über die Ursachen des Unglücks. Ich hab dich schon angekündigt. Livesendung, 21 Uhr. Die geht online. Du musst um 19 Uhr im ARD-Studio sein. Ist wichtig. Bist du noch dran?« »Ja, aber ...« »Da sitzt so ′n Wirtschaftsfritze aus der EU. So ′n Lobbyist von der Chemie. Den lässt du einfach reden. Geh auf dieses Greenwashing erst gar nicht ein. Sei konkret, aber nicht faktisch. Fakten vergessen die Menschen sofort. Ob das jetzt drei oder dreizehn Tausend Opfer waren, weiß morgen keiner mehr. Beschreibe die Kettenreaktion, die aus der Folge von Dürre, Bränden, Wirbelsturm, Regen entstand. Und vor allem das Ausfallen der Rettungsmaßnahmen, den Mangel an Trinkwasser, die Sorgen der Eltern um ihre Kinder, die fehlende ärztliche Versorgung. Achte auf die emotionale Ebene. Erst dann werden die Leute wach. Und geh an die Ursachen.« »Verstanden.« »Gut, dann sitzt da so ′n Regierungspolitiker aus irgendeinem reaktionären Ökoverein. Den lässt du auch reden, aber unterbrich ihn richtig hart, wenn er das Wort Umweltkrise, Klimawandel oder Energiewende in den Mund nimmt. Natur hat keine Krise. Sprich von Verharmlosung, Zukunftsblindheit und besteh auf die Begriffe Katastrophe und Kollaps. Immer wieder. Was er auch sagt. Da kannst du gern ein wenig die guten Umgangsformen verlassen. Aber mach es charmant. Du kennst die Richtung. Es geht nicht mehr um einzelne Beeinträchtigungen, wie die es immer darstellen, sondern um das gesamte Lebenssystem, stimmt′s?« »Klar.« »Wichtig ist, immer wieder zwischen natürlichen und unnatürlichen Naturkatastrophen zu unterscheiden. Weißt du ja. Wird immer noch vermischt. Das Problem der Balearen ist anthropogen. Aber vermeide Fremdwörter. Sag also einfach, die Katastrophe sei menschengemacht, ein Ergebnis der Klimaveränderungen usw. Okay?« »Glaub schon.« »Gut. Ich muss wieder zurück. Noch zwei Sachen. Da sitzt noch einer vom Umweltverband. Irgendeine NGO. Dem stimmst du immer zu. Es sei denn, er redet totalen Blödsinn. Du brauchst zumindest eine Fünfzig-Prozent-Mehrheit. Am Schluss darfst du dann noch einmal kurz sprechen. ′Ne Art Resümee. Damit musst du die Moderatorin und auch die Zuschauer kriegen. Und das machst du mit folgendem Satz: Ist nicht von mir, sondern von Friedman, aber nicht schlecht. Wahrscheinlich auch abgekupfert. Musst du dir das noch aufschreiben?« »Nee, ist schon gut.« »Na, also, Kniep. Das wird schon. Aus dir machen wir noch ′nen richtigen Profi. Du weißt ja: Wissen und der Gebrauch von Wissen ist nicht das Gleiche. Mach′s gut.« »Tschüss Victor.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!