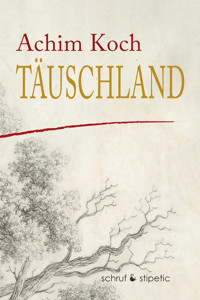Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mattis Jensen war einst der Shooting-Star der deutschen Kunstszene, doch seit dreißig Jahren lebt und arbeitet er zurückgezogen in einem alten Hafenschuppen. Er denkt über das Licht nach und über eine Wende in ein digitales Zeitalter, über einen Epochenwechsel, nach dem sich in der Gesellschaft alles und auch das Denken neu stellen wird. Sein abgeschiedenes Leben endet mit dem zufälligen Wiedersehen eines alten Jugendfreundes, der in den Bildern Jensens spekulatives Potential erkennt. Innerhalb weniger Tage baut dieser Freund ihn innerhalb der Kunstszene zu einem Maler der Zeitenwende auf. Viel wichtiger aber ist Jensen die eigene Jagd nach einem absoluten Bild, in dem alle festgelegten Dimensionen aufgelöst werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mann hinter dem Bild
Titel SeiteTrotz vieler Veröffentlichungen, Interviews und Berichte, trotz Ausstellungskatalogen und Fotobänden bleiben große Phasen des mehr als dreißigjährigen Schaffens von Mattis Jensen im Dunkeln. Es ist weitgehend unbekannt, in welchem sozialen Umfeld der Maler der Zeitenwende gearbeitet, wie er seine Motive und seinen Malstil gefunden hat, welche Gedanken ihn beim Malen begleitet haben. Wie konnte sich aus der Isolation heraus, in der Mattis Jensen lebte und arbeitete, eine Kunst entwickeln, die wie keine andere einen einschneidenden Zeitenumbruch begleitet?
Um diesen Maler zu verstehen, bleiben heute nur seine Bilder, in denen wir eine rege Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Entwicklung, einen kritischen Diskurs über den umfassenden Einfluss der Digitalisierung auf das Leben und die Persönlichkeit jedes einzelnen erkennen. Sie verstehen sich als Dokument eines Epochenwechsels, „denn die Digitalisierung wird unsere Gesellschaft noch weitaus stärker verändern, als wir auch nur annähernd begreifen. Diese technologische Revolution, von der viele heute schon annehmen, sie würde gerade auslaufen, beginnt erst und wird vor nichts, vor allem nicht vor
unserem Denken Halt machen. Sie führt zu einer allumfassenden Metamorphose unserer Gesellschaft und wird das Leben auf Echtzeit umpolen. Sie wird Vorstellungswelten erzeugen, die nichts mehr mit unserer bisherigen Wirklichkeit zu tun haben werden. Wir werden uns in Zustände begeben können, die außerhalb unserer heutigen Fantasien liegen.“ Jensen kannte diese Sätze des leitenden Microsoft-Mitarbeiters John McArthen (Wahrheit 2.0) sicherlich nicht. Doch er war sich des Epochenwechsels bewusst, und er war in der Lage, die Standortbestimmung künstlerisch umzusetzen.
Mit dem vorliegenden Band liegt ein Angebot vor, den Maler Mattis Jensen ein wenig besser zu verstehen. Die gewählte Form ermöglicht einen vagen Einblick darin, wie die Kunst Jensens entstanden ist. Dabei werden gleichzeitig einige lieb gewonnene Vorurteile und Fehlinterpretationen korrigiert, die Mattis Jensen in ein falsches Licht stellten, denn er war nicht nur ein Künstler seiner Zeit, sondern auch ein Opfer des Marktes, dem er sich erneut öffnete.
Die Fantasie, mit der er seine Bilder schuf, hat im Folgenden ihren freien Weg gefunden, um einen Einblick in die sicherlich entscheidende Woche seines Lebens zu geben.
eine Neuordnung unseres Denkens
Die Stunden fließen schneller dahin als noch vor wenigen Tagen. Was ist nur mit der Zeit? Sie verläuft ohne mich, treibt voran und zurück, zieht mich mit. Manchmal lässt sie mich kurz los, lässt mich noch einmal stehen, taucht ab, nur um mich sofort wieder zu erfassen. Sie ist viel schneller als früher? Ich bin ihr hilflos ausgeliefert.Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Ein Popsong eigentlich. Aus den Siebzigern. Ein Schlager mit Sinn. Erstaunlich. Banalphilosophie. Wer hatte das damals gesungen? Ich komm nicht drauf. Wie hieß der noch? War ganz bekannt.Heute ist schon beinah‘ morgen.
Was wäre, wenn heute schon morgen wäre?
Krystle Warren war in der Stadt gewesen. Vor gerade einer Woche. Ich hatte das Plakat gemalt. Vier mal zwei fünfzig. Die Fotovorlage war von schlechter Qualität. Ich hatte die Sängerin mit einem neonblauen Licht überzogen. Sie stand dicht am Mikro, hielt es mit einer Hand umschlossen, umschmiegte es. Klassisch. Die Perspektive leicht von oben. Nur der Oberkörper war zu sehen. Ihr Kopf und das Mikro größer als der Körper. Die Augen geschlossen. Das Gesicht entspannt. Der Mund leicht geöffnet. Sie sang eine zarte Melodie.
So hing mein Transparent draußen über dem Eingang zum SoulClub, der einzige Veranstaltungsort, für den ich noch Transparente malen konnte. Alle anderen waren schon längst umgestiegen auf billigere Werbefolien. Direktdruck. Online zu bestellen. PVC, rundum gesäumt und geöst. Doch der SoulClub hielt mir die Treue. Warum auch immer. Ich gehörte scheinbar dazu, hatte freien Eintritt und zwei Getränkemarken für jede Show.
Im ersten Teil des Konzertes hatte ich die Marken schon gegen den Hauswein eingelöst. Vom Tresen aus hatte ich Krystle Warren zugesehen. Nur mit einem Schlagzeuger und zwei Gitarristen war sie aufgetreten und hatte ihren unverwechselbaren Jazz so vorgetragen, dass man die Wurzeln ihrer Musik tief spürte, den Blues, den Gospel. Auch Country. Amerikanische Musik. Noch immer. Seit bald hundert Jahren. Doch das könnte bald enden. Wann wird die Zukunft uns näher sein als die Gegenwart?
Vor der Pause färbte sich das Licht langsam in ein Neonblau, wie ich es mir ausgedacht hatte. Eine Wasserfarbe. Krystle Warren sang den zerbrechlichen SongNear the house on the hill, hielt das Mikro so zärtlich in den Händen wie den Kopf eines Neugeborenen. Ich war begeistert von ihr. Und irgendwie auch von mir. Und davon, wie dicht Zeit immer wieder sein konnte. Vielleicht hatte es dreieinhalb Minuten gedauert. Aber die hatten sich festgebrannt.
Damit begann das Ende der langsam vergehenden Zeit, in der ich bisher immer viele Stunden, manchmal Tage verbringen konnte, ohne ihren Verlauf zu bemerken. Danach bin ich an ihr erkrankt, und immer seltener gelang es mir, sie zu drosseln. Ihr zu entkommen. Doch das wusste ich in diesen eingeschweißten Minuten noch nicht.
Zu Beginn der Pause bettelte ich Tine am Tresen um einen weiteren Hauswein an. Wir kannten das Spiel schon. Krystle Warren tönte als Konserve in den Saal. Zuschauer suchten Zuschauer, einige erkannten sich, sprachen viel zu laut miteinander. Am Tresen drängten sie sich um mich herum. Dahinter wurde schnell gearbeitet. Die profitablen Minuten des Clubs. Jetzt mit den Getränken konnte Geld verdient werden. Ich sah Tine hinter dem Tresen unentwegt an. Sie wusste es und lächelte vor sich hin, während ihre Hände gleichmäßig und schnell arbeiteten, Gläser griffen, Flaschen, Tabletts, Geld annahmen, Wechselgeld abzählten. Sie lächelte und bei all diesen automatisierten Handbewegungen stand plötzlich das Glas vor mir. Aus dem Fluss der Bewegung heraus. Wie selbstverständlich. Noch nass vom Abwasch. Leicht warm wie es nur intern serviert wurde. Der Wein schwappte noch hin und her. Der einzige Beweis dafür, dass das Glas eben erst hier abgestellt worden war. Ein Schuss Blick von Tine. Aus dem Lächeln heraus. Ich nahm das Glas, drehte mich zum Saal und lehnte mich an den Tresen. Viele Stühle waren jetzt unbesetzt. Mäntel und Jacken lagen darüber. Kellner sammelten leere Gläser und Flaschen ein.
Plötzlich ein Schrei. Dann weitere Schreie aus der Mitte des Saals. Eine Schlägerei. Ein Tisch kippte um. Glas zerschellte. Noch ein Tisch fiel. Stühle. Einige Zuschauer waren aufgesprungen. Andere bahnten sich einen Weg, um dem Geschehen näher zu sein. Wieder andere zogen sich erschrocken zurück. Manche hielten die Hand vor den Mund und starrten dorthin, woher der Lärm kam. Andere sahen dem Ganzen ungerührt zu. All das ereignete sich sechs, sieben Meter vor mir. Ich erkannte dort nur zwei dunkle nach unten gebückte Anzüge, die sich zunächst kaum bewegten. Sie hielten einen Menschen fest, zogen ihn dann langsam zum Ausgang und versuchten, dabei keine weiteren Tische umzukippen. Sie hielten einen Mann. Einer der Anzüge hatte von hinten einen Arm um seinen Hals geklammert. Mit der linken Hand hatte er sich in dessen Haare gekrallt. Er ging vorsichtig rückwärts. Der Mann zappelte mit den Beinen und röchelte. Der andere Anzug presste mit einer riesigen Hand beide Arme des Mannes so zusammen, dass er sie nicht mehr bewegen konnte. Mit der anderen Hand hatte er den Gürtel und die Hose des Mannes ergriffen. Er zog den fremden Körper mit scheinbarer Leichtigkeit hoch, so dass der Mann über dem Boden schwebte. Profis. Sie transportierten den Mann vor die Tür, beförderten ihn nach draußen. Er rief noch etwas in den Saal. Doch es war nicht zu verstehen.
Schon waren Tische und Stühle wieder aufgerichtet. Das zerbrochene Glas zusammengekehrt. Der Zwischenfall weggewischt. Nichts war geschehen. Ich nippte an meinem Wein. Am Tresen leerte es sich langsam. Die Toilettenbenutzer kehrten zurück. Von meinem Beobachtungsposten aus überblickte ich den Saal. Das Konzert war ausverkauft. Vierhundertfünfzig Zuschaue. Gute fünfzehntausend Einnahme. Dazu fast das Doppelte für die Getränke. Für mein Transparent hatte ich vierhundert erhalten. Mein Verdienst. Der einzige seit langem.
Den Zuschauern gefiel das Konzert. Sie waren entspannt und bestellten immer noch nach. Solange sie bestellten, würde die Pause nicht beendet werden. Ich ließ meinen Blick schnell von einem Gesicht zum anderen gleiten. Viele Paare. Zwischen dreißig und fünfzig. Eltern. Gutverdienende. Das Konzert eine Belohnung für die anstrengende Woche. Ein Geschenk zum Geburtstag, eine Anerkennung, ein Dankeschön. In jedem Fall eine Gefälligkeit. Sonntagabend. Endlich mal wieder eine gemeinsame Unternehmung. Wie fern war ich all dem. Freizeitkleidung. Jeans. Pullover. Insofern passte ich zu ihnen. Doch einige Frauen hatten sich verändern wollen, waren geschminkt, trugen auffällige Kleider, Schmuck. Der besondere Abend.
Und dann blieb mein Blick hängen an einem Gesicht, aus dem heraus ich ebenfalls angesehen wurde. Das Gesicht befand sich genau dort, wo vorher die Tische umgestürzt waren. Es war so, als würde ein heller Strahl unsere beiden Gesichter verbinden, unübersehbar, quer durch den Saal. Um mich herum dimmte der Lärm ab. Alles um uns beide dunkelte ab. Der Strahl brannte noch greller. Jeder musste das sehen.
Hepe.
Sofort entzündete sich etwas in mir, was die bisher gewohnte Stille der Zeit kraftvoll verdrängte. Mein miefiges Dachzimmer mit dem kleinen Klappfenster, durch das man nur den Himmel sehen konnte. Meine einsamenMalzeitenals Kind. Meine stummen Eltern, die sich vor dem Fernseher voneinander fortstahlen. Das abgepackte Landbrot, das sich wochenlang frisch hielt. Unsere Fahrräder. Der Aldi-Parkplatz. Die kleinen Schnapsflaschen überall auf dem Gehweg, in den Hecken oder ordentlich auf die Deckel der Abfalleimer am Straßenrand gestellt. Alles ordentlich. Ordentlich und jämmerlich. In einer Ecke meiner Kammer die Plastiktüten mit Din-A-4-Papier aus dem Laden meines Vaters. Schmierpapier für meine Skizzen. Dann meine ersten Ölbilder. Viel zu groß für die Dachkammer. Aber der Versuch, zu einer radikalen Innenperspektive zu gelangen. Die ratlosen Blicke meiner Eltern, als ich sie ihnen präsentierte. Ich konnte mir nie vorstellen, dass sie sich einmal innig geliebt hatten. Der Tod meines Vaters. Die Blicke der anderen, als sie mich nach diesem Tod geholt hatten. Diese Wortlosigkeit, in die ich dann selbst zerfiel.
All das raste durch meinen heilen Kopf. Blitzschnell. Es war genau der Teil einer Sekunde, den die Zeit sich nahm, um in einem neuen Takt Fahrt aufzunehmen. Ich wehrte mich nicht dagegen. Ich hätte auch nicht gewusst, wie.
Hepe erhob sich langsam, während er mich unentwegt anblickte. In mir begannen sich Muskeln zu spannen. Wie sah er nur aus. War etwas dicker geworden. Kam auf mich zu. Sehr kurze Haare. Dünne Haare. Kaum noch Haare. Auch er in einem dunklen Anzug. Doch nicht die Kellneruniform der Profis. Der Anzug saß. Er war für diesen Körper erschaffen. Der Kragen des weißen Hemdes offen. Ein Geschäftsmann oder Anwalt, der am Abend in seiner Berufskleidung leger wirken wollte.
Er quetschte sich um die Stühle der Zuschauer herum. Einer der Profis nahm seinen Blick auf, kreuzte den Strahl, bis er mich erblickte. Auch er presste sich zu mir durch. Krystle Warren wurde mit Beifall begrüßt und nahm nun selbst eine Gitarre in die Hand. Hepe lächelte ein wenig. Ich nicht.
Dann stand er vor mir, der Profi hinter ihm. Ein Schatten im Dunklen. Wir sahen uns in die Augen, und Hepe rechnete vielleicht kurz: Dreißig Jahre. So lange.
Wie lange, fragte ich mich. Lange!
In diesem Augenblick wollte ich den Grund für die vielen Jahre nicht wissen. Es gab ja einen Grund. Hepe hob die Hand und tätschelte meine Wangen. „Was hast du nur für’n Zottelbart, Mattis? Wie siehst du nur aus?“ Auch ich begann nun zu lächeln, hob unentschieden die Schultern, als könnte ich die Frage nicht beantworten. Womit auch? Und damit war das alte Verhältnis zwischen Hepe und Mattis wieder in Stand gesetzt. Über all die Jahre hinweg. Kuriert, als wäre es nie anders gewesen.
Er hatte das Hepe-Lächeln in den Augen. Es war mir sofort vertraut. Er konnte immer noch charmant sein, wusste nach wie vor, wie er sich gewinnbringend einsetzen konnte. Er wich meinem Blick nicht aus, nahm mir mein warmes Weinglas aus der Hand, stellte es dorthin, wo er den Tresen vermutete, umfasste meine Schulter und forderte mich so auf, mit ihm zu seinem Platz zurückzukehren. Fast willenlos folgte ich ihm. Sofort schob irgendjemand einen Stuhl an den Tisch. Gleich danach stand dort auch ein neues Rotweinglas, nur viel größer als meines und ein Drittel gefüllt. Eine Frau saß an dem Tisch. Sah mich etwas erstaunt an. Lächelte. Sagte etwas zu mir. Doch Krystle Warren war lauter. Wir nahmen die Gläser, prosteten uns zu.
„Ich wusste gar nicht, dass es hier solch einen Wein gibt“, rief ich Hepe ins Ohr.
„Gibt‘s auch nicht“, antwortete er mir schmunzelnd, doch ich verstand es nicht. Er sprach mit der Frau, erklärte ihr wahrscheinlich, wer ich war, denn sie blickte dabei zu mir herüber. Immer noch hielt sie das Weinglas in der Hand, hob es dann leicht an, fing meinen Blick auf und prostete mir noch einmal zu.
„Dr. Morgan“, rief Hepe in mein Ohr. „Sie arbeitet für mich.“ Die Frau war in unserem Alter, trug ein buntes, eng anliegendes Kleid und goldene Ohrringe, die aus ihrem dunklen Haar heraus glitzerten. Irgendwie passte sie zu Hepe. Fast das gleiche Alter. Sie kleideten sich anders als die anderen Zuschauer. Festlicher. Teurer. Eine andere Klasse. Primeclass.
Während des Konzerts sprachen wir nicht mehr miteinander, denn es schien bei der Musik zu anstrengend zu sein. Hepe und die Frau konzentrierten sich auf Krystle Warren. Als ich meinen Wein geleert hatte, stand sofort ein neues Glas vor mir, und ich merkte, dass dieser Wein sehr schwer war. Nach zwei Zugaben war das Konzert beendet.
„Hat es Ihnen gefallen?“, fragte Frau Morgan mit einem englischen Akzent. Ich nickte.
„Ich bin ein Fan von ihr“, sagte sie dann. „Ich bin so dankbar, dass Herr Pinske mich dazu eingeladen hat.“ Dabei blickte sie Hepe fast schon zärtlich an, und ich fragte mich sofort, ob die beiden vielleicht ein Paar waren.
„Wo musst du hin?“, fragte Hepe. „Ich könnte dich ein Stück mitnehmen. Wir haben ja noch gar nicht miteinander reden können.“ Wir erhoben uns. Sofort wurde Hepe und der Frau in die Mäntel geholfen.
„Das würde auf jeden Fall ein großer Umweg für dich sein, Hepe. Ich wohne nämlich im Hafen.“
„Das kriegen wir schon hin“, antwortete er, während wir uns dem Ausgang näherten.
„Nein, lass mal, Hepe. Man muss weit fahren, um zu mir in den Hafen zu kommen. Da bist du fast ne Stunde unterwegs.“
„Macht mir nichts aus, Mattis. Erst setzen wir Dr. Morgan ab. Und dann fahren wir in den Hafen. Wie auch immer.“
Erst. Dann.
Sein Wagen stand direkt vor dem Eingang, dort, wo streng genommen gar keine Autos parken durften. Doch dann bemerkte ich, dass ein Fahrer am Steuer saß, einer der Profis. Wir setzten uns nach hinten, nahmen die Frau in die Mitte. Es gab genug Platz. Ich hatte mich nie für Autos interessiert. Dieses war groß, neu, roch nach Leder und Zedernholz. Eine Luxuslimousine. Ein Bentley, wie ich später erfuhr.
„René, das ist mein Freund Mattis“, wandte sich Hepe an den Fahrer. „Wir bringen erst Frau Morgan nachhause, dann ihn.“
„Wo wohnst du genau, Mattis?“
„Am Namibiahafen“, sprach ich mehr zum Fahrer hin. „Windhuk-Stieg. Ich zeige es Ihnen dann genau.“ René nickte nur und fuhr los. Ich hörte kein Fahrgeräusch. Früher hörte man doch immer den Motor.
„Sie haben sich wohl lange nicht gesehen?“, begann Frau Morgan wieder das Gespräch.
„Viele Jahre“, antwortete Hepe freundlich.
Ja, viele Jahre, dachte ich. Aber seit wann denke ich Jahre.
Das Gespräch verebbte. Wir fuhren nach Norden.
„Sie kennen sich aus der Schulzeit“, fragte die Frau, „oder aus dem Studium?“
„Seitdem wir Kinder waren.“, antwortete Hepe. Ich nickte freundlich.
„Wir sind in der gleichen Siedlung aufgewachsen.“, fügte er hinzu.
„Siedlung?“, wiederholte die Frau erstaunt. „Ist es das, was wir in den Staatensettlementnennen? Housing complex? Viele kleine, neue Häuser, alle ähnlich? So etwa?“
„Na, ja, fast so.“, antwortete Hepe mit einem liebenswürdigen Lächeln. „Mehr so … Reihenhäuser.“
„Oh, wie in England“, rief sie. „Ein kleiner Garten vorn und hinten. Das kann wirklich sehr charmant sein.“
Beide verstummten, bis wir vor einem mondänen Mietshaus aus der Gründerzeit hielten.
„Bis morgen, dann“, verabschiedete sich die Frau von Hepe. „Er war wunderschön. Herzlichen Dank, Herr Pinske.“ Dann reichte sie mir die Hand. „Wie schön, dass wir uns kennenlernen konnten, Mattis. Vielleicht sehen wir uns ja bald einmal wieder.“
„Vielleicht“, stammelte ich. Mir waren diese Formalitäten schon immer sehr unangenehm gewesen. Und Hepe wusste das vielleicht noch. Geräuschlos fuhren wir weiter.
„Ist ne tolle Frau, oder?“, fragte Hepe nach einer kleinen Weile. Ich nickte. „Hat in Harvard studiert. Verhaltenspsychologie. Sie ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Hat mit Nobelpreisträgern zusammengearbeitet. Und jede Menge Veröffentlichungen. Spricht fünf Sprachen. Hast ja gehört. Merkt man kaum den Unterschied zu einer Muttersprachlerin. Kam hier so an. War noch nie vorher in Deutschland gewesen. Spricht aber richtig gut Deutsch. Wie findest du das?“
„Ja, toll.“, antwortete ich kurz. Eine kleine Pause entstand.
„Du bist Maler geblieben, stimmt’s?“, fragte er mit einem Blick auf meine Hose. Er hatte die Farbflecke gesehen. Ich nickte.
„Und, kannst du davon leben?“
René fuhr die sechsspurige Straße nach Süden schnell und irgendwie auch rücksichtlos. Aber er kam zügiger voran, als ich angenommen hatte.
„Geht grad so.“
„Geht grad so? Du hast doch mal gut verdient.“
„Das weißt du?“
„‘türlich. Du warst mal der Shooting Star der Kunstszene. Das hat man doch mitbekommen. Hast doch Ausstellungen gehabt. Und ‛ne Galerie. Hängst du nicht sogar im Museum? Klar, da gibt es noch so einige Bilder aus deiner Zeit. Reliquien sozusagen.“
„Das ist lange her, Hepe. War während und direkt nach dem Studium. Da hatte ich eine Galeristin und bekam pro Bild … ich weiß nicht …“
Ich dachte zurück. Ich dachte tatsächlich schon wieder zurück.
„Dreitausend“, fuhr Hepe fort. „Ich weiß das. Ich hab damals zwei Bilder von dir gekauft.“
„Wirklich? Welche denn?“
„Weiß nicht mehr so genau. Eines war so in grün. Hochformat. Vielleicht achtzigmal eins zwanzig. Du hattest den Rahmen übermalt. Fanden damals alle schick. Warst einer der Wilden damals.“
„Ich glaube, du meinst12 Punkt 9. War eines der letzten, die damals verkauft wurden.“
„Und warum?“
„12 Punkt 9,8 Punkt 17und so weiter. Nummernbilder. Auftragskunst. Ich hab’s irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und dann noch all die Gespräche mit Galeristen, Kuratoren, Presseleuten. Ich malte schon lange nicht mehr, was ich wollte ...“
Ich unterbrach mich. Das war mir zu viel Erklärung, zu viel Ferne. Zu ungewohnt. Doch ich führte ein Gespräch. Ich sollte etwas von mir erklären …
„Hatte mich verbogen, verstehst du? Bis zur Unkenntlichkeit. … Dekorationskunst … ohne Inhalt. Hatte meine Bilder totgemalt. … Die ich damals noch besaß, hab ich dann übermalt.“
Aber warum sprach ich gleich so viel? Und so viel von früher?
„Ich hab deine Bilder noch.“
„Und wo hängen sie?“
„Weiß ich jetzt grad nicht. Aber sie hängen irgendwo. Ganz bestimmt.“
„Siehst du. Das meine ich.“
Wir hatten den Hafen schon erreicht. René hatte das GPS eingeschaltet.
„Windhuk-Stieg Nummer?“, fragte er. Hepe blickte angestrengt durch die Scheiben, um zu erkennen, wo man hier wohnen könnte.
„Gibt keine Hausnummer“, antwortete ich. „Hinter den vielen Containern ist ne Brücke zum Namibiahafen. Ein weißes Lagerhaus rechts mit einem blauen Eisentor davor. Ist offen. … Ganz durch bis zur Kaimauer am Namibiahafen.“
Ohne Kommentar folgte René meinen Anweisungen.
„Der Typ da heute in der Pause“, wandte ich mich wieder an Hepe, „den deine Leute da rausgezogen haben, wollte der was von dir?“
„Ach, der, ja, ja, “ antwortete Hepe, während er wie abwesend in den Hafen sah. „Der wollte nur Lärm machen.“
„Und warum?“
Jetzt blickte er mir direkt in die Augen. So dicht waren unsere Gesichter zuvor nur während des Konzerts gewesen. Diese wasserblauen Augen, die immer charmant blieben aber tatsächlich nie etwas verrieten außer Kalkül. Viele Jahre lang hatte ich mich auf Hepe und seine Augen verlassen. Doch einmal hatte er sich verrechnet, in mir verrechnet.
„Geschäfte, Mattis“, sagte er zerfahren. „Nicht jeder kann immer gewinnen. Und … mancher kann auf keinen Fall verlieren. Das war so einer. Ich kannte seine Eigenheiten und dachte mir schon, dass es einmal so kommen würde.“
Der Wagen bremste direkt vor der Kaimauer neben einem Haufen zusammengepresster Fahrzeuge. René drehte sich zu uns um.
„Ja, wir sind da, “ sagte ich. „Um diese Uhrzeit ist es immer etwas schwierig nachhause zu kommen.“
Hepe schaute durch alle Fenster nach draußen. Auch René blickte sich um. Sie suchten mein Haus. Ich zeigte nach rechts die Kaimauer entlang zu einem grünen, arbeitslosen Kran, auf dessen Schienen wir parkten. „Da hinten ist ein Drahtgitterzaun. Dann ein Kran, dann ein paar alte, verrostete Container. Dahinter wohne ich.“
„Ich könnte noch mitkommen…“, hörte ich Hepe.
„Es ist kein Palast“, antwortete ich.
„Egal, wir begleiten dich.“
Hepe und René knöpften ihre dunklen Mäntel zu und streiften sich Handschuhe über. Ich schob den rostigen Draht zur Seite, damit sie durch den Zaun treten konnten, ohne sich schmutzig zu machen. Sie ließen mich vorgehen und folgten im kurzen Abstand dem Weg zwischen Kaimauer und Lagerhaus. Auf meiner Seite des Namibiahafens wurde meist nicht gearbeitet. Dennoch lagen heute auf dem glänzenden Asphalt einige zertrümmerte Europaletten, über die wir hinwegstiegen. Der Scheinwerfer am Kran betastete den Weg in einem freundlichen orange-gelben Natriumdampf.
Nicht weit entfernt fuhren LKWs über die Brücke aus dem Namibiahafen. Beladen mit vollen Containern, die von einer langen Seereise kamen. Fast rhythmisch hörte man das Klackern, wenn sie über die Eisenplatte fuhren, die die Brücke mit dem Damm verband. Zweimal Klack für die Zugmaschine. Dann KlackKlackKlack für die drei Achsen des Auflegers. Über all dem lag das immerwährende Brummen des Hafens, sein Grundton, das Geräusch der Maschinen von LKWs, Kränen, fahrbaren Brücken und der Schiffe.
Das Hafenwasser glitzerte von vielen hundert Lampen und Scheinwerfern der gegenüberliegenden Seite. Zwei Frachter hatten dort festgemacht, seitdem ich am Morgen den Ort verlassen hatte. Ich kannte sie beide. Der eine kam aus China und hatte Container geladen. Der andere lud Schwergut, Übermaßladung, die nicht in Container passte und in großen Holzkisten verpackt am Kai lag. Das Schiff war in Panama registriert. Leise surrten die Elektromotoren der Kräne und Brücken. Die hohen Töne ihrer Warnsignale bei der Fahrt klangen herüber und vermischten sich mit dem Gebrumm des Hafens.
„Was entladen die da wohl?“, fragte Hepe hinter mir. „Hast du ne Ahnung?“
Ich drehte mich leicht nach hinten, um zu antworten: „Nee, aber was kann es schon sein? Der Containerfrachter vielleicht Zigtausende Wegwerffeuerzeuge oder Shorts, Plastikbecher, LED-Lampen, Filzschreiber … Irgendwas in der Art. Aber wenn du‘s genau wissen willst, ich kenn da jemanden, der’s weiß.“ Hepe antwortete nicht. Wir erreichten meinen alten Steinschuppen dicht vor einer hoch liegenden, viel befahrenen Brücke. Die Eingangstür klemmte seit der letzten Sturmflut. Ich warf mich dagegen, und sie sprang auf.
„Schließt du auf diese Weise ab?“, fragte Hepe im ironischen Ton und klopfte mir auf die Schulter. Als ich die alten Schildkrötenleuchten angeschaltet hatte, wartete er, bis René eingetreten war und sofort begann sich umzusehen. Die beiden Räume im Parterre waren fast leer. Nur ein Eisenbett mit einer durchgelegenen Matratze, einige rostige Regale und kaputte Fahrräder standen dort noch. Hier schlief Volo manchmal. Eine steile Holztreppe führte nach oben. Ich ging vor, um auch hier das Licht anzuschalten. Der erste Raum diente mir als Atelier, Küche, Badezimmer, Lager … Mein Schlafraum war durch einen dünnen Vorhang abgetrennt, weil die Tür fehlte. Meine Matratze lag auf Europaletten.
Als wäre es selbstverständlich schob René den Vorhang zur Seite und inspizierte alles. Dann verließ er uns über die Treppe nach unten. Hepe trat an eines der großen, alten, dünnen Fabrikfenster heran und blickte nach draußen.
„Alles sehr einfach hier“, sprach er dann vor sich hin.
„Du kannst von hier aus rübersehen. Die ganze Stadt liegt da vor dir. Ist nachts nur ein bisschen schwierig, weil der Hafen so hell ist.“
„Hier ist es nie dunkel oder?“
„Nee. Hier ist es immer hell. Tag und Nacht gibt‘s jedenfalls nicht. Es gibt nur die Hafenzeit. Die ist immer. Der Hafen schläft nur an fünf Tagen im Jahr.“ Er sah mich fragend an.
„Erster Mai, Ostern, Weihnachten und so weiter …“
Hepe begann, meine Bilder, die um uns herum an den Wänden lehnten, abzuklappen und sich einige genauer anzusehen. Die Stadtbilder. Dann ging er zu einem großen Bild hinüber, das mitten im Raum auf meiner selbst gebauten Staffelei stand. Eines meiner Penta-Bilder, die ich seit langer Zeit immer wieder malte.
„Möchtest du noch ‘n Wein?“, fragte ich und suchte auf dem Boden hinter Farbeimern eine Flasche, die ich vor langem geschenkt bekommen hatte. „Der kommt von der Krim.“
„Nee, lass‘ mal“, antwortete er und rief dann nach unten: „Hol uns mal ne Flasche Roten, René.“
Wir hörten, wie er die Tür aufriss.
„Hab immer was bei mir“, sagte Hepe mit einem gut gelaunten, frechen Gesichtsausdruck und stand schon wieder vor meinem Bild. Ich fand zwei Gläser, die fast sauber aussahen, wusch sie am alten Spülstein nochmals ab, wischte sie unter fließendem Wasser mit der Hand aus und schwang sie dann schnell auf und ab, damit das Wasser abspritzte Ich besaß kein Geschirrhandtuch. Hepe betrachtete immer noch das Penta-Bild und trat etwas zurück.
„Wohnst du hier ganz offiziell?“ fragte er dann.
„Ich glaub, dass man hier offiziell gar nicht wohnen darf“, antwortete ich und suchte einen Platz, um die Gläser abzustellen. „Ich kenn hier jemanden, der sozusagen jeden kennt. Und der lässt mich hier wohnen. Ein Ukrainer.“
„Russenmafia?“
„Weder Russe noch Mafia. Er bewacht dieses Gelände und lässt mich hier wohnen. Das läuft so ein wenig über Gefälligkeiten oder so.“
René stieß die Tür auf, kam die Treppe herauf und reichte Hepe eine Weinflasche, die er mir zusteckte, um sie zu öffnen. Ich suchte eine möglichst große Schraube und begann sie in den Korken zu bohren.
„René, Korkenzieher!“ brüllte Hepe die Treppe hinunter. Sofort erschien René, nahm die Flasche wieder entgegen, öffnete sie und reichte sie mir zurück. Ich schenkte ein. Hepe streifte sich die Handschuhe ab, öffnete seinen Mantel, zog sich meinen roten, abgeschabten Klappstuhl vor die Staffelei und setzte sich mit seinem Glas davor. Ich blieb stehen, denn einen weiteren Stuhl besaß ich nicht. Wir nippten am Wein. Der gleiche wie beim Konzert.
„Sag mal, dieses Bildmotiv hast du doch schon vor dreißig Jahren gemalt.“
„Dreißig Jahre?“
„Ja, dreißig. Mindestens. Dies Bild hier mit den fünf Schalen, die du mal so, mal so in verschiedenen Farben anordnest. Wie nennst du diese Bilder noch?“
„Ja, mal ich immer wieder. Meine Penta-Bilder. Aber ich mal vor allem viele andere Motive. Meist aus der Stadt.“
„Aber warum nur, wenn du nichts davon verkaufst. In ein paar Jahren wirst du hier alles zugestellt haben. Das versteh ich nicht. Suchst du immer noch nach dem absoluten Bild. So wie damals?“
Das wusste er noch? Ich lehnte mich mit meinem Glas neben ihn an die Wand und betrachtete mein Bild. Das absolute Bild. Ich hatte vergessen, dass ich es früher schon so genannt hatte.
Ich war immer schon besessen von der Idee des absoluten Bildes und hatte Hepe damals lange Vorträge darüber gehalten. So wie er sich breit ausließ über Wetten, Risiken und die Nash-Theorie. Dennoch, ich hatte eigentlich nie so richtig gewusst, was das sein sollte, das absolute Bild. Ich hatte nur geahnt, dass es eines Tages mein letztes Bild sein würde. Ein Bild, das ich nicht mehr übertreffen könnte. Mein Sehnsuchtsbild.
Hepe verführte mich in die Vergangenheit. Ich konnte mich nicht dagegen wehren.
„Du malst hier ständig neue Bilder, die du nicht verkaufst, Mattis“, begann Hepe wieder. „Was soll das? Was sind das zum Beispiel für Stadtbilder. Davon hast du ja auch eine Unmenge.“
„Ich glaube, dass wir in einer besonderen Zeit leben“, sagte ich etwas zögernd. „In einer kompletten Neuorientierung. Hervorgerufen durch den Einfluss der digitalen Technik. Alles verändert sich dadurch. Das Leben … und die Sicht auf das Leben. Es ist aber nicht nur ein Wandel oder eine Veränderung. Es ist ein … Umbruch…“ Ich zögerte nochmals. „… eine Neuordnung unseres Denkens.“
Hepe sah mich aufmerksam und interessiert an.
„Und genau das möchte ich in meinen Bildern festhalten können.“
Er ließ seinen Blick nicht von mir weichen.
„Aber man muss sich herantasten. Verstehst du? Man muss vieles ausprobieren. … Meine Penta-Bilder haben aber damit nichts zu tun.“
Hepe dachte weiter über meine Sätze nach, er reagierte nicht sofort.
„Nur deine Stadtbilder haben etwas damit zu tun?“
Ich nickte ihm zu.
„Ich glaube, ich verstehe ziemlich gut, was du meinst“, sagte er dann. „Aber wie kommst du drauf? Du hast bestimmt nicht mal einen Internetanschluss, um einen solchen grundsätzlichen Wandel in der Gesellschaft beobachten zu können. Und nen Computer? … Auch nicht. Der Umgang mit Computern gilt heute als vierte Kulturtechnik, neben Schreiben, Lesen, Rechnen.“
„Hatte aber mal einen.“
„Irgendwann mal, ja. Und du benutzt bestimmt auch kein Handy oder ne Digitalkamera.“
„Hatte ich auch mal.“
„Das ist alles lange her, Mattis. Die Entwicklung ist in den letzten Jahren rasant verlaufen. Was weißt du da noch vom digitalen Zeitalter?“
„Man kann eine solche Entwicklung auch erspüren.“
Hepe lachte kurz auf. „Ach, Mattis, unser altes Ding. Man kann etwas errechnen und abschätzen, wenn man über die richtigen Informationen verfügt. Manchmal kann man auch ein wenig erspüren. Aber nur erspüren, dass so eine massive Veränderung vor uns liegt. Also nee. Allein mit dem Gespür. Das geht nun wirklich nicht.“
Wir schwiegen.
„Erinnerst du dich an das Panikhaus.“
Langsam hob sich sein Blick von meinem Penta-Bild. Er sah zu mir hoch. Schaute mich überrascht mit wachen Augen an. Jetzt hatte ich die Grenze überschritten. Jetzt waren wir wieder dort angekommen, wo wir uns damals getrennt hatten. Jetzt hatte ich die Tür zu unserer gemeinsamen Vergangenheit wieder weit aufgestoßen. Ich hatte sie aufgestoßen.
„Ach ja, das Panikhaus“, hörte ich ihn leise sagen. „Ist schon ‘ne Ewigkeit her.“
Wieder schwiegen wir.
„Ich hatte etwas erspürt“, sagte ich dann. „Und du hattest etwas errechnet. Aber du hattest dich verrechnet.“
„Ich hatte etwas anderes erwartet, Mattis. Ich hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass die Sache so ein Ende finden würde.“
„Du hattest dich verkalkuliert, Hepe? Wieso hast du dich so irren können?“
„Was soll das heute noch, Mattis. Es ist mehr als dreißig Jahre her.“
Er starrte wieder auf das Penta-Bild, schien sich nicht davon lösen zu können. Ich schenkte noch einmal nach, stellte mich mit meinem Glas ans Fenster und betrachtete die Bewegung der Kräne, die gerade den Chinesen löschten. Ein Druck, fast schon einen Schmerz machte sich in meinem Bauch breit.
Signale meines Körpers. Meist ignoriere ich sie. Doch jetzt meldet sich etwas Stärkeres. Zu viel Wein wahrscheinlich.
Ich hörte, wie Hepe sich erhob und sich mir von hinten näherte. Dann spürte ich, wie er eine Hand auf meine rechte Schulter legte.
„Hör mal, Mattis. Ich hab da ne Idee. Ich kann dir helfen, hier rauszukommen.“
Auf dem Panamafrachter wurde das Ablegemanöver vorbereitet. Ein Schlepper war in den Namibiahafen hineingefahren und ging längsseits. Am Kai standen die Festmacher und warteten rauchend auf ihren Einsatz.
„Will ich hier rauskommen, Hepe?“
„Brauchst du nicht ein wenig Geld, Mattis? Du könntest sicher etwas mehr Geld brauchen.“
Er hatte Recht. Natürlich hatte er Recht. Mit vierhundert Euro oder weniger im Monat konnte ich mir kaum noch Farben und Malwerkzeug kaufen. Neue Rahmen waren für mich unerschwinglich geworden. Ich kaufte ausschließlich in Billigmärkten ein. Für die öffentlichen Verkehrsmittel zahlte ich nicht. Ich ging zu keinem Arzt. Und auch Volo musste ich mal etwas dafür geben, dass er mir ständig etwas mitbrachte, dass ich hier wohnen, Strom und Wasser nutzen konnte.“
„Ich weiß nicht, Hepe.“
Er schob mir von hinten eine Visitenkarte in die Hand.
„Das ist in der Innenstadt. Da kannst du vorbeikommen. Sagen wir mal, morgen, also, ich meine heute so um drei Uhr. Ich kann dir, glaube ich, ein sehr gutes Geschäft anbieten. Brauchst nichts zu befürchten. Wenig Arbeit und ein wenig Geld.“ Er knetete meine rechte Schulter, gab mir dann einen liebevollen Klaps auf den Hinterkopf.
Ich sagte nichts und blieb am Fenster stehen, bis ich die beiden Besucher den Kai entlanggehen sah. Die Schöße ihrer Mäntel flogen auf und ab. Ein Sturm war aufgezogen. Auf dem grünen Kran an meiner Seite hatten sich die fünf Möwen niedergelassen, die ich hier oft sah. René ging immer ein paar Schritte hinter Hepe. Dann beschleunigte er, zog den Maschendraht zur Seite und ließ Hepe durchschlüpfen. Der Panamafrachter wurde gerade aus dem Hafenbecken in den Sturm geschleppt.
Ich wusste nicht, ob ich ihn wiedersehen würde.
eine Welt nur dem Schein nach
Ich spielte das Schlagzeug für Krystle Warren. Doch ich blieb nicht im Takt. Vom Mikro drehte sie sich fragend zu mir. Aber meine Hände schlugen nicht so zu, wie es der Musik entsprach. Krystle brach ab. Alle sahen zu mir. Das Publikum blieb stumm. Und ich schlug weiter zu. Immer weiter, aber auch langsamer. Ich konnte es nicht steuern. Wie eine Äffchenspieluhr für Kinder, die auslief.
Viele Leercontainer. Ich wurde von den LKWs wach, die mit Containern über die Brücke hinter meinem Schuppen fuhren. Manche hatten leere andere volle Container geladen. Bei Fahrten mit leeren Containern hörte sich das KlackKlackKlack an der Schwelle zu Brücke lauter und heller an als mit vollen. Außerdem rasselte dann immer etwas. Zwischendurch KlackKlack und dann nichts mehr. Nur zwei Achsen. Privatwagen. Menschen, die im Hafen arbeiteten.
Noch ein Geräusch - aus dem Parterre meines Schuppens.
Wie spät war es wohl? Bestimmt später als ich dachte. Warum war das plötzlich wichtig? Nie fragte ich mich nach der Uhrzeit. Hier galt die Hafenzeit, die gar keine war, weil Zeit darin keine Bedeutung hatte. Schlagartig fiel mir Hepe wieder ein.
Er war hier gewesen. In der Nacht.
Hatte ich das auch geträumt? Hier bei mir? Wir hatten uns wiedergetroffen.
Nach allem. Nein, ich sollte denken, wie es wirklich war: Nach mehr als dreißig Jahren. In der letzten Nacht. Vor wenigen Stunden.
Mir war schlecht. Vielleicht vom Rotwein. Immer häufiger vertrug ich Rotwein nicht mehr so gut.
Der Aldi-Parkplatz. Sonntags am Nachmittag. Nach dem Mittagessen.
Wie kam ich jetzt darauf?
Unsere Sonntage waren immer gleich getaktet. Acht Uhr Frühstück, zwölf Uhr Mittag, sechzehn Uhr Kuchen, neunzehn Uhr Abendbrot. Der Rhythmus der Familie. Er gab das Leben, den Verlauf des Lebens vor wie die Nacht und wie der Tag. Etwas Verlässliches. So verlässlich und so geordnet, dass er nichts anderes zuließ. So wurde ich erwachsen, so sollte ich leben. Der Fernseher lief schon beim Frühstück. Wir sprachen ohnehin kaum miteinander. Als gäbe es nichts mehr zu sagen. Eine programmierte Familie. Man gabFamilieein und erhieltFrühstück, Mittag, Kuchen, Abendbrot, Fernsehen. Neues war nicht vorgesehen für die verbleibende Lebensspanne. Unser Laufwerk ließ sich nicht erneuern.
Wie hatte ich dort nur beginnen können zu malen? Es hatte mich sehr viel Kraft gekostet.
Am Sonntagnachmittag trafen sich alle auf dem leeren Aldi-Parkplatz zum Chickenspiel. So nannten wir es. So hatte Hepe es genannt. Er organisiert alles, den Zeitpunkt, den Ablauf, die Zuschauer, natürlich die Wette und die Gegner. Oft war ich einer der Gegner. Unsere Ausgangspositionen hatte Hepe mit Kreide auf dem Asphalt markiert. Wir hielten einen Abstand von vielleicht fünfzig Metern. Rechts und links unserer Strecke hatten sich Jugendliche aus unserem Viertel aufgestellt. Auch aus anderen Stadtteilen kamen viele, um durch die Wette ein wenig Geld zu verdienen. Hepe zögerte den Beginn immer gern hinaus, weil er hoffte, noch weitere Wetten abschließen zu können. Er trug ständig ein kleines Heft bei sich, in das er alles eintrug. Jeden Einsatz. Jede Wette. Alle kleinen Geschäfte. Die Geldscheine stopfte er in die eine Tasche seiner Hose, das Hartgeld in die andere. An solch einem Sonntag konnte ich mehr als zwanzig Mark verdienen, meine Provision, wie Hepe immer sagte. Das Geld brauchte ich für Farben und Leinwände.
Denn manchmal überkam mich eine Idee ein besonderes Bild zu malen. Sie verfolgte mich. Ich wurde damit wach, dachte während des Unterrichts tagelang an nichts anderes, skizzierte die Idee immer wieder auf irgendwelche Blätter. Ich grübelte über Motive, das Licht, Farben, die Perspektiven und natürlich den Stil. Niemand wusste von meiner Manie. Doch, Hepe bemerkte es. Er kannte mich gut. Manchmal war ich wie besessen und konnte gar nicht erwarten, endlich am Sonntag für ihn zu starten.
Allein und geduldig stand ich dann mit meinem Pegasus-Mountainbike an der Ausgangsposition, der Pole-Position mit der Sonne im Rücken. Mein Gegner auf der anderen Seite blinzelte immer wieder zu mir herüber. Er war noch umringt von Freunden, die ihm Mut zusprachen. Hepe hatte vorher mit mir gesprochen, wenngleich ich vieles nicht verstanden hatte.
„Ich schaff‘ uns die Minimalbedingungen, um den Gewinn zu sichern. Kannst dich drauf verlassen“, erklärte er mir ständig wieder. „Wir haben die besten Voraussetzungen für den Gewinn. Die Spielstruktur ist einfach. Du hast damit Erfahrung. Und die Anreize sind hoch genug. Es ist ein typisches Gleichgewicht bei entgegengesetzten Interessen. Aber wir gewinnen. Hundert Pro.“
Dann folgte das, was ich besser verstand: “Wir wissen zwar nicht ganz genau, wie sich der andere verhält. Aber wir wissen, wie du dich verhältst, Mattis. Du weichst nicht aus. Sonst ist das Geld weg. Der da hinten ist ein Schisser. Du kannst so gut wie sicher sein, dass er den Lenker rumreißt. Hundert Pro.“
Vor wenigen Minuten noch hatte er den anderen gegenüber behauptet, ich hätte heute keinen guten Tag, wollte es aber trotzdem versuchen. Das schwemmte noch ein wenig Geld in seine Taschen.
„Ruhe!“, brüllte er dann über den Parkplatz. Mehr als fünfzig Kinder und Jugendliche schwiegen.
„Los!“, hörten wir Hepe, und ich trat mit aller Kraft in die Pedale. Blitzschnell musste ich starten. Das entmutigte meinen Gegner. Und ich musste schnurstracks auf ihn zufahren. Keine Schlenker. Keine Schwächen zeigen. Den Blick richtete ich auf mein Vorderrad, nicht auf den Gegner, denn sonst hätte ich Angst bekommen. Und er würde vielleicht meine Angst sehen. Nur manchmal blickte ich kurz hoch, um sicher zu sein, dass ich die Richtung hielt.
Ausweichen oder nicht? Wer ausweicht, verliert. Die Regel war einfach. Wichen beide aus oder fuhren beide ineinander, dann erstattete Hepe das Geld zurück. Fast alles. Natürlich hofften unsere Zuschauer immer insgeheim, dass wir kollidieren würden, auch wenn sie dadurch kein Geld gewannen. Sie kamen vor allem, um einen Unfall, um Blut und uns vor Schmerz weinen zu sehen. Aber auch wegen des möglichen Gewinns. Mit beidem kalkulierte Hepe.
Wir trugen keine Fahrradhelme. Niemand trug sie. Ich fuhr in zwei Jahren sieben Mal und wich niemals aus. Als ich gerade sechzehn geworden war, raste ich in das andere Fahrrad hinein, brach mir das linke Schlüsselbein und einen rechten Mittelfußknochen.
Tiefe Angst beschlich mich vorher immer, Angst, die Hand oder den Arm zu brechen. Dann hätte ich nicht mehr zeichnen und malen können. Teile meines Rades waren kaputt. Mein Vater fuhr mich schweigend ins Krankenhaus und wieder zurück. Vor Schmerz liefen mir die Tränen herunter. Doch ich ließ meinen Vater keinen Laut hören. Er hätte sich genauso verhalten. Er verhielt sich genauso.
„Scheiße, wir haben so gut wie keinen Gewinn gemacht, Alter“, war die einzige Bemerkung von Hepe gewesen. Aber ich dachte mir: Ein Feigling ist genau genommen der Vernünftigere. Ich war ein unsinniges Wagnis eingegangen. Hepe aber nur ein Risiko. Ein geringes Risiko sogar. Für ihn war ohnehin genug Geld übriggeblieben. Nie schloss er Wetten ab, ohne sich seinen Anteil vorher zu errechnen und zu sichern.
Wochenlang konnte ich mich kaum ohne Schmerzen bewegen. Nur einmal, nach vielleicht einer Woche, fragte meine Mutter: „Tut’s noch weh, Mattis?“ Ja. Ich konnte mich nachts nicht einmal im Bett drehen. Jedes Aufstehen und Hinlegen schmerzte. Jedes Husten oder gar Niesen.
„Geht schon“, antwortete ich nur. Sie fragte nie wieder.
Ich schlüpfte in meine Jeans Dann wusch ich mich am Spülstein. Zwei Gläser und eine halbleere Flasche Rotwein standen dort. Er war also hier gewesen. Also doch. Mir war immer noch schlecht. Ich sah lange durch die etwas matten Scheiben hinaus in den Hafen, um meinen Magen zu beruhigen. Meist gelang es. Der Chinese hatte den Hafen verlassen. Alle ankommenden Container waren verräumt. Ein Carrier stellte neue Container bereit. Seine hohen Warntöne klangen sehr nah. Aus dem Parterre hörte ich wieder Geräusche.
„Bist du das, Volo?“
Er stieg die Treppe herauf und hielt eine Plastiktüte mit kyrillischer Aufschrift in der Hand. Eine blank abgewetzte, dunkle Anzughose, einen Pullunder über dem verknitterten, weißen Hemd. Wie immer. Und dazu der „Roma-Hut“, wie ich ihn nannte. Der Hut war schwarz und hatte eine kurze Krempe, die hinten hochgeschlagen war. Ein richtiger Spießerhut.
„Hab kaputte Europapalette ins Regal gelegt. Für Winter“, hörte ich seine tiefe Stimme.