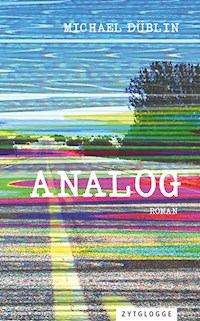
19,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bin ich, wenn ich denke? Ein allumfassendes Kommunikationsgerät beherrscht seine Nutzer bis in die kleinste Facette ihres Alltags hinein. Doch zu welchem Preis lassen wir unser Leben von Maschinen bestimmen? Bernd, Marketingverantwortlicher einer aufstrebenden Zürcher Softwarefirma, wird kurzfristig von seinem Chef auf eine transatlantische Geschäftsreise in die USA geschickt. Trotz des häufigen Unterwegsseins ist sein Leben eintönig – wäre da nicht Nelly, seine grosse Liebe. Er hat sie zwar im echten Leben noch nie gesehen, doch die Chats mit ihr geben ihm Halt und erwecken in ihm die Hoffnung auf eine glückliche gemeinsame Zukunft. Doch dann kommt auf seiner Reise alles anders als geplant, und sein Leben, sonst so geradlinig und unspektakulär, nimmt irgendwo zwischen Chicago und dem Mittleren Westen eine unerwartete Wendung. Konsequent denkt Michael Düblin unsere von Smartphones, Fitness-Trackern und lernfähigen Algorithmen geprägte Gegenwart nur ein kleines Stück weiter – und landet in der Dystopie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bernard, Marketingverantwortlicher einer Zürcher Softwarefirma, wird von seinem Chef auf eine Geschäftsreise in die USA geschickt. Trotz des häufigen Unterwegsseins ist sein Leben eintönig – wäre da nicht Nelly, seine grosse Liebe. Er hat sie zwar im echten Leben noch nie gesehen, doch die Chats mit ihr erwecken in ihm die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Doch dann kommt alles anders als geplant, und sein sonst so unspektakuläres Leben nimmt irgendwo zwischen Chicago und dem Mittleren Westen eine unerwartete Wendung.
Konsequent denkt Michael Düblin unsere von Smartphones, Fitness-Trackern und lern-fähigen Algorithmen geprägte Gegenwart nur ein kleines Stück weiter – und landet in der Dystopie.
MICHAEL DÜBLIN
ANALOG
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2019 Zytglogge Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Tamara Ulrich
Korrektorat: www.korrigieren.biz
Coverfoto: Michael Düblin
e-Book: mbassador GmbH, Basel
epub: 978-3-7296-2284-5
Mobi: 978-3-7296-2285-2
www.zytglogge.ch
Tag 1: Zürich
Draußen hat es zu schneien begonnen. Obwohl wir hinter dicken Glasscheiben sitzen, scheint der Schnee den Schall im Terminal 1 zu schlucken. Ich überlege, ob ich ein Glas Champagner trinken soll, um auf das neue Jahr anzustoßen, aber alleine macht das keinen Spaß.
Eigentlich wäre ich jetzt schon bald in San Francisco bei Sam, aber ich stecke noch in Zürich fest. Die Amerikaner haben kurzfristig die Einreisebestimmungen geändert, wahrscheinlich wegen der jüngsten Attentatsversuche in Houston. Trotzdem hoffe ich, dass sich heute noch was tut. Ich weiß nicht, ob ich schon in den Traummodus geswitcht bin. Dabei muss ich doch den Monitor im Auge behalten. ‹Delayed›. Trotzdem starre ich wie ein Irrer darauf. Oder träume ich nur ein Standbild?
Ich hätte den Neujahrstag lieber mit Nelly verbracht. Trotzdem wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr voll Inspiration, Leichtigkeit und was sonst noch dazugehört. Macht einfach nie den Blödsinn und wartet am Neujahrstag auf einen Flug nach Übersee.
Ich habe das Elcomm schon wieder in der Hand, alle paar Minuten starre ich auf die Nachrichten, die über den Bildschirm rauschen. Vielleicht ist ja was von Nelly dabei. Warum höre ich heute nichts von ihr? Sie scheint eine ihrer schweigsamen Phasen zu haben. Ich spüre, wie meine Arme sich langsam senken, als ich die Meldung von Sam vor mir sehe:
«Plan geändert. Flieg umgehend nach Chicago! Die Japaner möchten uns wegen der Lizenzen treffen. Kann hier nicht weg, bin mit Ellen und den Kindern in Disneyland. Übernimm du das!»
Als wäre unser Treffen in San Francisco nicht mehr wichtig.
«Kein Problem», antworte ich.
Ich muss also meinen Flug umbuchen. Ein bisschen Zerstreuung tut mir gut.
Ich diktiere die Anweisungen dem Elbot, der meinen Flug storniert. Das wird teuer, aber egal, die Japaner sind wichtig, eine Gruppe von Investoren, die sich für das neue Elcomm-Programmpaket interessieren. Japan ist neben China, Deutschland und den USA unser wichtigster Absatzmarkt. Trotzdem, wenn es um Kunden aus dem Fernen Osten geht, delegiert das Sam gerne an mich. Er ist zu ungeduldig, mag keine Zeremonien und redet zu direkt.
Einen Flug ohne Zwischenstopp bekomme ich so kurzfristig nur von der Air Swiss, aber Hotels sind um diese Jahreszeit kein Problem. Wer reist schon freiwillig nach Chicago, wenn es dort bei minus vierzehn Grad wie verrückt schneit.
Sam. Seine Weisungen holen mich immer ein. Grundsätzlich ist er kein übler Kerl, liebt seine zwei Kinder, geht anständig mit seiner Frau und uns Angestellten um. Aber wehe, man widersetzt sich seinen Befehlen.
Ich kannte ihn schon seit der Grundschule und wir waren an derselben Uni, aber er war mir immer einen Tick voraus. Immer gescheiter, schneller, vollständiger. Er wusste schon damals, wo’s langgeht, wo die guten Partys stattfinden. Er war eigentlich dauernd am Feiern. Und ich mit ihm, musste es aber immer bereuen, weil ich mit dem Stoff nicht nachkam, während er die binären Formeln nur so aus dem Handgelenk schüttelte. Aber wenn es nur das gewesen wäre. Er konnte sich auf einer Party auch mal ans Klavier setzen und Bach-Sonaten spielen, dass uns allen die Tränen kamen. Er hatte uns immer in der Tasche. Und ich garantiere euch, wenn ihr ihn kennen würdet, würde es euch nicht anders ergehen.
Mein Vorsatz fürs neue Jahr: «Lass dich nicht mehr von Sam rumkommandieren!»
Der Elbot antwortet: «Dein Wunsch sei mir Befehl.»
Sam hat die Firma aus dem Nichts gestampft und dank seiner Genialität zum Florieren gebracht. Er ist das Gesicht von Elcomm Inc. Sam ist Elcomm. Und eine Nachricht von ihm lässt keinen Spielraum für Interpretationen.
Ich seufze hörbar, worauf mir die Frau, die mir gegenübersitzt, einen Blick zuwirft. Es fühlt sich an, als würde sie einen Gegenstand nach mir werfen. Die Augen sind schwer. Ich öffne und schließe sie im Sekundentakt, um nicht einzuschlafen. Die Frau gegenüber schaut jetzt irritiert, dabei gilt mein Blinzeln nicht ihr. Das Schneetreiben vor dem Terminalfenster wird immer dichter und hat die Welt schon fast verschluckt. Die Frau schaut immer noch. Dabei liegt sie ganz falsch, sie interessiert mich nicht, ich habe ja Nelly.
Nun funkelt es auf der Anzeigetafel, alle Flüge sind gecancelt. Wie hätte es auch anders sein können, wenn die Welt im Schnee versinkt. Die Frau seufzt nun auch, als sie ebenfalls zum Monitor hochblickt. Dann dreht sie sich von mir weg.
Ihr kennt das bestimmt, wenn man einen wichtigen Termin hat, dann bleibt die Tram mitten auf der Strecke stehen, der Bus hat einen Getriebeschaden, bei der S-Bahn schließt die Tür nicht mehr, das Auto röchelt nur und alle Mitfahrservices sind belegt. Und wenn die Pisten gesperrt sind, dann geht auf einem Flughafen gar nichts mehr.
Die Japaner müssen sich wohl per Video mit mir unterhalten. Weiß der Teufel, warum Sam will, dass ich die Gespräche vor Ort führe. Meistens reicht doch ein guter Stream. Einverstanden, mit den Japanern hat das Streamen so seine Tücken. Auch wenn heute die technischen Voraussetzungen für Onlinekonferenzen eigentlich fantastisch sind, ist es doch eine Herausforderung, wenn man auf dem Screen nur einen Besprechungstisch und ein paar Köpfe sieht. Oft weiß man nicht, wer gerade spricht, was die Sache nicht einfacher macht. Wenn man sich nicht sicher ist, ob sie alles verstanden haben, darf man nicht einfach nachfragen, denn das beleidigt sie. Und mit beleidigten Japanern macht man keine guten Deals. Und das anschließende Essen fehlt auch, was eigentlich nach wie vor zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluss dazugehört. Sagt Sam zumindest. Denn für mich spielt es keine Rolle, wo ich meine Sushis zu mir nehme, in einem Konferenzzimmer in Chicago, Tokio oder im Flughafenterminal in Zürich.
Sam schreibt: «Flughafen Chicago zugeschneit, Treffen + 1 Tag verschoben».
Sam und sein Telegrammstil.
Die Frau gegenüber ist aufgestanden. Ihr Mantel fällt wie eine Mönchskutte über ihre Schultern und verschwimmt mit ihrem Haar zu einer schwarzen Fläche.
Soll ich sie ansprechen? Naja, immerhin teilen wir vermutlich ein gemeinsames Schicksal, wir stecken mindestens eine Nacht in Zürich fest. Den letzten Zug habe ich verpasst, die Straßen sind zugeschneit und der Gedanke, im Büro zu übernachten, macht mich auch nicht glücklich. Also wird mich die Fluggesellschaft in ein Hotel stecken, in dessen Bar ich meinen Abend verbringen werde. Und ich könnte mich ein wenig mit der Unbekannten unterhalten. Nelly hätte bestimmt nichts dagegen. Warum meldet sie sich nicht?
Ihr wisst sicher, wie das ist, wenn man unterwegs vergeblich auf ein paar aufheiternde Worte wartet. Man denkt sich, was hat diese Person im Moment Besseres vor, als sich mit dir zu unterhalten?
Die Frau im schwarzen Mantel macht sich zum Aufbruch bereit, aber dann zögert sie. Sie hat den Schal vergessen, der neben ihr über der Lehne hängt. Ein rotes Tuch, jetzt verstehe ich die Kombination: Schwarzer Mantel, roter Schal, schwarzes Haar, weiße Haut, die Lippen rot nachgezogen. Das ist das vollständige Bild. Ich muss nicht erst ihre Stiefel sehen, um zu wissen, dass auch die rot sind.
Ich versuche, mir Nelly in Schwarzrot vorzustellen. Die Frau, die nicht Nelly ist, bleibt stehen. Ihr Trolley ist ebenfalls rot. Als ich mich erheben will, blinkt das Elcomm.
«Frohes neues Jahr», schreibt Nelly. Obwohl ich sofort antworte, kommt nichts zurück. Sie ist wohl sehr beschäftigt, vielleicht kocht sie ein Neujahrsgericht für ihre Familie, vielleicht hat sie ein Dutzend Kinder, einen attraktiven Mann, vielleicht zwei oder drei. Wer weiß, was sie so alles treibt, wenn wir nicht gerade kommunizieren.
Ich müsste euch nun unseren Beziehungsstatus erklären, sonst wundert ihr euch, warum ich nicht einmal weiß, ob Nelly verheiratet ist. Dabei erzählt sie mir Dinge, die sie sonst niemandem anvertraut. Sagt sie zumindest.
Aber schon wieder blinkt das Elcomm.
«20 Uhr, Marriott, North Michigan Avenue», schreibt Sam.
Ich hasse späte Meetings.
Sam behält die Fäden immer in der Hand, egal, ob er gerade mit seinen Kindern Achterbahn fährt oder auf einer Party Piano spielt. Es kommt einem vor, als wäre er überall gleichzeitig, und das macht ihn so unberechenbar. Nicht einmal seine von Zuckerwatte verklebten Finger halten ihn davon ab, mir neue Befehle zu geben.
Die Frau in Schwarzrot greift sich ihren Trolley und macht sich vom Acker. Noch bevor ich Sam antworten kann, sehe ich von ihr nur noch den Rücken.
Tag 2: Zürich, Check-in
Letzte Nacht träumte ich von Nelly. Wir waren in einer U-Bahn in Tokio, die Menschen wie Pressschinken, unsere Körper wurden aneinandergedrückt. Von ihr ging ein Vanilleduft aus, sehr leise und süß. Meine Nasenflügel weiteten sich, um alle Nuancen einzufangen. Es war nicht nur Vanille, sondern ein Parfüm, ein Anflug von Veilchen vielleicht? Als ob ich wüsste, wie Veilchen riechen. Aber im Traum kann man ja alles.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eines kann ich nicht: einen Moment festhalten, ein Gefühl, das man auf keinen Fall gehen lassen will. Denn genau dann flieht es aus dem Traum, als ob jemand hinter ihm her wäre.
Frühstück im Hotel. Ich stopfe mich mit Brötchen voll, als ob es meine letzten wären. Wenn ihr schon mal in den USA gewesen seid, muss ich euch das nicht erklären.
Die Frau in Schwarzrot, die heute ein weißes Kleid trägt, steht am Buffet und schenkt sich Kaffee ein. Ich lächle sie an, aber das kann sie nicht sehen, weil sie von mir abgewandt ist. Ihr schwarzes Haar fällt ihr über den Rücken.
Der Elbot säuselt: «Wie Kohlestaub, der sich im Schnee ausbreitet.»
Dann setzt sie sich an den Nebentisch, ohne mich zu beachten, und isst Toast.
Es wird Zeit, euch von gestern Abend zu erzählen. Ich saß an der Hotelbar und starrte auf die schimmernden Flaschen im Regal hinter dem Tresen, als mir die Barkeeperin ein neues Bier hinstellte.
«Verrückt, dieser Schnee, nicht?»
Ich nickte.
Ihr Freund arbeite beim Räumungsdienst der Stadt und müsse die ganze Nacht Straßen freischaufeln, fuhr sie fort.
Es war nicht viel los in der Bar, also hatte sie Zeit zum Plaudern. Ist es meist nicht umgekehrt, schütten die Gäste nicht den Barkeepern ihre Herzen aus, weil das einfacher ist, als mit ihren Partnern zu reden? Ich will damit nicht sagen, ich hätte nur geschwiegen, im Gegenteil, später am Abend habe ich sie zugetextet, das glaubt ihr nicht. Denn das Zutexten ist nicht so mein Ding. Außer, wenn es um Nelly geht. Und genau um sie ging es. Aber stopp, zuerst drehe ich eine Stunde zurück, alles schön der Reihe nach.
Ich war eben erst gekommen und hatte mir am Tresen gerade ein Bier bestellt, als die Frau in Schwarzrot die drei Stufen zur Hotelbar hinabstieg. Ich glaubte für einen Augenblick tatsächlich, sie würde schweben. Jetzt trug sie ein knielanges, rotes Chiffonkleid mit schwarzer Schleife. Sie setzte sich in einen der dunklen Kunstledersessel, der farblich auf sie abgestimmt zu sein schien. Ich wollte mich zu ihr setzen, Nelly hin oder her, aber ich fand keinen Mut.
Hättet ihr sie angesprochen? Wenn ja, dann freue ich mich für euch. Ich tat rein gar nichts, blieb auf meinen Barhocker sitzen, ein Bier vor mir, ein Goldsprint, und obwohl ich die Turbinenbräu-Getränke eigentlich mag, schmeckte es schal. Ich nippte geknickt an der Seifenlauge, als mir die Barkeeperin ein Glas Scotch hinstellte.
«Der Drink geht auf die Dame dort drüben. Du gefällst ihr wohl», sagte sie mit einem Augenzwinkern.
Natürlich verstand ich nichts, wie immer, das ist mein Problem, ich bin zu langsam. Immer verpasse ich diese Sekunde, in der das Schicksal besiegelt wird und Beziehungen entstehen. Denn als ich mich umdrehte, war die Frau in Schwarzrot verschwunden.
«Willst du ihr nicht folgen?», sagte die Barkeeperin, die sich später als Rose vorstellen sollte.
Ich folgte der Frau in Schwarzrot nicht. Ich bin nicht der, der Frauen verfolgt, nur weil sie ihm einen Drink spendieren. Was ihr vielleicht nicht ganz verstehen könnt, die Männer unter euch raufen sich jetzt die Haare, verpasste Gelegenheit, die Frauen seufzen, was für ein Weichei. Sogar die Barkeeperin zuckte nur mit den Schultern. Ich fühlte mich nicht gerade wie Prinz Eisenherz. Ich fragte mich, warum ich all diese Comics gelesen hatte, wenn doch nichts auf mich abfärbte.
Also nahm ich mein Elcomm vom Tresen und prüfte den leicht fluoreszierenden Bildschirm. Keine Nachricht, seltsamer Status. In Kalifornien war es doch jetzt heller Tag und Sam hatte sich noch nie gescheut, mir unabhängig von der aktuellen Zeitzone tausende Anweisungen zu übermitteln. Ich genoss die Ruhe und widerstand dem Impuls, Nelly eine Nachricht zu senden. Und doch musste ich etwas tun, und sei es auch nur, der Barkeeperin auf ihre Frage zu antworten.
«Warum sollte ich? Ich kenne die Frau doch gar nicht.»
Im nächsten Moment wurde mir klar, wie lächerlich das war. Eine Frau in einer Hotelbar nachts um halb eins nicht zu kennen, darf kein Grund sein, sie nicht zu beachten, wenn sie dir einen Drink ausgibt.
Okay, sagt nichts, ich rede um den heißen Brei herum. Denn es war etwas anderes, das mich in dieser Nacht so aus der Fassung brachte. Es war, und das könnt ihr mir glauben, die Tatsache, dass die Barkeeperin Nelly kannte. Und natürlich die Faust in meinem Gesicht.
Es war kurz nachdem die Frau in Schwarzrot die Bar verließ. Da die Barkeeperin schwieg, beugte ich mich über mein Elcomm und zu begann zu tippen.
«Mit wem kommunizieren Sie?», fragte sie mich.
Ich überlegte, was ich entgegnen könnte, um sie von weiteren Fragen abzuhalten.
«Ich schreibe meiner Freundin, Nelly.»
«Eine Nelly kenne ich auch», sagte die Barkeeperin, «ich bin Rose.» Sie reichte mir die Hand und lächelte mich an. Mittlerweile bereute ich es, der Frau in Schwarzrot nicht gefolgt zu sein. Sie hätte allerdings, unter uns gesagt, etwas mehr Geduld aufbringen können.
Also Rose. Der Name gefiel mir. Kennt ihr den Doctor und seine Begleiterin? Rose Tylor? Ich habe in meinen Teenagerjahren, und wohl auch später noch, für sie geschwärmt. Die Rose hinter dem Tresen war allerdings nicht blond, sondern braunhaarig. Sie hatte dunkelbraunes, langes, leicht gewelltes Haar, war also wirklich gar nicht mit Rose Tylor vergleichbar.
«Woher kennst du Nelly?», fragte ich Rose in der irrationalen Überzeugung, dass wir von der gleichen Person sprachen, was sehr unwahrscheinlich, aber natürlich nicht unmöglich war.
«Weil wir Freundinnen sind.»
Welch einfältige Antwort, dachte ich mir, sagte stattdessen aber, es gäbe bestimmt viele Nellys.
«Aber warum soll es sich bei meiner Nelly nicht auch um deine handeln?»
Das klang jetzt irgendwie nüchtern.
«Wie viele Nellys gibt es wohl allein schon in dieser Stadt?», sagte ich, wohl wissend, dass meine Nelly nicht in Zürich wohnt.
Also machten wir ein Spiel.
Rose begann: «Meine Nelly trägt im Winter blaue Handschuhe.»
«Und meine Nelly hasst Hüte», fuhr ich fort.
«Meine Nelly mag dafür wärmende Schals», erwiderte sie.
Ich musste leer schlucken.
«Meine Nelly liebt dicke Wollsocken, weil sie immer friert.»
Das ging immer weiter, und es wäre lustig gewesen, wenn sie nicht von exakt der gleichen Person gesprochen hätte wie ich.
Rose sagte: «Nelly hat Angst vor Gewittern, und dann…», ich ergänzte den Satz: «…will sie sich nahe an jemanden schmiegen.»
Ich holte tief Luft.
«Wie nennt sie mich, wenn sie mich necken will?»
«Mein Bernhardiner», sagte Rose ohne zu zögern.
Das konnte sie nun wirklich nicht wissen. Es musste die gleiche Nelly sein.
Ihr könnt mir glauben, ich hätte Rose weitere Dinge gefragt, zum Beispiel warum in aller Welt Nelly und Rose über mich sprechen, und allein die Tatsache, dass meine Nelly andere Menschen kannte, ließ mein Herz einen Tick schneller klopfen. Weil meine Nelly nicht bloß in meinem Elcomm existierte, sondern ein Leben in der Nähe führte. Ein Leben, in dem sie eine Rose kannte. Ich wollte wissen, mit wem meine Nelly sich trifft, wenn sie nicht mit mir kommuniziert. Dann wurde mir plötzlich bewusst, dass Rose noch nicht gesagt hatte, woher sie Nelly kennt. Vielleicht war sie auch für Rose nur Bestanteil eines Elcomm-Chats.
Doch bevor ich ihr diese entscheidende Frage stellen konnte, hatte ich eine Faust im Gesicht.
Der Typ, dem sie gehörte, hatte zuvor still im Türrahmen der Bar gestanden, und er hätte mich vorher zumindest anpöbeln können, im Sinne von: «Hey, lass meine Freundin in Ruhe», irgendwas in der Art, glaubt mir, ich hätte mich still und leise vom Acker gemacht, ich bin kein Held, vor allem nicht, wenn ein Zwei-Meter-Hüne vor mir steht.
Aber er ließ mir keine Möglichkeit zur Flucht. Ich konnte nur still und leise vom Barhocker rutschen und auf dem Parkett landen. Ich sah noch, wie Rose ihren Typen zur Tür rausbugsierte. Es sah seltsam aus, wie die zierliche Rose den massigen Idioten vor sich her schob und er sich nicht wehrte.
Dann, ein paar Minuten später, lehnte sie sich über mich und stillte meine Platzwunde mit einem nassen, kühlen Lappen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Weg durch die Lobby fand, ich weiß nur, dass jemand mich stützte. Keine Ahnung, wie ich in mein Zimmer kam, wer mir das Hemd auszog, das ich am nächsten Morgen über der Stuhllehne fand, noch weniger, wie es sich mit der Hose verhielt. Aber so energisch, wie Rose ihren eifersüchtigen Lover zur Bar hinausbefördert hatte, hatte sie wohl auch mich aufs Zimmer gebracht. Jedenfalls fand ich mich in dieser Annahme bestätigt, als ich einen Zettel auf dem Nachttischchen vorfand:
«Entschuldige meinen Freund, er ist extrem eifersüchtig. Sorry und Grüße, Rose.»
Ich faltete den Zettel zusammen, während mir das Blut aus der wieder aufklaffenden Wunde auf meine Brust tropfte.
«Wer bist du, Rose?», sagte ich leise, «und wo ist meine Nelly?»
Ich versinke im weichen, dunklen Leder des Frühstückssessels wie ein Sahneklecks im Kaffee. Ich will mich wehren, aufrecht sitzen, aber es zieht mich hinunter, Schwerpunktverschiebung. Ein Sog, dem ich mich nicht entziehen kann, als ob eine mir fremde Person sagen würde: «Ich übernehme, ich leite jetzt dein Schicksal, lass dich von mir führen, vertrau mir.» Gleichzeitig komme ich mir lächerlich vor, es ist nur ein Sessel und mein Gewicht keine kosmische Macht. Ich hätte ein paar Minuten länger schlafen sollen, nicht so lange am Tresen hängen, mich weniger ausführlich mit der Barkeeperin unterhalten.
Das Elcomm blinkt. Eine neue Nachricht. Von wem wohl, ratet mal, von Sam. Ich bin froh, dass er kein Freund von Videostreams ist, das hätte mich wohl vollends aus der Fassung gebracht: Sein markantes Gesicht mit dem spitzen Kinn, seine Stirn so glatt wie die Flaschen im Regal, die Nase krumm, als hätte er sie gebrochen, das Haar schon schütter, bevor sein Bartwuchs einsetzte.
Sam tippt seine Nachrichten selber, auch wenn er damit einer aussterbenden Rasse angehört und eigentlich Spezialist auf dem Gebiet der Sprachbedienungssysteme ist. Ich kenne nicht viele Menschen, die noch tippen, ist ja auch umständlich, wir haben tendenziell zu dicke Finger dafür. Nur er und Nelly tippen noch, in meinem Universum zumindest.
«Deine Werte sind im Keller», schreibt er. «Was ist los?»
Bevor ich ihm antworten kann, kommt die Frau von gestern Abend, die heute Morgen ein weißes Kleid mit schwarzer Schleife trägt, zu mir rüber. Warum tut sie das?
«Wenn sich zwei Menschen mehr als zweimal in die Augen schauen, besteht Interesse», schlägt der Elbot vor.
Die Frau setzt sich neben mich. Ich richte meinen Blick wieder nervös auf das Elcomm. Keine Nachricht von Nelly. Dieses Mal bin ich erleichtert. Was hätte das für einen Eindruck gemacht?
Die Frau schaut mich an, sagt aber kein Wort. Stumm wie Nelly. Als ich ihren Blick erwidere, streicht sie mir eine Strähne aus der Stirn.
«Die Wunde sieht nicht gut aus. Ich hätte sie etwas sorgfältiger auswaschen sollen», sagt sie.
Kennt ihr den Bond-Film, in dem er nach einer Schlägerei kurz ins Bad geht, sich über die Gesichtswunden wischt und dann frisch und ohne Spuren wieder an den Casinotisch zurückkehrt? Naja, bei mir klappt das nicht. Ich bin auch kein Agent, und man hat mir kein Heilserum gespritzt, das meine Wunden in Sekunden schließen lässt. Bei mir dauert es Stunden, vielleicht Tage. Kann ich den Japanern so überhaupt begegnen?
Die Japaner, Mist! Es ist ja nicht so, dass ich heute keine Nachrichten bekommen hätte, es sind Dutzende, Anweisungen von Sam, Fragen aus dem Büro, wo sie meine Reise neu koordinieren. Kann sein, dass ich heute früh noch etwas zerknittert war und nur an starken Kaffee denken konnte. Ich hätte sofort antworten sollen. Stattdessen esse ich Brötchen und lasse mir das Haar aus der Stirn streichen. Wären wir in einem Film, wüsste ich die Fortsetzung. Ich würde das Elcomm abstellen, die weiße Hand ergreifen und ganz leise seufzen. Sie würde mich auf ihr Zimmer nehmen und mir das Blut aus dem Gesicht wischen.
Aber wir waren nicht im Film, und selbst wenn sie nichts sagte, sprachen wir nicht die gleiche Sprache. Ich hatte keine Zeit für Gedanken, und das Elcomm kann man auch nicht ausschalten.
Mein Flug geht um elf, ich stehe in der Warteschlange vor dem Check-in und freue mich auf ein paar Stunden Ruhe, in denen ich meine Gedanken ordnen kann.
Glaubt ihr an Schicksal? Ich meine, wer lenkt eure Schritte, wenn ihr mal gedankenverloren über die Straße geht? Wenn euch der Streit des letzten Abends verfolgt? Und ihr nichts seht und niemand euch sieht, weil ihr in diesem Moment unsichtbar seid? Es gibt nur eine Möglichkeit, sich unsichtbar zu machen: Man lässt die Gedanken schweifen. Keine Angst, ich quatsche euch jetzt nicht mit esoterischem Müll zu. Aber das sind Momente, die mich nachdenklich stimmen. Wenn ich mitten auf der Straße stehe und denke: «Was mache ich eigentlich hier?» Oder wenn ich auf einen Moment im meinem Leben zurückblicke und mir überlege, dass mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich mich zu diesem Zeitpunkt für eine andere Option entschieden hätte. Und dann fällt mir ein, dass ich mich gar nicht entscheiden musste, dass mir die Wahl der Alternativen abgenommen wurde.
Heilige Scheiße, ich verquassle mich total, dabei muss ich noch registrieren.
Hey, und wisst ihr was? Überraschung! Die Frau, die jetzt Schwarzweiß trägt, steht ein paar Meter vor mir in der Schlange. Natürlich hat sie das gleiche Reiseziel, die Wahrscheinlichkeit, dass sie gestern Abend denselben Flug verpasst hat, ist ja nicht gering.





























