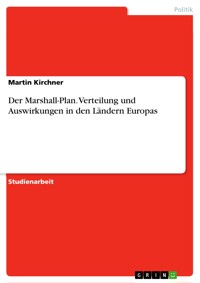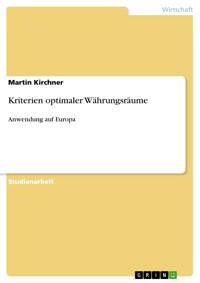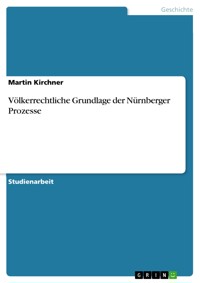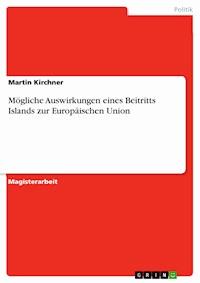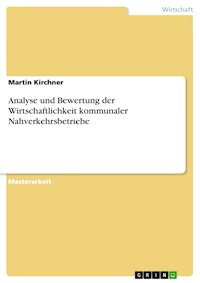
Analyse und Bewertung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Nahverkehrsbetriebe E-Book
Martin Kirchner
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Verkehrsökonomie, Note: 3,0, Fachhochschule Kiel, Sprache: Deutsch, Abstract: Gegenstand der Unternehmensziele öffentlicher Nahverkehrsgesellschaften ist die Erbringung von Dienstleistungen in Form von Beförderung von Personen. Diese entsprechen dem gesetzlich vorgesehenen Zweck kommunaler Unternehmen. Das Regionalisierungsgesetz (RegG) definiert den Öffentlichen Personennahverkehr als öffentliche Aufgabe der Daseinsfürsorge. Der öffentliche Nahverkehr und dessen Infrastrukturnetz prägten entscheidend das Stadtwachstum in den europäischen Staaten. Vor allem der Schienenver-kehr ermöglichte ein starkes Anwachsen der Städte während der industriellen Urbanisierung. Gegenüber den Motorisierten Individualverkehr (MIV) weist der ÖPNV Vorteile im Bereich der Transportkapazität und der relativen Umweltfreundlichkeit auf. Als öffentliche Unternehmen gilt für kommunale Verkehrsbetriebe nicht das klassische Prinzip der Gewinnmaximierung wie für privatwirtschaftliche Akteure. An Stelle dessen orientieren sich die Unternehmen in der Regel an dem Prinzip der Zuschussminimierung. Hier gilt es, den öffentlichen Zuschuss zur Deckung des wirtschaftlichen Defizits zu senken. 2010 lag der durchschnittliche Kostendeckungsgrad kommunaler Nahverkehrsbetriebe in Deutschland bei 77%, wobei dieser im Zeitraum seit 1990 gestiegen ist Die Erbringung der Transportleistung erfolgt in Kommunen in einer vergleichbaren Art. Sichtbare Unterschiede liegen vor allem in der Wahl der Verkehrsmittel. Neben Bussen werden auch Schienenfahrzeuge eingesetzt, als Straßen-, Schnell- oder U-Bahnen. Letztere spielen aufgrund ihrer höheren Kosten nur für größere Städte eine Rolle. In der vorliegenden Arbeit sollen zunächst Städte ohne Straßenbahn hinsichtlich des Fahrgastaufkommens, der Umsatzerlöse und der Personalaufwände miteinander verglichen werden. Dieser Vergleich erfolgt anschließend mit einer Gruppe von Städten, welche neben Bussen zusätzlich Schienenfahrzeuge einsetzen. Durch die Bildung von Durchschnittswerten soll abschließend ein Vergleich zwischen den beiden Städtegruppen erfolgen. Daraus sollen sich Unterschiede und Gemeinsamkeiten ableiten. Des Weiteren wird geklärt, ob die Nutzung von Straßenbahnen das Fahrgastaufkommen erhöht und der Umsatzerlös gesteigert wird. Die Leitfrage ist hierbei die nach der Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Betriebsformen. Im Weiteren sollen die IST-Werte untereinander, bzw. mit den daraus gebildeten SOLL-Kennzahlen verglichen werden. So können Aussagen über die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Nahverkehrsbetriebe getroffen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
I. Inhaltsverzeichnis
III. Abkürzungsverzeichnis
IV. Tabellenverzeichnis
V. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung
1.2 Relevanz des Themas
1.3 Aufbau der Arbeit
2. Thematische Einführung
2.1 Auswahl der Städte
2.2 Bezugsrahmen zur Analyse
2.2.1 Inhaltliche Abgrenzung
2.2.2 Rechtsformen von ÖPNVs
3. Methodik
3.1 Untersuchungsmodell
3.2 Statistische Auswertung
4. Ergebnisse
4.1 Städte ohne Straßenbahn
4.2 Städte mit Straßenbahn
4.3 Vergleich
5. Soll-Kennzahlen
5.1 ohne Straßenbahn
5.2 mit Straßenbahn
6. Diskussion
6.1 Ökonomische Betrachtung
6.2 Zusammenfassung
6.3 Kritische Betrachtung
VI. Literaturverzeichnis
III. Abkürzungsverzeichnis
IV. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1.: Auswahl der Städte ohne Straßenbahn
Tabelle 2.: Auswahl der Städte mit Straßenbahn
Tabelle 3.: Statistische Auswertung.
Tabelle 4.: Fahrgastaufkommen im Vergleich
Tabelle 5.: Umsatzerlöse im Vergleich
Tabelle 6.: Personalaufwand im Vergleich
Tabelle 7. Gibt die Ticketpreise im Verhältnis zur Kaufkraft wieder.
Tabelle 7.: Ticketpreise im Vergleich.
Tabelle 8.: Preiselastizität
Tabelle 9.: SOLL-Fahrgastaufkommen ohne Straßenbahn
Tabelle 10.: SOLL-Umsatzerlöse ohne Straßenbahn
Tabelle 11.: SOLL-Personalaufwendungen ohne Straßenbahn
Tabelle 12.: SOLL-Fahrgastaufkommen mit Straßenbahn
Tabelle 13: SOLL-Umsatzerlöse mit Straßenbahn
Tabelle 14.: SOLL-Personalaufwendungen mit Straßenbahn
Tabelle 15.: durchschnittliche Abweichung vom SOLL-Wert.
V. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1.: Untersuchungsmodell
Abbildung 2.: Fahrgastaufkommen/Einwohner (Städte ohne Straßenbahn)
Abbildung 3.: Umsatzerlöse/Einwohner (Städte ohne Straßenbahn)
Abbildung 4.: Personalaufwand/Einwohner (Städte ohne Straßenbahn)
Abbildung 5.: Umsatzerlöse/Personalaufwand (Städte ohne Straßenbahn)
Abbildung 6.: Kaufkraft/Ticketpreis ( Städte ohne Straßenbahn)
Abbildung 7.: Fahrgastaufkommen/Einwohner (Städte mit Straßenbahn)
Abbildung 8.: Umsatzerlöse/Einwohner (Städte mit Straßenbahn)
Abbildung 9.: Personalaufwand/Einwohner (Städte mit Straßenbahn)
Abbildung 10.: Umsatzerlöse/Personalaufwand (Städte mit Straßenbahn)
Abbildung 11.: Kaufkraft/Ticketpreis (Städte mit Straßenbahn)
Abbildung 12.: Vergleich Städte mit und ohne Straßenbahn