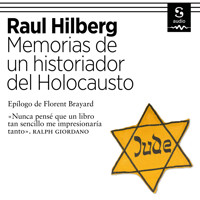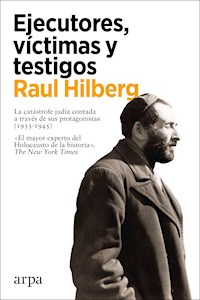14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Der große Historiker Raul Hilberg hat mit seinem Werk ›Die Vernichtung der europäischen Juden‹ die Erforschung des Holocaust maßgeblich geprägt. Auch sein Buch ›Täter, Opfer, Zuschauer‹ ist in der Debatte um die Geschichte des Nationalsozialismus bis heute zentral. Der 2007 verstorbene Doyen der Holocaust-Forschung hat einen reichhaltigen Fundus an wichtigen Texten hinterlassen, die bislang nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Im Band ›Anatomie des Holocaust‹ liegt nun erstmals eine Auswahl dieser Texte auf Deutsch vor. Es geht darin um bis heute kontroverse Fragen zur Geschichte des Holocaust, etwa die Rolle der Judenräte, die Motive der Deutschen für die Verfolgung und Ermordung der Juden und die Frage der moralischen Verantwortung. Zugleich runden sehr persönliche Texte das Bild ab: So beschreibt Raul Hilberg seine bewegende Reise nach Auschwitz als Mitglied der Holocaust-Kommission 1979 und erzählt, wie er seine Arbeit als Holocaust-Forscher empfunden hat. Ein Band, der uns den Menschen und Historiker Raul Hilberg neu entdecken lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Ähnliche
Raul Hilberg
Anatomie des Holocaust
Essays und Erinnerungen
Herausgegeben von Walter H. Pehle und René Schlott
Übersetzt von Petra Post und Andrea von Struve
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorwort
Walter H. Pehle / René Schlott
»Ich bin kein Mensch, der sich fügt.«
Raul Hilberg in Weimar 1995
Jeder, der sich mit der Verfolgung und Ermordung der Juden während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs beschäftigt hat, kennt den Namen Raul Hilberg. Sein Werk »Die Vernichtung der europäischen Juden« ist bis heute unverzichtbar. Doch Raul Hilberg hat auch in zahlreichen anderen Texten wichtige Beiträge zu verschiedenen Debatten in diesem Feld geliefert. Hier werden nun einige dieser oft nur noch schwer zugänglichen Texte, die im Original auf Englisch erschienen sind, erstmals in deutscher Übersetzung publiziert.
Diese Zusammenstellung von Hilberg-Texten lädt dazu ein, den Menschen und Holocaust-Forscher über fünf Jahrzehnte seiner wissenschaftlichen Arbeit zu begleiten. Die dreizehn Texte reichen von 1965, nur wenige Jahre nach dem Erscheinen der englischen Originalausgabe von »The Destruction of the European Jews«, bis in das Jahr 2007, in dem Hilberg starb. Raul Hilberg reflektiert darin einerseits die Ergebnisse und Kontroversen seiner Forschungstätigkeit. Andererseits schildert er aber auch, wie er bestimmte Formen des Gedenkens an den Holocaust sah. Und schließlich finden sich hier Hilbergs Erinnerungen an die Archivreisen, bei denen er das Material für seine Forschungsarbeit zusammentrug. Die Texte vermitteln eine Vorstellung davon, wie der Wissensbestand um die damals noch so genannte »Endlösung« nach Ende des Zweiten Weltkriegs erst mühsam aus Zehntausenden von Verwaltungs- und Gerichtsakten generiert werden musste. Und sie zeigen, wie der Holocaust als Gegenstand der akademischen Forschung etabliert wurde und wie sich diese Forschung zunehmend professionalisierte.
Die wissenschaftliche Beschäftigung Hilbergs mit dem Holocaust fand in den ersten Jahrzehnten weder in der Öffentlichkeit noch in der Geschichtswissenschaft ein sonderlich großes Interesse.[1] Die internationale Ignoranz frustrierte Hilberg manchmal, mitunter verbitterte sie ihn sogar, aber sie brachte ihn niemals dazu, in seinem Forschungseifer nachzulassen.
Erst seit Mitte der 1970er Jahre steigerte sich die Aufmerksamkeit für den Holocaust, zunächst in den USA, dann auch in Westeuropa, und zeitgleich mit dem Erscheinen der deutschen Taschenbuchausgabe von Hilbergs »Die Vernichtung der europäischen Juden« im Jahr 1990 setzte ein internationaler Boom in der Holocaust-Forschung ein, der seit nunmehr 25 Jahren anhält. In der letzten Zeit wurden zahlreiche Forschungszentren in aller Welt gegründet, zuletzt im Juli 2013 das Münchener Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte. Für 2017 plant die Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt die Einrichtung eines Lehrstuhls für Holocaust-Forschung. Die Gründung der international renommierten Forschungsabteilung am Washingtoner Holocaust-Museum hat Hilberg, langjähriges Mitglied des »United States Holocaust Memorial Council«, maßgeblich mit vorangetrieben.
Die von den Herausgebern aus einer Vielzahl von veröffentlichten Texten getroffene Auswahl orientiert sich an den Erkenntnisinteressen des Holocaust-Forschers Hilberg. Sie beschäftigen sich unter anderem mit der Bürokratie des Holocaust, der Zahl der Opfer, der Rolle der Judenräte und der Funktion von Reichsbahn und Wehrmacht im Vernichtungsprozess. Die dabei von Hilbergs Arbeiten ausgehenden wissenschaftlichen Impulse sind auch fast ein Jahrzehnt nach seinem Tod bemerkenswert und virulent.[2] Sie verdienen es, in einer neuen Kompilation zwischen zwei Buchdeckeln den Fachhistorikerinnen und Fachhistorikern, aber auch der am Holocaust interessierten Öffentlichkeit nun in deutscher Sprache zugänglich gemacht zu werden. Viele der Debatten, die Hilberg mitgeprägt hat, sind noch nicht abgeschlossen. Die hier präsentierten Texte bieten Aspekte, die in diesen Kontroversen aufschlussreich sein können.
Von Hilbergs Werk geht eine anhaltende Wirkung auf die Holocaust-Forschung aus, wenngleich diese inzwischen deutlich internationaler ausgerichtet und sehr viel stärker ausdifferenziert ist.[3] Zugleich muss aber nach wie vor Grundlagenarbeit geleistet werden, wie dies etwa in dem ambitionierten Editionsprojekt »Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945« geschieht, dessen Bände demnächst auch in englischer Sprache erscheinen sollen. Diese Maßstäbe setzende Quellenedition wird als Ergänzung des quellengesättigten Hauptwerkes von Hilberg verstanden[4] und orientiert sich in ihrer Quellenauswahl an der von Hilberg etablierten Trias aus »Tätern, Opfern und Zuschauern«.[5] Hilberg, der stets auf die Quellen rekurrierte und 1971 selbst einen nie ins Deutsche übersetzen Quellenband vorgelegt hat,[6] sprach sich in der Planungsphase für dieses große Editionsvorhaben aus, hat aber das Erscheinen der ersten Bände nicht mehr erlebt.
Raul Hilberg starb im August 2007 nach kurzer, schwerer Krankheit. Noch im April desselben Jahres hatte er in der Synagoge seines Wohnortes Burlington seinen letzten öffentlichen Vortrag gehalten und eine Bilanz seiner Ende 1948 begonnenen und bis zu seinem Lebensende fortgesetzten Forschungen zur Vernichtung der europäischen Juden gezogen. Am 2. Juni 2016 hätte er seinen 90. Geburtstag gefeiert. Dem Andenken an das für die Holocaust-Forschung grundlegende Lebenswerk von Raul Hilberg ist dieses Buch gewidmet, das Schlaglichter auf seine sechs Jahrzehnte währende wissenschaftliche Beschäftigung mit dem nationalsozialistischen Judenmord wirft.
Isaac Deutscher hat 1968 daran gezweifelt, dass man Hitler, Auschwitz, Majdanek und Treblinka jemals wird erklären können. Raul Hilberg hat dazu beigetragen, diesen Zweifel etwas zu zerstreuen, indem er, wie er selbst sagte, »Fußnoten nach Auschwitz« schrieb (siehe Beitrag 9), sich diesem Thema also streng analytisch und mit wissenschaftlichen Methoden annäherte. Dennoch: »Am Ende bleibt nichts als die Verzweiflung über alles und der Zweifel an allem, denn für Hilberg gibt es nur ein Erkennen, vielleicht auch noch ein Begreifen, aber bestimmt kein Verstehen.«[7] In seiner Rede zum 70. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 hob der deutsche Historiker Heinrich August Winkler im Deutschen Bundestag die besondere Bedeutung Raul Hilbergs hervor und stellte ihn in eine Reihe mit anderen anerkannten Holocaust-Forschern: »Es sollten Jahrzehnte vergehen, bis sich in Deutschland, nicht zuletzt dank der bahnbrechenden Forschungen von jüdischen Gelehrten wie Joseph Wulf, Gerald Reitlinger, Raul Hilberg und Saul Friedländer, die Einsicht durchsetzte, dass der Holocaust die Zentraltatsache der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts ist.«[8]
Die Texte
Den Auftakt des Buches bildet der 1980 erstmals publizierte Aufsatz »The Anatomy of the Holocaust«, der dem Band seinen programmatischen Titel gibt. Das Ziel, Gestalt und Struktur des Holocaust zu erforschen, steht als Leitmotiv über dem lebenslangen wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse Raul Hilbergs. Dem Politikwissenschaftler Hilberg ging es stets darum, das »Wie« des nationalsozialistischen Völkermordes an den europäischen Juden zu ergründen, die Mechanismen offenzulegen, die einen Vernichtungsprozess derartigen Ausmaßes ermöglichten, und die bürokratische Funktionsweise des Täterapparates zu erfassen. Seine 1955 an der Columbia University eingereichte und 1961 veröffentlichte Dissertationsschrift »The Destruction of the European Jews« ist eine stark von seinen akademischen Lehrern Hans Rosenberg und Franz Neumann inspirierte Analyse einer in vier Phasen abgelaufenen »Maschinerie der Vernichtung«. Hilberg diskutiert im ersten Text des Bandes die Bedeutung von Neumann für sein eigenes Denken und stellt zugleich sein bis heute einflussreiches Phasenmodell aus Definition, Konzentration, Deportation und physischer Vernichtung vor.
Nur ein einziges Mal hat sich Hilberg mit der Frage nach dem »Warum« des Holocaust befasst. Der zweite Beitrag in dieser Sammlung wurde ursprünglich für einen – allerdings nie erschienenen – Gedenkband für seinen 1954 bei einem Autounfall in der Schweiz ums Leben gekommenen Doktorvater Franz Neumann geschrieben. Hilberg geht darin den letztlich nicht überzeugenden Versuchen nach, den Holocaust mit dem Wesen der Opfer und dem der Täter zu erklären. Hilberg hatte nach seiner Dissertation angekündigt, als Nächstes einen Band zu den Gründen der Judenvernichtung vorzulegen, doch blieb es bei diesem frühen Aufsatz aus dem Jahr 1965.
Vielmehr verfolgte Hilberg die Interpretation des Holocaust als administrativen Vorgang weiter, indem er neue Gruppen in seine Analyse des bürokratischen Vernichtungsapparates und des Charakters seiner Bürokraten einbezog. Zwei Beispiele sind die Reichsbahn und die Ordnungspolizei, deren jeweilige Rolle er auf einer Tagung in Paris 1980 analysierte – sein Vortrag ist der dritte Text dieses Bandes. Bei dieser Konferenz war auch Christopher Browning anwesend, der durch Hilbergs Vortrag erstmals auf die Rolle der Ordnungspolizei beim Judenmord aufmerksam wurde und schließlich 1992 seine bahnbrechende Studie »Ordinary Men« (dt. »Ganz normale Männer«) über ein deutsches Polizeibataillon in Polen vorlegte. Neben der historischen Beschäftigung mit dem Holocaust versuchte Hilberg immer wieder, die Bedeutung des Geschehens und seine Folgen für die Gegenwart zu ergründen, etwa in seinem 1980 veröffentlichten Aufsatz zur »Bedeutung des Holocaust« (hier der vierte Text), der auf einen Beitrag für eine Konferenz in San José im Jahr zuvor zurückgeht. Hilberg war am Ende seiner wissenschaftlichen Laufbahn bewusst, dass seine historiographische Arbeit zum Holocaust lückenhaft bleiben musste und der Forschungsprozess eher Weg als Ziel ist, wie er im fünften Text ausführt. Den umstrittenen Besuch Ronald Reagans 1985 auf dem Bitburger Soldatenfriedhof nahm Hilberg zum Anlass, in einem Beitrag für einen Sammelband nicht nur über die bundesdeutsche Gedenkkultur nachzudenken, sondern auch die Beteiligung der deutschen Wehrmacht an der Judenvernichtung pointiert nachzuweisen – gut ein Jahrzehnt, bevor die sogenannte Wehrmachtsausstellung mit der Visualisierung dieser Thematik eine große öffentliche Kontroverse in der Bundesrepublik anstoßen sollte.
Auch Hilberg selbst löste Debatten mit seiner Arbeit aus, die zum Teil bis heute anhalten. Neben der skeptischen Einschätzung des jüdischen Widerstandes im Holocaust war insbesondere sein Blick auf die Judenräte als »Instrument« der Deutschen beim Judenmord umstritten. In einer Besprechung des grundlegenden, doch bis heute nicht ins Deutsche übersetzten Werkes von Isaiah Trunk, »Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation«, das 1972 in den USA erschienen war, modifiziert Hilberg seine vormals harsche Position. In diesem hier abgedruckten siebenten Text verweist er wiederholt auf das Tagebuch von Adam Czerniaków, Vorsitzender des Judenrats im Warschauer Ghetto von 1939 bis 1942, dessen Aufzeichnungen Hilberg 1979 in einer englischen Übersetzung herausgegeben hatte.[9] An dem Editionsprojekt waren neben Hilberg ein polnischsprachiger Kollege von der Universität Vermont, Stanislaw Staron, und Josef Kermisz, ein Mitarbeiter der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, beteiligt.
Nachdem das Verhältnis Hilbergs zu seinen israelischen Kollegen anfangs nicht zuletzt deshalb sehr angespannt war, weil man dort die Veröffentlichung seiner Dissertation abgelehnt[10] und sie nach deren Publikation schließlich in einer Rezension zerrissen hatte[11], normalisierten sich die Beziehungen allmählich. 1977 nahm Hilberg erstmals an einer Konferenz in Jerusalem teil, wo er über Judenräte, ihre »Illusionen« und ihre Wurzeln in der jüdischen Geschichte sprach – der achte Beitrag in diesem Band. Inhaltlich lagen die Positionen zwischen Hilberg und den Historikern in Yad Vashem noch immer weit auseinander, und Hilberg musste sich auf der Konferenz einer harschen Kritik von Gideon Hausner stellen. Immerhin aber redeten die Kontrahenten nun miteinander.
Obwohl Hilberg, der mit elf Jahren in Wien den »Anschluss« Österreichs und 1938 das November-Pogrom erleben musste, in gewisser Weise selbst ein Überlebender des Nazi-Terrors war, stand er dem Quellenwert von Überlebenden-Berichten skeptisch gegenüber – eine bis in unsere Gegenwart umstrittene Einschätzung. 1988 erläuterte er in einem hier an neunter Stelle zu lesenden Beitrag für den Band »Writing and the Holocaust« diese Vorbehalte und dachte zugleich über die Quellen und die Sprache nach, mit der sich der Judenmord beschreiben ließe.
Im Jahr 1979 kehrte Hilberg nach Yad Vashem zurück, diesmal als Mitglied einer von Elie Wiesel angeführten Delegation, die im Auftrag von US-Präsident Jimmy Carter ein Konzept für ein Holocaust-Museum in den USA ausarbeiten sollte. Zu diesem Zweck reiste die Kommission unter anderem nach Polen und in die Sowjetunion, wo Hilberg zum ersten Mal die Stätten der Vernichtung sah und in Warschau auch das Grab von Czerniaków aufsuchte. 1982 veröffentlichte er seine sehr persönlich gehaltenen Erinnerungen an diese Reise – hier der zehnte Text.
Obwohl Hilberg sich nach dem Ende des Krieges vorgenommen hatte, mindestens vier Jahrzehnte lang keinen deutschen Boden zu betreten, reiste er 1976 in die Bundesrepublik, um nach Aktenmaterial zu forschen. Wie ambivalent das Verhältnis des jüdischen Exilanten und vormaligen US-Soldaten Hilberg gegenüber den Deutschen zu diesem Zeitpunkt noch immer war, geht aus dem Reisebericht hervor, den Hilberg drei Jahre nach der Reise in dem in New York erscheinenden jüdischen Debattenblatt »Midstream« veröffentlichte, der hier als elfter Beitrag zu finden ist.
Der zwölfte Text gibt das Protokoll eines Gesprächskreises zur Psychohistorie wieder, zu dem der bekannte US-Psychiater Robert Lifton (*1926) Hilberg in sein Haus in Wellfleet am Cape Cod in Massachusetts geladen hatte. Bei dieser Gelegenheit sprach der damals fast sechzigjährige Hilberg zum ersten Mal über seine eigene Biographie und reflektierte seinen Weg als Holocaust-Forscher.
Den Abschluss dieser Sammlung bildet ein Vortrag, den Hilberg 2005 bei einer Konferenz in Yad Vashem gehalten hat. Darin warf er einen Blick auf die Historiographiegeschichte des Holocaust und bilanzierte die Ergebnisse seines eigenen, sechs Jahrzehnte währenden Forschungsprozesses. Er endete mit den Worten: »Und wenn ich zurückblicke, stelle ich sehr zufrieden fest, dass wir eine weit größere Anstrengung unternahmen, als ich je für möglich gehalten hätte.«[12]
Editorische Hinweise
Grundlage der vorliegenden Edition von Texten Raul Hilbergs sind deren englischsprachige Erstdrucke. In der Mehrzahl handelt es sich um Vorträge, die später in Tagungsbänden veröffentlicht wurden. Da Hilberg ohne Manuskript zu sprechen pflegte, beruhen sie auf Mitschriften, die vor der Drucklegung von ihm durchgesehen wurden. Sprache und Aufbau entsprechen weiter dem mündlichen Vortrag; einige Beiträge enthalten deshalb auch keine Anmerkungen.
Die deutschen Übersetzungen dieser Texte wurden von den Herausgebern durchgesehen. Marginalien, wie Schreibfehler bei Eigennamen oder Zahlendreher in den Originalvorlagen, wurden korrigiert, ohne dass dies im Text kenntlich gemacht worden ist. Englische Schreibweisen von Eigennamen wurden den deutschen Varianten angepasst. Von Hilberg offenkundig intendierte Abweichungen von den Normen wissenschaftlicher Texte wurden übernommen. Alle Textergänzungen durch die Herausgeber werden mit eckigen Klammern kenntlich gemacht. Dies betrifft vor allem, aber nicht nur, Aktualisierungen und Ergänzungen in den Zitatnachweisen und in den bibliographischen Angaben. Von den Herausgebern eingefügte, ausführlichere Zusatzinformationen erscheinen mit einem Sternchen versehen jeweils am unteren Seitenrand.
Wie bei jeder Übersetzung von einem Original in eine andere Sprache, hat auch diese Übertragung ihre Grenzen. In der deutschen Version gingen manche der im Englischen sehr treffenden Sprachbilder mangels genauer Entsprechung verloren, und zugunsten eines flüssigen deutschen Textes musste auf die exakte Wiedergabe mancher Eigentümlichkeit des Hilberg’schen Sprachstils verzichtet werden. Erkennbar aber bleiben die direkte Sprache und der manchmal zu Ironie und Sarkasmus neigende Tonfall, mit dem Hilberg über den Holocaust schrieb. Er selbst erklärte einmal, sein eigenwilliger Schreibstil aus kurzen, aufeinanderfolgenden Hauptsätzen sei von einer frühen Bibellektüre inspiriert.[13]
Die Reihenfolge der Beiträge und ihre Gruppierung folgen einer losen thematischen Zuordnung. Die Benennung der unterschiedlichen Rubriken rekurriert auf das Hauptmotiv der zugeordneten Texte. Der Band ist nicht so angelegt, dass die Lektüre der Beiträge aufeinander aufbaut oder dass diese einer Dramaturgie folgen, so dass die interessierte Leserin und der interessierte Leser an jeder Stelle mit jedem Beitrag des Buches einsteigen kann. Wiederholungen von Episoden oder von Argumenten in verschiedenen Beiträgen wurden aus diesem Grund bewusst belassen und von den Herausgebern nicht gestrichen. Sie mögen in der Gesamtlektüre redundant erscheinen, haben aber in dem Einzelbeitrag ihren Platz. Der oder die Lesende kann sich so auf ganz verschiedenen Wegen von der thematischen Breite und der intellektuellen Tiefe in Hilbergs Denken überzeugen und herausfordern lassen.
Dank
Der Dank der Herausgeber gilt der Familie Hilberg, insbesondere Raul Hilbergs Witwe Gwendolyn, für die Unterstützung dieser Edition. Anne-Sophie Kruppa hat nicht nur beim tagelangen Wort-für-Wort-Abgleich von Original und Übersetzungsentwurf geholfen, sondern dankenswerterweise auch die Erstellung der Register übernommen, an denen Raul Hilberg viel gelegen hätte, weil ihm die wissenschaftliche Nutzung und Weiterverarbeitung seiner Forschungsergebnisse ein lebenslanges Anliegen gewesen ist.
I. Forschungen
1.Die Anatomie des Holocaust
(1980)
Mitten im Krieg schrieb ein bemerkenswerter Mann namens Franz Neumann, der für [den amerikanischen Nachrichtendienst] »Office of Strategic Services« und das US-amerikanische Außenministerium tätig war, ein Buch über das nationalsozialistische Deutschland mit dem Titel Behemoth. Die erste Ausgabe erschien 1942, die zweite, erweiterte, 1944. Neumann konnte sich auf keinerlei Originaldokumente stützen. Erst seit dem Zusammenbruch Deutschlands stehen uns diese zur Verfügung und stellen inzwischen die Hauptquelle für unser Wissen über den Vernichtungsprozess dar. Neumann untersuchte Artikel aus Tageszeitungen und Zeitschriften sowie Gesetzestexte, die irgendwie über die Schweiz in die USA gelangt waren. Sein Ansatz war rein intuitiv, aber seine Analyse der Struktur des NS-Regimes zeugt von außergewöhnlichem Scharfsinn. Für ihn war Deutschland ein »Unstaat«, ein »Behemoth«, aber kein Staat. Er identifizierte vier hierarchisch aufgebaute Gruppen, die unabhängig voneinander agierten, aber hin und wieder »Gesellschaftsverträge« schlossen, wie er es sarkastisch nannte. Diese vier – das Beamtentum, das Militär, zu einem späteren Zeitpunkt auch ein Konglomerat von Wirtschaftsunternehmen und schließlich die NSDAP und ihr Apparat – wurden gelegentlich von Verfassungsrechtlern und Historikern als die wahren Stützen des modernen Deutschland bezeichnet.
Einige Jahre später tauchten während der Nürnberger Prozesse, vor allem während des ersten, Unmengen von Dokumenten auf – der Nachlass eines umfangreichen Beamtenapparats. Das Hauptproblem bestand darin, diese Hunderttausende von Schriftstücken sinnvoll zu ordnen. Schließlich entschied man sich für folgende vier Kategorien: NG, NI, NO und NOKW. NG stand für »Nazi Government« und bezeichnete den Schriftverkehr innerhalb des Beamtentums, NI für »Nazi Industry«, NO bedeutete »Nazi Organizations« und enthielt Parteidokumente, und NOKW stand für »Nazi Oberkommando der Wehrmacht«. Interessanterweise hatten die Archivare und Wissenschaftler, die das Material für die Prozesse zusammenstellten, dasselbe Ordnungssystem wie Franz Neumann gewählt. Auch sie unterschieden zwischen vier Hierarchien.
Ich hatte das Glück, Franz Neumann bereits zu Beginn meines Masterstudiums an der Columbia University kennenzulernen. Neumann war kein besonders zugänglicher Mensch, und ich wollte ihm nicht gleich erzählen, dass ich mich für die Vernichtung der Juden interessierte. Deshalb sagte ich, dass ich die Rolle, die das Beamtentum bei ihrer Vernichtung gespielt habe, untersuchen wolle. Er nickte, und das war alles, was er zu diesem Thema von sich gab, vielleicht auch, weil er schwer hörte. Aber eigentlich hatte ich vor, alle vier Gruppierungen unter die Lupe zu nehmen, weil ich der Meinung war, dass alle vier an der Auslöschung des Judentums beteiligt waren. Als mir klarwurde, dass ich dann vier separate Abhandlungen schreiben müsste, gab ich mein Vorhaben auf. Ich würde ein anderes Schema, eine andere Anatomie entwerfen müssen. An diesem Punkt meiner Überlegungen stieß ich zufällig auf die brillante Analyse eines scharfen Beobachters, der den Krieg in Ungarn verbracht hatte. Rudolf Kastner, ein Jude, der so kühn war, 1944 mit den Deutschen über den Freikauf der ungarischen Juden zu verhandeln (leider scheiterten seine Versuche), gab in Nürnberg kurz nach seiner Befreiung eine eidesstattliche Erklärung über seine Erfahrungen und Einschätzungen ab. In einer achtzehnseitigen Zusammenfassung ist nachzulesen: Jahrelang saßen wir in Ungarn, umgeben von anderen Achsenmächten, und beobachteten, wie die Juden aus Deutschland verschwanden. Wir beobachteten, wie sie aus Polen verschwanden. Wir beobachteten, wie sie aus Jugoslawien und vielen anderen Orten verschwanden. Und dann fiel uns – vielmehr Kastner – auf, dass überall dasselbe passierte, dass die Abfolge der Ereignisse immer gleich war, dass ein Schritt auf den anderen folgte. Kastner skizzierte diese Schritte in groben Zügen. Und plötzlich verstand ich, dass die Vernichtung der Juden ein Prozess war.
In diesem administrativen Prozess war der Weg der Bürokratie nicht durch einen Plan oder eine Strategie, sondern durch die Natur des Vorhabens vorgezeichnet. So konnte eine Gruppe von Menschen, verteilt über die Völker eines ganzen Kontinents, nicht konzentriert und zusammengetrieben werden, bevor sie nicht identifiziert und definiert war. Ein Schritt folgte auf den anderen, und jeder basierte auf dem vorangegangenen. Die Vernichtung der Juden erfolgte nach einer inhärenten Logik, unabhängig von dem Weitblick oder den Plänen der Täter. Man hätte den Prozess jederzeit und an jedem Ort abbrechen können, aber in seinem Fortschreiten – oder seiner »Eskalation« – konnte man einzelne Schritte nicht auslassen. Die Täter mussten sich an den genauen Ablauf halten. Sie mussten nach und nach die Beziehungen und Verbindungen der jüdischen Gemeinden zur übrigen Bevölkerung durchtrennen, und zwar in allen Regionen des von Deutschen beherrschten Europa.
Dieser Logik zufolge bestand der erste Schritt darin, »jüdisch« zu definieren. Nichts leichter als das, sollte man meinen. Aber weit gefehlt. Es gibt eine jüdische Definition des Begriffs »Jude«, aber die galt für die Deutschen nicht. Für sie war nicht die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion oder die Abstammung von einer jüdischen Mutter ausschlaggebend. Denn manche Juden waren erst vor kurzem zum Christentum übergetreten, oder es waren Halbjuden mit einem jüdischen Vater, die dem Judentum zufolge keine Juden, aber in den Augen des Dritten Reichs auch keine Deutschen waren. Wenn Juden nur über die Religionszugehörigkeit definiert würden, könnten sie über Nacht konvertieren und somit der Verfolgung entgehen, ein im Mittelalter durchaus praktiziertes Vorgehen, aber in einer rassistischen Umgebung wie dem Dritten Reich unmöglich. Gleichzeitig wusste man, dass man Juden nicht immer an ihrem Aussehen erkennen konnte. Die Definition konnte nicht auf dem Ausmessen von Gesichtern beruhen. Die gesamte Vorstellung von Rassen hatte eine ideologische Färbung, war aber administrativ kaum anwendbar.
Ein Beamter des Reichsinnenministeriums (der ursprünglich beim Hauptzollamt [Glatz, Schlesien] arbeitete) war für die Endfassung der Verordnungen verantwortlich, die wir mit den Nürnberger Gesetzen verbinden. Bereits in dem allerersten Gesetz, das Maßnahmen gegen die Juden vorsah, dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 1933, wurde dargelegt, was unter »nichtarisch« zu verstehen war. Diesen Begriff hatten die Deutschen bereits im 19. Jahrhundert gegenüber den Japanern verwandt. Als die japanische Regierung damals gegen diese Beleidigung protestierte, wiegelten die Deutschen ab: »Moment, wir meinen damit doch nicht, dass unterschiedliche Rassen qualitativ unterschiedlich sind; sie sind einfach nur anders.« Aber natürlich war die Sache weitaus komplizierter.
Als nichtarisch galt jede Person, bei der ein Großelternteil der jüdischen Religion angehört hatte. Eine Person mit einem jüdischen Großelternteil konnte aus dem öffentlichen Dienst oder dem Schuldienst entlassen werden. Im fortschreitenden Vernichtungsprozess erwies sich eine solche Definition, die »Dreivierteldeutsche« einschloss, allerdings als zu rigoros. Bernhard Lösener, der Zollbeamte, der ins Reichsinnenministerium versetzt worden war, erhielt den Auftrag, den Begriff »Jude« zu definieren. Er musste sich beeilen, denn in Nürnberg war ein Strafgesetz erlassen worden, demzufolge es »Juden« verboten war, Deutsche zu heiraten und außerehelichen Geschlechtsverkehr mit Deutschen zu haben; außerdem wurde ihnen untersagt, deutsche Frauen unter 45 Jahren im Haushalt zu beschäftigen. Der Begriff »Jude« wurde in diesem Strafgesetz nicht näher erläutert.
Also musste eine Durchführungsverordnung formuliert werden, die die fehlende Definition beinhaltete. Dieser neuen Verordnung zufolge war eine Person jüdisch, wenn sie drei oder vier jüdische Großelternteile hatte, unabhängig von ihrer eigenen Religionszugehörigkeit. Es spielte keine Rolle, ob diese Person als Christ erzogen worden war oder ihre Eltern Christen waren, es genügte, dass die überwiegende Zahl der Großeltern jüdischen Glaubens war, um als Jude eingestuft zu werden. Wenn jemand zwei jüdische Großelternteile hatte, galt er nur als Jude, wenn er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung dem jüdischen Glauben angehörte oder mit einem Juden oder einer Jüdin verheiratet war. Ausschlaggebend war jedoch die Religionszugehörigkeit der Großeltern. Aus diesem Grund tauchte in Deutschland ein neuer Berufsstand auf, der des Sippenforschers. Das waren Fachleute auf dem Gebiet der Ahnenforschung, die bei Ämtern und Kirchengemeinden nachforschten und anhand von offiziellen Dokumenten oder Taufregistern den Beweis für die Religionszugehörigkeit der Großeltern erbrachten.
Somit hatten Juden keine Möglichkeit mehr, ihren Status zu ändern und dadurch ihrem Schicksal zu entgehen. Der nächste Schritt im Vernichtungsprozess war ökonomischer Natur und bezog sich vor allem auf die Enteignung jüdischer Firmen, ein Prozess, der als Arisierung bekanntwurde.
Zunächst waren die Arisierungen »freiwillig«. Deutsche Firmen unterbreiteten, mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums, jüdischen Unternehmen ein Kaufangebot, das jedoch immer unter dem Marktwert der betreffenden Firma lag. Dennoch versuchten jüdische Unternehmer, wie aus den Akten hervorgeht, einen fairen Preis zu erzielen, während deutsche Firmeninhaber miteinander um jüdisches Eigentum konkurrierten, um ihren Marktanteil auf einem bestimmten Sektor auszubauen. Diese Phase der Akquisition ging mit den Novemberpogromen 1938 zu Ende. Ab diesem Zeitpunkt waren die Arisierungen nicht mehr freiwillig. Jüdische Firmen konnten über deutsche »Treuhänder« verkauft oder liquidiert werden. Die jüdischen Angestellten dieser Unternehmen wurden arbeitslos.
Der nächste Schritt war die Konzentration, die Absonderung und soziale Isolierung der jüdischen Gemeinden. Bereits das sogenannte Blutschutzgesetz, das die Eheschließung zwischen Juden und Deutschen untersagte, war ein Schritt in diese Richtung. Andere folgten, darunter die Maßnahme, die Verwaltung der jüdischen Gemeinden künftig deutscher Kontrolle zu unterwerfen. Fortan stellten die Deutschen im Reich wie auch in den eroberten Gebieten jüdische Leiter und jüdisches Personal ein, die sich um die Wohnungsfrage, die Konfiszierung persönlicher Besitztümer, Zwangsarbeit und sogar Deportationen kümmerten. Im Vorfeld der Gewalt und der Verhaftungen vom November 1938 diskutierten Hermann Göring und andere NS-Größen darüber, ob man Ghettos innerhalb Deutschlands errichten sollte. Die Idee wurde verworfen, vor allem der Polizeiexperte Reinhard Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, sprach sich dagegen aus. Er argumentierte, jeder Deutsche könne die Juden als eine Art Hilfspolizist im Auge behalten, solange sie nicht hinter Mauern verschwänden und damit nicht mehr sichtbar wären.
Weniger als ein Jahr nach dem Treffen brach der Krieg aus. Polen wurde annektiert und mehrere Millionen Juden gerieten in den Machtbereich des Deutschen Reichs. Wenig später begann der Prozess der Konzentration; das mittelalterliche Ghetto wurde wieder Realität. Das größte war das Warschauer Ghetto, das zweitgrößte das in Lodz, aber es gab noch Hunderte weitere. Alle waren geschlossene Stadtstaaten mit einer Vielfalt von Funktionen und alltäglichen sowie außergewöhnlichen Aufgaben. Das ist eine Geschichte, so vielfältig, so divers und so komplex, dass sie Aufmerksamkeit an und für sich verlangt. Isaiah Trunk beschreibt in seinem Buch Judenrat nicht nur die »Selbstverwaltung« durch den Judenrat, sondern auch die Struktur der Ghettos und ihre sozialen, wirtschaftlichen und politischen Probleme unter den Nationalsozialisten.
Die Errichtung der Ghettos warf viele Fragen auf. Was sollte mit den eingesperrten Juden geschehen? Die Anzahl der Toten nahm langsam, aber stetig zu. Wir verfügen über detaillierte Statistiken aus Lodz und Warschau, wenn auch nicht aus allen Ghettos. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit – im Ghetto Lodz herrschte eine Art jüdische Diktatur, während es im Warschauer Ghetto, wo es sogar Privatbetriebe gab, laxer zuging – war die Anzahl der Unterernährten und Kranken etwa gleich hoch; die Zahl der Toten betrug monatlich etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung.
Im Juni 1940 war es deutschen Truppen gelungen, innerhalb kurzer Zeit Frankreich, Belgien und die Niederlande zu besetzen. Nach diesem schnellen Landsieg erwog man einen Friedensvertrag mit England. Wäre dieser zustande gekommen, hätte er automatisch Frankreich miteingeschlossen, und Frankreich hätte Madagaskar an die Deutschen abtreten müssen. Die Insel wäre von der Polizei kontrolliert worden, und man hätte sämtliche europäischen Juden dorthin deportiert. Zumindest sahen so die phantastischen Pläne eines Teils des Auswärtigen Amts aus. Aber die Briten lehnten Hitlers Friedensangebot ab. Daraufhin begann ein Prozess des Umdenkens. In der Vergangenheit hatte es nur zwei Vorgehensweisen im Umgang mit den Juden gegeben: Entweder hatte man sie gezwungen zu konvertieren, oder sie wurden aus ihrem Heimatland vertrieben. Vertreibung war nun unmöglich geworden. Mitten im Krieg können Millionen von Menschen nicht davongejagt werden. Erzwungene Emigration war nicht länger machbar. Daraufhin kam die Idee einer territorialen Lösung auf. Aber wie sollte diese umgesetzt werden? Weder 1940 noch Anfang 1941 gab es irgendwelche konkreten Pläne. Alle warteten auf eine Entscheidung.
Dann begann die Planungsphase des »Unternehmens Barbarossa« (der Überfall auf die Sowjetunion). Der Angriff war in einer militärischen Besprechung vor dem 22. Juli 1940 in Betracht gezogen worden, und die Pläne nahmen in einer Direktive nach der anderen, in einem Schlachtplan nach dem anderen und in Verhandlungen mit den Verbündeten Gestalt an. Im Verlauf dieser Vorbereitungen wurde vom Oberkommando des Heeres ein Dokument aufgesetzt, das einen kryptisch anmutenden Satz enthielt, demzufolge das Heer von Spezialeinheiten der SS und der Polizei begleitet werde, die in den eroberten Gebieten bestimmte staatspolitische Aufgaben zu erfüllen haben. Das war der Beginn der ersten Tötungswelle. Sie ging auf einen »Gesellschaftsvertrag«, wie es Neumann genannt hätte, zwischen der Wehrmacht, der SS und der Polizei zurück. Dieser »Vertrag« bestand aus einer Reihe von Abkommen, die von Eduard Wagner, dem Generalquartiermeister des Heeres, und Vertretern der Sicherheitspolizei, vor allem Heydrich und Schellenberg, ausgearbeitet wurden. Am 22. Juni 1941, als die deutschen Streitkräfte in Russland einfielen, wurden sie von diesen Einheiten der Sicherheitspolizei, den sogenannten Einsatzgruppen, begleitet, die auf der Stelle mit der Erschießung der Juden begannen.
Die Einsatzgruppen schickten täglich Berichte nach Berlin. Die aufschlussreichen Dokumente gingen an mehrere Empfänger, aber nach dem Krieg entdeckte man nur einen Satz Kopien. Auch von den Originalberichten sind nur noch wenige vorhanden. Einer davon stammt aus der Sowjetunion. Es handelt sich dabei um den Bericht eines Kommandos, dessen Einsatzgebiet Litauen war und das dort zwischen Juni 1941 und Januar 1942135000 Juden getötet hatte. Ein Kommando war eine Einheit von der Größe einer Kompanie, unterstützt von örtlichen Hilfskräften.
Die besetzten Gebiete der UdSSR waren wiederholt Schauplätze von Massakern. Bisweilen kehrten die Einsatzgruppen wieder und wieder an denselben Ort zurück, ließen Juden zusammentreiben und erschießen. In Weißrussland flohen viele Verfolgte in die Wälder; nur wenige überlebten die Razzien und Exekutionen in der Ukraine.
Aber die Erschießungskommandos hatten ihre Probleme. Die Deutschen benutzten den Begriff »Seelenbelastung«[*], unter der die Soldaten litten, wenn sie ihre Gewehre oder Maschinengewehre auf Männer, Frauen und Kinder in für diesen Zweck ausgehobenen Gräben richteten. Schließlich waren die Schützen selbst Väter. Wie konnten sie Tag für Tag dieser Belastung standhalten? Um die Leiden der Täter zu mildern, entwickelten Techniker einen Gaswagen. Es handelte sich dabei um ein Fahrzeug, dessen Auspuffgase in den Innenraum geleitet wurden, so dass die 70 Insassen auf dem Weg zu ihren Gräbern mit Kohlenmonoxid vergiftet wurden. Die Gaswagen wurden anfangs im Osten für Frauen und Kinder eingesetzt; es versteht sich von selbst, dass es eine schmutzige Arbeit war, die Toten am Ziel auszuladen.
1941, einige Wochen nach dem Angriff auf die Sowjetunion, schrieb Hermann Göring einen Brief an Reinhard Heydrich, in dem er ihn mit der Endlösung der Judenfrage in Europa beauftragte. Ich habe diesen Brief immer als Signal für die vollständige Auslöschung der europäischen Juden angesehen, als den entscheidenden Schritt über eine unsichtbare Schwelle. Obwohl Göring sich nicht dazu äußerte, wann und wie diese Anordnung umgesetzt werden sollte, schwang in seinen Worten Endgültigkeit und Unwiderruflichkeit mit.
Wie also sollten die Tötungen erfolgen? Ab November 1941 gab es Überlegungen, die Juden zu den Einsatzgruppen zu bringen, damit sie von erfahrenen Schützen getötet würden. Deshalb wurden deutsche Juden nach Minsk, Riga und Kaunas deportiert. Aber auf lange Sicht wäre das Erschießen von Millionen von Menschen ein unlösbares Problem; es gäbe zu viele Zeugen, zu viele Leichen, zu viele seelisch belastete Mitglieder der SS und Polizei. Also wurden viele Deportierte in die überfüllten polnischen Ghettos gebracht. Die Ghettos selbst sollten allerdings bald aufgelöst werden. In verschiedenen Teilen des besetzten Polens bauten die Deutschen Einrichtungen für die lautlose Tötung der Juden – die Gaskammern. Es gab reine Vernichtungszentren wie Kulmhof, Treblinka, Sobibor und Belzec, die allein dazu dienten, die Opfer direkt nach ihrer Ankunft zu vergasen. Auschwitz war ein komplexeres Lager, weil zu ihm neben den Gaskammern auch Industriebetriebe gehörten. In Auschwitz erfolgte die Tötung durch Blausäuregas, das sogenannte »Zyklon B«. Das Granulat wurde von einem SS-Mann, der eine Gasmaske mit einem speziellen Filter trug, aus einer Metalldose durch Öffnungen in der Decke in die Gaskammer gekippt. In der überfüllten Kammer wurde es sofort zu Gas.
Der Transport der Juden aus ganz Europa in den Osten war ein aufwendiges Unterfangen. Das Auswärtige Amt handelte mit den Satellitenstaaten Verträge über die Auslieferung der Juden aus und verlangte, dass diese das Land endgültig verlassen, aber im Gegenzug ihren Besitz zurücklassen müssten. Manche der Verbündeten lehnten das ab. Die Rumänen, die zunächst in Russland kaltblütig gemordet hatten, sträubten sich und traten im Herbst 1942 von dem Vertrag zurück, während Bulgarien die Entscheidung hinauszögerte, aber schließlich die Deportation von Juden aus seinen besetzten Gebieten in Jugoslawien und Griechenland genehmigte, allerdings nicht aus dem Kernland selbst.
Das französische Vichy-Regime entschloss sich zu einem Kompromiss: Es verhandelte mit den Deutschen und erreichte, dass nur ausländische Juden ausgeliefert wurden, während Juden französischer Nationalität verschont blieben. »Wie kann ein besetztes Land jemandem Asyl gewähren?«, fragte der französische Premier Pierre Laval. Die Italiener lieferten nicht nur keine Juden aus, sondern erlaubten auch nicht die Deportation von Juden aus Regionen, die in ihrem Einflussbereich lagen, wie Teile von Frankreich, Griechenland und Jugoslawien. Aber die Deutschen gaben sich nicht so leicht geschlagen. In einem Bericht ist die Rede von zwölf Juden, die man in Liechtenstein aufgespürt hatte. »Was machen sie dort?«, lautete die empörte Frage. Selbst Deportationen aus Monaco wurden erwogen. Viele hundert norwegische Juden wurden aus Oslo und Trondheim deportiert und in Auschwitz vergast.
Aufgrund des Kriegs hatten die Deutschen ein Transportproblem. Der Transport zu den Vernichtungszentren erfolgte in der Regel per Bahn, selbst über große Entfernungen hinweg, wie im Fall der Deportationen aus Südfrankreich oder dem Süden Griechenlands. Für das Verkehrsministerium stellte die Beförderung der Juden eine finanzielle und logistische Herausforderung dar. Im Prinzip musste jeder Personentransport finanziert werden. Juden waren »Reisende«, und die Gestapo bezahlte eine einfache Fahrkarte dritter Klasse für jeden Deportierten. Die Reichsbahn kam der Gestapo insofern entgegen, als sie ihr einen Gruppentarif (halber Dritter-Klasse-Preis) gewährte, wenn wenigstens 400 Personen zu befördern waren. Die Gestapo ihrerseits versuchte, ihre Unkosten auf die jüdischen Gemeinden abzuwälzen. Obwohl diese »Selbstfinanzierungen« gegen die übliche Zahlweise verstießen, duldete das Reichsfinanzministerium diese Praktiken.
Das logistische Problem war ungleich größer. Für jeden Todestransport mussten die Verwaltungen der Haupt- und Regionalbahnhöfe Betriebsmittel zur Verfügung stellen und die Benutzung der Gleise gewährleisten. Diese Transporte hatten allerdings selten Priorität, eine Klassifizierung hätte sie als das ausgewiesen, was sie waren. Stattdessen wurden sie, wann immer möglich, eingeschoben. Man setzte sie vor oder nach regulär verkehrenden Zügen ein. Für jeden Zug musste ein Sonderfahrplan erstellt werden. Trotz des kriegsbedingten erhöhten Planungsaufwands und der Niederlage in Stalingrad wurden die Deportationen mit Vehemenz vorangetrieben. Die Deutschen waren fest entschlossen, die Judenfrage in Europa ein für alle Mal zu lösen.
Ende 1942 hatte das Vernichtungslager Belzec seinen Zweck erfüllt und wurde abgetragen. Sechshunderttausend Juden starben in Belzec; es gibt nur einen bekannten Überlebenden. In Sobibor und Treblinka gab es Aufstände der Häftlinge. Einige dutzend Menschen haben diese beiden Lager überlebt, aber eine Viertelmillion (Sobibor) und eine Dreiviertelmillion (Treblinka) sind dort ermordet worden. Das einzige Lager, das während des gesamten Kriegs intakt blieb, war Auschwitz. Es lag am weitesten westlich, abseits der Route der vorrückenden Roten Armee. Es wurde 1944 sogar noch erweitert. Das Jahr 1944 ist besonders interessant für uns, weil zu diesem Zeitpunkt niemand mehr behaupten konnte, von nichts gewusst zu haben. Die Juden wussten Bescheid. Die Deutschen wussten Bescheid. Die Briten, ebenso wie die Amerikaner, alle wussten Bescheid. Es hatte erfolgreiche Fluchtversuche aus Auschwitz gegeben; außerdem konnte man sich an das »War Refugee Board« in den USA, eine Sammelstelle für Informationen, wenden. Trotzdem wurden von den Alliierten keinerlei ernsthafte Versuche unternommen, um die Juden freizukaufen. Man zog weder psychologische Kriegsführung in Erwägung noch die Bombardierung der Gaskammern.
Die Deutschen konnten ungehindert die Vernichtung der europäischen Juden fortsetzen, selbst während des Bombardements durch die Alliierten, auch dann noch, als die sowjetischen Streitkräfte nach Rumänien und Ostpolen vordrangen und die Alliierten an der französischen Küste landeten. Bis zuletzt waren die Wehrmacht, die SS, das Reichsverkehrsministerium, das Auswärtige Amt ebenso wie Finanzinstitute bemüht, gemeinsam die »Judenfrage« in Europa zu lösen. Jetzt kennen wir die Ergebnisse. Hier sind sie, in nüchternen Zahlen:
Ich schätze die Zahl der jüdischen Todesopfer auf etwas mehr als fünf Millionen. Zu diesem Ergebnis komme ich nicht, indem ich die Nachkriegsbevölkerung von der vor dem Krieg abziehe, sondern indem ich die Angaben aus den deutschen Dokumenten zusammenaddiere und auf der Basis des vorhandenen Materials nicht gemeldete Zahlen extrapoliere. In den verschiedenen Lagern wurden etwa drei Millionen Juden ermordet: in Auschwitz über eine Million, in Treblinka etwa 700000 oder 800000, in Belzec etwa 600000, in Sobibor 200000 bis 250000, in Kulmhof 150000, in Lublin (auch als Majdanek bekannt) einige zehntausend. Hinzu kommen Zehntausende Juden, die in Lagern zwischen den Flüssen Bug und Dnister von Rumänen erschossen wurden, sowie Tausende, die in Semlin und an anderen Orten in Jugoslawien getötet wurden. Es gab noch eine Reihe weiterer Lager, wo Juden schwere Verluste erlitten, aber in Statistiken über den Holocaust können Tausende, ja Zehntausende Menschenleben in Fußnoten verlorengehen.
Etwa 1400000 Juden wurden erschossen oder starben in der einen oder anderen mobilen Tötungsoperation. Sechshunderttausend kamen in Ghettos um.
Die höchsten Todesraten finden wir in Osteuropa. Das polnische Judentum, das vor dem Krieg drei Millionen Menschen umfasste, gibt es praktisch nicht mehr. Das sowjetische Judentum verlor – bezogen auf die Grenzen der Sowjetunion vor 1939 – 700000 Menschen durch Exekutionen und weitere 200000 auf dem Baltikum. In Westeuropa war die Zahl der Toten proportional gesehen geringer, wobei es in Frankreich, Belgien und Italien eine relativ hohe Überlebensrate gab.
Heute ist die Verteilung der Juden in der Welt eine vollkommen andere. Die USA hat nun die größte jüdische Gemeinde weltweit, gefolgt von den fast ebenso großen jüdischen Gemeinden in Israel und Russland. In diesen drei Ländern leben drei Viertel der verbliebenen Juden. Europa ist für das Judentum ein Friedhof, und das, obwohl die jüdische Präsenz auf diesem Kontinent bis ins Römische Reich zurückreicht, also etwa 2000 Jahre. Das eine ist die Anatomie des Holocaust. Und das ist die Statistik.
2.Die Motive der Deutschen für die Vernichtung der Juden
(1965)
In der Zeit des Nationalsozialismus verübten die Deutschen eines der ungeheuerlichsten Verbrechen der Geschichte. Sie löschten die Juden Europas aus. Im Hinblick auf Planung und Durchführung war dies ein beispielloses Geschehen. Als Hitler 1933 an die Macht kam, rüstete sich eine moderne Bürokratie zum ersten Mal in der Geschichte, ein ganzes Volk zu vernichten. Schritt für Schritt, Schlag auf Schlag wurden mehr als fünf Millionen Juden in den Tod getrieben. Wenige Operationen waren effizienter als diese bestürzende Tat inmitten eines totalen Krieges. Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen, und allmählich wächst Gras über die von Kugeln durchsiebten oder verkohlten Überreste der jüdischen Gemeinde Europas. Doch eine Frage hat uns seither nicht mehr losgelassen und ist bis heute ungeklärt. Warum hat man diese Menschen umgebracht? Welch ein Geist konnte eine solche Tat ersinnen? Diese Frage lässt uns nicht los, selbst wenn wir nur Rückschlüsse ziehen können und keine Neuentdeckungen machen werden, selbst wenn wir nur Kategorisierungen und Definitionen vornehmen und keine Antworten liefern.
Das deutsche Denken ist so zu rekonstruieren, dass der Einfluss, den es auf das Geschehen hatte, erkennbar bleibt. Um zu ergründen, welche Art von Geist zu einem solchen Verbrechen fähig war, müssen wir die Tat selbst betrachten. Erst wenn wir das Verbrechen beschrieben und eingeordnet haben, lassen sich die Motivstrukturen der Täter erkennen. Auf den folgenden Seiten werde ich die wichtigsten Ansätze zu dieser Frage vorstellen. Der Übersichtlichkeit halber werde ich sie in bestimmte Kategorien fassen, auch wenn dies eine gewisse Schematisierung bedeutet. Zunächst werde ich die bekanntesten, aber am wenigsten zutreffenden Erklärungsmodelle erläutern, um mich dann den schlüssigeren, aber auch sehr komplexen zuzuwenden.[14] Auf der Suche nach den Motiven der Deutschen hat die Forschung zwei Richtungen eingeschlagen: Die einen versuchen den Holocaust mit dem Wesen der Opfer zu erklären, die anderen mit dem der Täter. Wir wollen beide Ansätze näher betrachten.
Provokation
Jede Hypothese, die das Judentum als Erklärung in den Blick nimmt, verweist auf das Element der Provokation: Die Juden haben ihr Schicksal selbst heraufbeschworen; sie haben in gewissem Sinne ihre eigene Vernichtung herausgefordert.
Die Provokation liegt in der jüdischen Lebensweise in der Diaspora und in der immer gleichen Reaktion der Juden auf die andauernden Feindseligkeiten ihnen gegenüber. Die Juden Europas wurden fortwährend gejagt, ununterbrochen verfolgt und unaufhörlich umgebracht. Ob in Spanien, England, Frankreich oder Russland, überall waren sie ungeschützt, überall waren sie ihren Peinigern hilflos ausgeliefert. Für dieses Phänomen gibt es verschiedene Erklärungen.
In wissenschaftlichen Untersuchungen über das jüdische Verhalten hat man zwei Ansätze verfolgt: Der eine schreibt dem Judentum ein Übermaß an negativen Eigenschaften zu, der andere ein Übermaß an positiven.
Die negative Charakterisierung stützt sich im Wesentlichen auf drei Merkmale: die mangelnde Anpassungsfähigkeit der Juden, ihre Ambivalenz und ihre Marginalität. Diese drei Merkmale verdienen eine kurze Betrachtung.
Der Fortbestand des Judentums über Jahrtausende hinweg beruhte auf der Ablehnung von Regeln und Zielen, die das Leben der nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft prägten. Der jüdische Historiker Jacob Katz stellte heraus, dass die Juden zwar für das Wohlergehen ihrer christlichen Herrscher beteten, aber gleichzeitig »große Vorbehalte gegen den säkularen Staat als höchste Instanz hegten, da dieser angesichts der Messiaserwartung nur eine vorübergehende Erscheinung war«.[15] Wenn man in der Geschichte weit zurückgeht, lassen sich solche Vorbehalte tatsächlich feststellen. Betrachtet man jedoch die Verhältnisse in Deutschland zu Anfang des 20. Jahrhunderts, kann von der berühmten jüdischen Abgrenzung schwerlich die Rede sein. Zu jener Zeit hatten sich die Juden in Deutschland in einem Maße assimiliert wie kaum in einem anderen Land. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges rief Walter Rathenau die Juden auf, ihre verbliebenen »korrigiblen Seltsamkeiten«[16] zu beseitigen. Im Krieg, der dann folgte, opferten zahllose Juden für Deutschland ihr Leben.
Ambivalenz ist das zweite Merkmal, das man dem Judentum zuschrieb. Die Juden waren begierig darauf, sich zu assimilieren, ohne sich wirklich zu integrieren. Der deutsche Philosoph von Hartmann schrieb, die Juden seien am Ende des 19. Jahrhunderts sowohl »in ihrer Anpassung eklektisch« als auch in »ihrer Ablehnung skeptisch« gewesen.[17] Während seiner gesamten Geschichte sah sich das Judentum vor unannehmbare Entscheidungen gestellt. Es entzog sich Gesetzen und Bräuchen, mit denen es nicht leben konnte, und berief sich auf Regeln und Prinzipien, ohne die es nicht überleben konnte. Im Mittelalter bauten die Juden angesichts der Bedrohung ihrer Gemeinschaft durch lokale Machthaber auf den Schutz des Herrschers, wohingegen sie sich während der Verfolgungen im 20. Jahrhundert an ausländische Mächte oder internationale Organisationen um Hilfe wandten. Allerdings war nirgendwo die Angst geringer und das Vertrauen größer als im modernen Deutschland. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Juden aus kleinen Anfängen zu erfolgreichen Wettbewerbern geworden und hatten wichtige Positionen in Wirtschaft und Kultur erobert. Oft wird die Frage gestellt, wie viel Macht denn tatsächlich in jüdische Hände übergegangen war. Ein nationalsozialistischer Wissenschaftler, der sich mit dieser Frage ausgiebig beschäftigte, fasste 1944 seine Ergebnisse in einer Studie zusammen, die allerdings nicht im Buchhandel erhältlich war. Seine Erkenntnisse sind für unser Thema äußerst aufschlussreich:[18]
Die jüdische Wirtschaftsmacht hatte 1913 ihren Höhepunkt erreicht.
Die Juden waren von den wirtschaftlichen Folgen des Ersten Weltkriegs mit am stärksten betroffen. 1931 war der auf Finanzkapital beruhende wirtschaftliche Einfluss der Juden in Berlin und Wien praktisch nicht mehr vorhanden.
In der Vorkriegszeit nahm die »Judaisierung« der Wirtschaft von Westen nach Osten hin zu, das heißt, in Schlesien, Ungarn usw. war sie am stärksten ausgeprägt. Gleichzeitig nahm die Größe jüdischer Industriebetriebe von Westen nach Osten hin ab.
Diese Ergebnisse lassen interessante Schlussfolgerungen zu. Offensichtlich stimmt es also nicht, dass das jüdische Kapital Deutschland kontrollierte. Genauso wenig beruhte der sozioökonomische Aufstieg der Juden ausschließlich auf ihrem Judentum. Ihr wirtschaftlicher Erfolg verdankte sich letztlich ihrer Jahrhunderte währenden Marginalisierung. Im Grunde taten sie nur das, wozu die nichtjüdische Gesellschaft sie gezwungen hatte.[19] Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit die »Provokation« nicht eher von jenen ausging, die angeblich vom Judentum provoziert worden waren.
Nicht alle Historiker, die den Grund für den Holocaust im Verhalten der Opfer suchen, weisen den Juden abstoßende Merkmale zu. Manche sehen in einer Kombination aus jüdischen Leistungen und Vorzügen die Ursache für ihre Ausgrenzung und Verfolgung.
Tugenden können aus zweierlei Gründen provozierend wirken. Der erste ist Neid. Die Mehrheit eifert dem Vorbild der Minderheit nach, bleibt jedoch hinter ihrem Erfolg zurück. In ihrem Scheitern reagiert sie mit Ablehnung und Feindseligkeit. »Für den Antisemiten ist der Verstand eine typisch jüdische Angelegenheit«, schreibt Sartre.[20]
Ein zweiter, weniger offensichtlicher Grund ist die Abtrennung. Über Jahrhunderte hinweg haben die beiden Gemeinschaften Seite an Seite gelebt – zwei Weltbilder, zwei Denkweisen, zwei Lebensstile, manchmal täuschend ähnlich, gelegentlich eng miteinander verflochten, dann wieder heillos ineinander verstrickt, aber niemals vollkommen zusammengewachsen. Die jüdische Kultur ist die ältere, ihr Alter übt auf jüngere Nationen eine starke Anziehungskraft aus und spornt sie an, sich kulturell weiterzuentwickeln. Dies erklärt auch Oswald Spenglers Beobachtung: »Der innerlich zugehörige Mensch bejaht im letzten Grunde doch selbst dort, wo er zerstört; der innerlich fremde verneint, selbst wo er aufbauen möchte.«[21] Die Europäer haben also stets versucht, ihre Identität zu bewahren, und da ihnen dies nicht gelang, attackierten sie die Störer.[22]
Worin bestehen nun eigentlich die Tugenden des Judentums? Über dieses Thema ist viel geforscht und veröffentlicht worden, aber im Wesentlichen sind es drei herausragende Eigenschaften, die man den europäischen Juden zuschreibt.
Zuerst einmal hat man die Juden mit der Freiheit des Individuums und der Bewahrung kritischen Denkens gleichgesetzt. Die Juden lehnten diktatorische Herrschaft und Zensur ab. Max Lerner zufolge lebt der jüdische Geist »von Individualität und Skeptizismus. Er lebt von dem Recht, Jeremia zu sein, von dem Recht, ein Prophet zu sein, der die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft beklagt. Er lebt von dem Recht, niemandes Erfüllungsgehilfe zu sein …«[23] Juden sind Bilderstürmer. Sie beten keine Götzen an. Im 19. Jahrhundert brachten die großen jüdischen Freidenker Marx, Freud und Einstein das geistige Fundament der westlichen Welt ins Wanken. »Plötzlich fanden sich die Europäer auf Treibsand wieder. Einige, oder besser gesagt, die meisten von ihnen, widerstanden jedoch dem Ansturm neuer Ideen und versuchten, den festen Boden früherer Überzeugungen zurückzuerobern; unterdessen litt das jüdische Volk unter den schrecklichsten Verfolgungen in seiner langen, leidvollen Geschichte.«[24]
Doch nicht nur kritisches Denken und die Ablehnung jeder Form von Tyrannei wird als Charakteristikum des Judentums angesehen, sondern auch die klare Absage an Unmoral, Ungerechtigkeit und Ungesetzlichkeit. Die Juden sind das Volk des Gesetzes. Sie haben dem Christentum seinen Sittenkodex gegeben. Sie werden immer an das göttliche Recht gemahnen und Zeugnis von ihm ablegen. »Wissen Sie, wozu wir Juden in die Welt gekommen sind?«, schrieb Walter Rathenau. «Um jedes Menschenantlitz vor den Sinai zu rufen. Sie wollen nicht hin? Wenn ich Sie nicht rufe, wird Marx Sie rufen! Wenn Marx Sie nicht ruft, wird Spinoza Sie rufen. Wenn Spinoza Sie nicht ruft, wird Christus Sie rufen!«[25] In diesem Sinne kann man die Juden als das Gewissen der Welt bezeichnen, als Verkörperung der archetypischen Vaterfigur, streng, kritisch und furchteinflößend. So erklären sich auch die zahllosen Pogrome gegen die Juden. Der dem höchsten Gesetz verpflichtete jüdische Ordnungshüter war das Hauptangriffsziel niedrigsten christlichen Aufruhrs.[26]
Und schließlich sind die Juden auch der Mörtel, der die Gesellschaft zusammenhält. Zu gewissen Zeiten haben sie dies tatsächlich geleistet. Im Laufe ihrer langen Geschichte haben die Juden sich immer wieder gegen Ausschweifung, Sittenlosigkeit und tödliche Gewalt gewandt. Selbst heute gehören sie zu jenen, die Leben bewahren, Wohlstand erhalten, Schönes erschaffen. Sie sind Ärzte, Kaufleute und Künstler. Sie erfüllen zentrale gesellschaftliche Aufgaben. Die Juden sind Katalysatoren, die die Reaktionen eines Volkes auf bestimmte Entwicklungen beschleunigen. »Sie dienen anderen Völkern als Treibmittel – wie Hefe in einem Teig.« Aber genau diese Rolle hat auch zu ihrem Unglück beigetragen, denn »der Teig darf nur einen kleinen Teil Hefe enthalten«.[27]
Letztlich spielten jedoch die jüdischen Qualitäten im Land der Deutschen keine herausragende Rolle. Diese Nation war von den vielbeschworenen jüdischen Tugenden nicht sonderlich beeindruckt. Außerdem war die »Judaisierung« Deutschlands minimal, verglichen mit der Germanisierung der Juden.
Wenn jüdische Eigenschaften, seien es nun gute oder schlechte, destruktive Reaktionen hervorriefen, müssen noch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, die deren »provozierende« Wirkung verstärkten. Drei seien genannt:
Der erste ist die Auffälligkeit des Judentums. Das jüdische Wesen »sticht hervor«. Jüdisches Verhalten ist »bewusst«; es berührt den Lebensnerv anderer Nationen. Allerdings zeichnet sich das jüdische Volk auch durch ein hohes Maß an »Normalität« aus, aber dies wird selten wahrgenommen; Phasen unauffälliger Existenz zählen nicht. Entscheidend sind immer die Eigentümlichkeiten der Juden, ganz gleich, wie niedrig die Zahl der »Provokateure«, wie sporadisch deren Aktivitäten oder wie gering deren Einfluss ist. Die kleinste Abweichung wird registriert, die geringste Störung wird bemerkt.
Sobald die Kontakte zwischen jüdischer und christlicher Welt zunehmen, werden die jüdischen Eigenschaften sichtbarer. Die Kontakttheorie geht davon aus, dass Konflikte zwischen gesellschaftlichen Gruppen an der Peripherie entstehen. In einer latent feindseligen Umgebung ist die Minderheit vor allem dann bedroht, wenn sie ihre geographische und soziale Geschlossenheit einbüßt. Im Ghetto bleiben die Juden unter sich; sie pflegen nur wenige Kontakte zur übrigen Bevölkerung. Doch mit Beginn ihrer Emanzipation wird dieser statische Zustand aufgehoben. Die Abwanderung der Juden in die Mehrheitsgesellschaft sorgt für Unruhe und Irritation. Unweigerlich kommt es zu Spannungen und zu Ressentiments aufseiten der nichtjüdischen Mehrheit. Als die Juden ihre geschützten Ghettos verließen und nach und nach in alle wirtschaftlichen und sozialen Bereiche vordrangen, überschritten sie die Schwelle hin zur Zerstörung.[28]
Ein drittes Merkmal jüdischer Identität ist Beständigkeit. Den Juden wird nachgesagt, sie hätten sich seit dem Altertum immer gleich verhalten. Freud zufolge »benahmen sie sich schon in hellenistischen Zeiten so wie heute«.[29] Dies würde bedeuten, dass sich die Provokationen über die Jahrtausende akkumuliert hätten. Im Verlauf ihrer schmerzvollen Geschichte haben die Juden unbeirrt an ihren Sitten und Gebräuchen festgehalten. Möglicherweise wurde ihnen gerade dieser Eigensinn zum Verhängnis. Die Antwort auf ihre Beständigkeit war die brutale Vernichtung. Für die Nationalsozialisten war es die »Endlösung«, für die Juden das letzte ihrer Martyrien.
Was bedeutet dies nun für unsere Frage nach dem jüdischen Wesen? Zunächst einmal sollten wir festhalten, dass sich allein mit dem Verhalten der Juden, ganz gleich wie verzerrt es wahrgenommen wurde, die gegen sie gerichteten drastischen Maßnahmen nicht erklären lassen. Juden waren schon zuvor definiert, enteignet und konzentriert worden, aber nichts reichte an die Radikalität der deutschen Vernichtungspolitik heran. Im Zuge systematischer Erschießungen und Vergasungen büßten praktisch ganze Länder und Regionen ihre jüdischen Bewohner ein; die planmäßige Ermordung jüdischer Männer, Frauen und Kinder wurde von Russland bis Frankreich, von Norwegen bis Griechenland betrieben. Welche Art von Gefahr wollte man dort eigentlich beseitigen?
Wie die Quellen belegen, waren die Juden, kurz bevor die Katastrophe über sie hereinbrach, ebenso arg- wie machtlos. Die deutschen Nationalsozialisten waren sich der jüdischen Loyalität, Opferbereitschaft und Leistungsfähigkeit bewusst. Wie die verzweifelten Versuche der Juden, in Hitlers Europa zu überleben, zeigten, nutzten ihnen all diese Tugenden jedoch nichts. Das Judentum stellte weder eine Bedrohung für ein expandierendes Deutschland dar noch stand es den Plänen der Nationalsozialisten im Wege.
Wenn man das Ausmaß der jüdischen »Herausforderung« mit dem Ausmaß der deutschen Reaktion vergleicht, ist das Missverhältnis eklatant. Es ist eine Sache, sich provoziert zu fühlen, aber eine völlig andere, sich dazu provoziert zu fühlen, fünf Millionen Menschen umzubringen. Dieser Unterschied war selbst einem glühenden Anhänger der Provokationstheorie wie Joseph Goebbels klar, der das »Strafgericht«, das man an den Juden vollzog, als »barbarisch« bezeichnete.[30]
Es gibt noch einen weiteren Gesichtspunkt, der die Provokationsthese fragwürdig erscheinen lässt: der Umgang der Deutschen mit anderen Minderheiten. So wie die Juden auch andere Peiniger hatten, hatten die Deutschen auch andere Opfer. Zigeuner wurden gemeinsam mit Juden erschossen und vergast; es wurden Sterilisationsexperimente mit dem Ziel durchgeführt, die slawischen Völker auszurotten; man erwog, verurteilte deutsche Straftäter zu töten, deren auf den Fotos festgehaltene Gesichtszüge abstoßend erschienen. Die Provokationstheorie wäre nur dann überzeugend, wenn sie sich nicht nur auf die Juden, sondern auch auf eine Vielzahl anderer Bevölkerungsgruppen anwenden ließe, beispielsweise auf jene, die sich völlig unauffällig verhielten oder die weit entfernt von Deutschland lebten, oder auch jene, die plötzlich zu neuen »Feinden« des Deutschtums erklärt wurden. Selbst wenn wir dieses Erklärungsmodell für plausibel halten, kommen wir an einer schlichten Tatsache nicht vorbei: So verschieden die Gruppen auch waren, die in den Bannkreis nationalsozialistischen Zerstörungswillens gerieten, so hatten sie doch eine Gemeinsamkeit – ihre Schwäche. Ihr hervorstechendes Merkmal war Hilflosigkeit. Und diese Verwundbarkeit allein stellte schon eine »Provokation« dar. Daraus ergibt sich die Frage, ob das nationalsozialistische Deutschland Gründe hatte, diese Hilflosigkeit auszunutzen. Und wenn ja, welche könnten das gewesen sein?