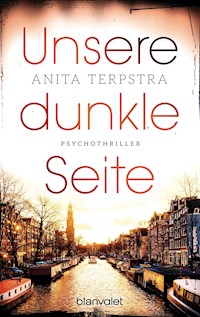8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wie gut kennen wir die, die uns am nächsten sind, wirklich?
Alma Meester, ihr Mann Linc und die beiden Kinder Iris und Sander sind eine ganz normale, glückliche Familie. Bis zu dem Tag, als der elfjährige Sander zusammen mit einem Freund während eines Ferienlagers spurlos verschwindet. Der andere Junge wird kurz darauf tot aufgefunden, doch Sander bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Sechs Jahre später meldet sich ein junger Mann bei einer deutschen Polizeistation. Er sei der verschwundene Sander Meester. Die Familie ist überglücklich, doch nach und nach kommen der Mutter Zweifel. Ist der Junge wirklich ihr Sohn? Und was ist in der Nacht damals tatsächlich passiert?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 413
Sammlungen
Ähnliche
ANITATERPSTRA
ANDERS
Thriller
Aus dem Niederländischen von Jörn Pinnow
Alma Meester, ihr Mann Linc und die beiden Kinder Iris und Sander sind eine ganz normale, glückliche Familie. Bis zu dem Tag, als der elfjährige Sander zusammen mit einem Freund während eines Ferienlagers spurlos verschwindet. Der andere Junge wird kurz darauf tot aufgefunden, doch Sander bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Sechs Jahre später meldet sich ein junger Mann bei einer deutschen Polizeistation. Er sei der verschwundene Sander Meester. Die Familie ist überglücklich, doch nach und nach kommen der Mutter Zweifel. Ist der Junge wirklich ihr Sohn? Und was ist damals in der verhängnisvollen Nacht tatsächlich passiert?
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Anders« bei Cargo, einem Imprint von De Bezige Bij, Amsterdam.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2014 by Anita Terpstra
Copyright © 2016 für die deutsche Ausgabe
by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign
Redaktion: Ulrike Nikel
LH ∙ Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-17152-0V001
www.blanvalet.de
Für Theodoor
1
Verzweifelt ließ Alma das Licht der Taschenlampe über die Bäume gleiten. Der Klumpen in ihrem Magen wuchs mit jeder Minute. Würde sie Sander hinter diesem Baum finden? Oder hinter dem nächsten? Seit Stunden spielte sie bereits dieses Spiel.
Er musste hier irgendwo sein. So groß war dieser Wald schließlich nicht. Sie waren verdammt noch mal nicht in Kanada, wo es Wälder gab so groß wie die Provinzen Groningen oder Utrecht. Hier konnte ein Kind nicht einfach so verschwinden. Ihr Kind.
Unmöglich.
In welchem Zustand sie ihn vorfinden würde, darüber wollte sie lieber nicht genauer nachdenken. Aber bitte, lieber Gott, lass es nicht so enden wie bei Maarten. Der arme Junge. Sander war klein, aber stark. Hatte keine Angst vor nichts und niemandem. Dass man ihn nicht in der Nähe seines Freundes entdeckt hatte, hielt ihre Hoffnung am Leben. Es bedeutete, dass er entkommen war. Geflohen. Jetzt musste sie ihn bloß finden. Warum er allerdings nicht zu dem Ferienhof zurückgegangen war, verstand sie nicht.
War er in blinder Panik einfach fortgerannt und hatte sich verlaufen? Inzwischen war er sicher müde. Zu Tode verängstigt. Unterkühlt. Und wartete auf sie.
Darauf, dass sie ihn in die Arme schließen würde.
Vor dem dunklen Himmel zeichnete sich der Vollmond ab. Für die Jahreszeit, Anfang Juni, waren die Nächte bitterkalt. Sie hatte kein Gefühl mehr in den Händen, und ihr klapperten die Zähne, ohne dass sie etwas dagegen unternehmen konnte. Gleichzeitig jedoch war ihr seltsamerweise schrecklich heiß. Eine tief sitzende Angst hatte sich ihr in die Eingeweide gebrannt. Das war ihr Treibstoff, so konnte sie noch Stunden weitermachen.
Sie stolperte über eine halb aus dem Boden ragende Baumwurzel und fand nur mit letzter Not ihr Gleichgewicht wieder. Genau wie der Rest des Suchtrupps rief sie alle paar Sekunden den Namen ihres Sohnes. Ihre Stimme war heiser, ihre Kehle fühlte sich rau an.
Ein heftiger Wind blies durch die Baumwipfel und ließ sie rhythmisch hin und her schwanken. In den Nachrichten hatten sie für das ganze Wochenende schlechtes Wetter vorhergesagt. Sogar Stürme.
Sie hatte Linc, ihren Mann, deshalb gefragt, ob es wirklich eine gute Idee sei, das Camp stattfinden zu lassen. Die Wochenendfahrt wurde vom örtlichen Jugendclub veranstaltet, der für Kinder zwischen elf und fünfzehn allerlei Aktivitäten bot, darunter sonntagnachmittags eine Disco und als Höhepunkt eben das alljährliche Camp im Juni.
Linc, der als einer der ehrenamtlichen Helfer die Gruppe begleitete, hatte ihr erklärt, dass es für eine Absage zu spät sei und dass es keinen Ausweichtermin gebe, weil sämtliche infrage kommenden Unterkünfte in der Gegend ausgebucht seien. Und nächste Woche war Ferienbeginn. Außerdem, meinte er, würden sie ja nicht zelten, sondern auf einem Bauernhof übernachten. Alles kein Problem also.
Alles kein Problem?
Warum war Maarten dann ermordet worden? Und warum war sie hier unterwegs, um ihr Kind zu suchen?
Ihre Schuhe waren schlammbedeckt. Weiße Turnschuhe. Das Erste, was sie zu fassen bekommen hatte, als die Polizistin vor ihrer Haustür aufgetaucht war und sie mit ernstem Gesicht gebeten hatte mitzukommen. Dabei standen in der Abstellkammer Gummistiefel griffbereit.
Aber vor ihren Augen hatte sich alles gedreht, und sie hatte sich am Türrahmen festgeklammert, um nicht von einem schwarzen Nichts verschlungen zu werden. Nur die Jogginghose hatte sie schnell gegen eine Jeans getauscht.
Eigentlich hatte sie gerade ins Bett gehen wollen. Zum ersten Mal seit Jahren hatte sie den Abend allein mit Wein und Chips vor dem Fernseher verbracht, denn außer Sander war auch Iris mit auf den Ferienhof gefahren.
Dass Linc auch dabei war, war ihr eine Beruhigung gewesen. Er würde schon aufpassen, dass den beiden nichts passierte.
Eine grundlose, irrationale Angst, das wusste Alma nur zu gut. Die Kinder waren fünfzehn und elf, und Linc erklärte ihr immer wieder, es sei an der Zeit, die beiden loszulassen, doch ihr Mutterinstinkt sagte ihr etwas ganz anderes. Sie waren noch jung, aber das würde sie nicht davon abhalten zu trinken. Und zwar zu viel. Oder zu kiffen. Etwas einzuwerfen, wenn ihre Freunde sie dazu drängten. Das wusste sie. Schließlich war sie auch einmal jung gewesen. Und als Krankenschwester hatte sie gesehen, was Menschen zustoßen konnte.
So hatte sie darauf vertraut, dass Linc ein wachsames Auge auf Iris und Sander haben würde, und sich entspannt aufs Sofa gelegt.
Wie um Himmels willen hatte so etwas geschehen können? So etwas passierte doch immer nur anderen. Anderen Familien. Nicht ihr.
Sie massierte ihre gefühllosen Hände, bis sie kribbelten, und versuchte, sich so genau wie möglich zu erinnern, was die Polizistin ihr im Auto erzählt hatte.
Nach dem Pfannkuchenessen habe neben der Nachtwanderung eine Playbackshow auf dem Programm gestanden, hieß es. Ja, das war seit Wochen Thema bei den Mädchen gewesen. Iris und ihre Freundinnen wollten mit einem Song von Rihanna auftreten. Alma konnte ihn inzwischen nicht mehr hören. Please don’t stop the, please don’t stop the, please don’t stop the music. Die Suche nach einem passenden Outfit hatte doppelt so viel Zeit in Anspruch genommen wie das Üben der Tanzschritte und das Auswendiglernen des Textes. Iris hatte sich für ein Kleid entschieden, das der Vorstellungskraft nur wenig Raum ließ. Almas Proteste wurden vom Tisch gewischt. Sie sei altmodisch, konterte die Tochter, Sängerinnen liefen heutzutage nun mal so herum. Hatte sie sich überhaupt je einen Videoclip angeschaut?
Bei Sander dagegen sah die Sache anders aus. Alma hatte nicht die blasseste Ahnung, was er vortragen würde. Und ob allein oder mit jemand anders. Er äußerte sich einfach nicht dazu. Jedes Mal, wenn sie ihn darauf angesprochen hatte, brummte er bloß unverständliches Zeug vor sich hin. Mach dir keine Gedanken, sollte das wohl in Jungssprache heißen.
Der Wind wehte ihr das schulterlange braune Haar ins Gesicht. Sie wünschte, sie hätte ein Haargummi dabei. Wie konnte man nur eine Nachtwanderung abhalten, wenn ein Sturm im Anzug war? Man hatte die Kinder, die mitwollten, in Vierergruppen eingeteilt. Es gab vier davon, mit jeweils zwei Jüngeren und zwei Älteren. Die Betreuer hatten sie in den Wald gefahren und abgesetzt. Jetzt sollten sie auf eigene Faust den Weg zurückfinden. Ohne irgendeine Hilfestellung.
Sander und sein bester Freund Maarten waren Iris und ihrem Freund Christiaan zugeteilt worden, doch irgendwie hatten die beiden die Jungs aus den Augen verloren und sie trotz intensiver Suche nicht gefunden. Daraufhin rief Iris irgendwann ihren Vater an und erzählte ihm, sie hätten sich verlaufen, was Linc zunächst falsch verstand. Er ging davon aus, dass alle vier nach wie vor zusammen seien. Erst als er die beiden Jugendlichen völlig aufgelöst antraf, erkannte er seinen Irrtum und begriff, dass Sander und Maarten verschwunden waren. Er schickte Iris und Christiaan zum Hof zurück, damit sie die anderen alarmierten, und machte sich auf die Suche nach den beiden Jungs.
Dann hatte er Maarten aufgefunden. Tot.
Sander war nirgendwo zu entdecken.
2
Der Wind wurde stärker. Gras und Moos knirschten unter Almas Schuhen, die Blätter raschelten, und der Wind heulte. Die Geräusche des Waldes schienen ohrenbetäubend, und sie konnte kaum einen klaren Gedanken fassen.
Unzählige Male waren sie sonntags hier spazieren gegangen, vor allem als die Kinder noch kleiner waren. Der Wald lag kaum zwei Kilometer von ihrem Haus entfernt. Die beiden machten sich einen Sport daraus, vorauszurennen und sich zu verstecken. Vor allem Sander war sehr gut darin, sich mucksmäuschenstill zu verhalten. Sobald Alma die Kinder nicht mehr sehen konnte, geriet sie in Panik.
Sogar im Supermarkt passierte ihr das.
Aber das hier war mit nichts zu vergleichen, war um das Tausendfache schlimmer. Ihr Herz raste wie wild, ihr Magen fühlte sich wie ein Stein an, und das Zähneklappern wollte einfach nicht aufhören.
Von einer Lehrerin hatte sie erfahren, man habe Maarten mit bis zu den Knöcheln heruntergezogener Hose und Unterhose aufgefunden, aber sicher wusste Alma das nicht. Keiner der Polizeibeamten wollte sich näher äußern. Bei Almas Ankunft befanden sich alle in einem leicht hysterischen Zustand. Nicht nur die Kinder, auch die Lehrer und die ehrenamtlichen Helfer.
Die Erwachsenen. Dabei sollten die doch den Überblick behalten und Ruhe bewahren, oder?
Die Kinder und Jugendlichen hatten bleich und still in dem großen kahlen Gemeinschaftsraum gesessen, in dem sich früher der Stall befunden hatte. Manche trugen noch ihre Playback-Kostüme, andere waren im Schlafanzug. Ein paar weinten und wurden von ihren Freunden getröstet.
Alma hatte noch nicht einmal den Fuß über die Schwelle gesetzt, da war eine Lehrerin mit rotem verweintem Gesicht auf sie zugekommen. »Wir beten alle für Sander«, sagte sie, während Alma mit den Blicken den Raum nach Iris absuchte.
Die saß neben Christiaan auf einem verschlissenen, durchgesessenen Sofa. Ihre Augen wirkten in dem blassen Gesicht groß und dunkel, und das Muttermal, das einen Großteil ihrer rechten Wange bedeckte, stach dadurch noch deutlicher hervor. Die beiden hielten sich so fest an den Händen, dass ihre Knöchel weiß hervortraten, und schauten einander voller Verzweiflung an. Als Alma vor ihnen in die Hocke ging, wagte Iris kaum, ihre Mutter direkt anzusehen. Diese widerstand dem Drang, ihre Tochter tröstend in den Arm zu nehmen.
»Wir finden ihn«, sagte sie. »Mach dir keine Sorgen.«
»Es tut mir leid, Mama. Wir konnten nichts machen, auf einmal waren sie weg und …«
»Wie konnte das denn passieren?«
Sie merkte selbst, dass ihre Stimme irgendwie vorwurfsvoll klang. Dabei gab sie den beiden wirklich keine Schuld. Warum aber war kein Erwachsener bei den Gruppen im Wald geblieben, fragte sie sich. Welcher Idiot hatte es für eine gute Idee gehalten, zwei Fünfzehnjährigen die Verantwortung für zwei jüngere Kinder zu übertragen?
Iris starrte auf ihre Hände. »Ich weiß es nicht.«
Kurz nach Alma waren weitere Eltern eingetroffen. Sie wusste nicht, wer sie informiert hatte: die Polizei, die Organisatoren des Ferienlagers oder die Kinder selbst. Jedenfalls war ihnen die Sorge um die Sicherheit ihrer Söhne und Töchter anzumerken. An ihren Blicken konnte Alma erkennen, dass sie Bescheid wussten. Aber sie drängte die Tränen mit aller Gewalt zurück. Zum Weinen gab es schließlich gar keinen Grund. Sander konnte jeden Moment gefunden werden.
Einige Eltern reagierten aufgebracht, als sie erfuhren, dass sie ihre Kinder nicht sofort mit nach Hause nehmen durften. Alma konnte es ihnen nicht verübeln, denn an ihrer Stelle hätte sie dasselbe tun wollen. Nur weg von diesem Ort, an dem so Entsetzliches geschehen war. In die Wärme und Sicherheit des eigenen Zuhauses, wo man sie zumindest vor dem Bösen schützen konnte.
Aber erst mussten die Kinder befragt werden.
Sie fing ein paar Gesprächsfetzen auf: zwischen Kindern und Polizisten, zwischen Kindern und Eltern sowie zwischen den Kindern untereinander.
Hatten sie etwas Ungewöhnliches gesehen?
War seit ihrer Ankunft jemand in der Gegend gewesen, den sie nicht kannten?
Mehrere Kinder erklärten, sie hätten zwar niemanden gesehen, wohl aber jemanden gehört. Eine Person, die ihnen gefolgt sei. Die sich versteckt und sie beobachtet habe.
Ein Mädchen behauptete, einen Mann gesehen zu haben. Von hinten. Nein, keinen von den Betreuern, da war sie sich ganz sicher. Einen Fremden.
Auf der einen Seite wollte Alma alles hören, was geredet wurde, auf der anderen Seite ihre Ohren davor verschließen. Je mehr Einzelheiten sie erfuhr, desto größer wurde der Druck auf ihrer Brust. Am liebsten hätte sie laut aufgeschrien.
Der Täter sei geflohen, verkündete die Polizei. Möglich, dass er Sander mitgenommen habe. Die Nachricht traf sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel, und beinahe wäre sie zusammengebrochen. Es hielt sie keine Minute länger in diesem Raum.
Sie war nach draußen gelaufen, Iris kam ihr nach. Entsetzt und wie betäubt hatten beide dem Treiben zugesehen. So viele Autos. So viele Menschen, die laut durcheinanderriefen. Die plötzliche Helligkeit. Wie Tageslicht, aber als Alma den Blick nach oben richtete, sah sie den pechschwarzen Himmel über sich.
Niemand achtete auf sie.
Alma kam es vor, als befänden sie und Iris sich im Auge eines Orkans, und alles um sie herum würde sich drehen. Ohne Richtung, ohne Ziel. Alle rannten nur herum, um überhaupt etwas zu tun. Als bekämen sie das Chaos so in den Griff. Aber auch sie waren der zerstörerischen Kraft ausgeliefert, die Leben ohne Vorwarnung von einer Minute zur anderen zugrunde richtete. Solche Überlegungen schossen ihr durch den Kopf. Alles war besser, als an Sander zu denken. Daran, dass er allein war und Angst hatte. Dass er auf sie wartete.
Aus den Augenwinkeln heraus sah sie Lex, Maartens Vater. Genau wie Linc war er als Betreuer mit ins Camp gefahren. Jetzt wurde er von zwei Polizisten zu einem Auto geführt, das mit laufendem Motor wartete. Er war leichenblass. Einen kurzen Moment lang trafen sich ihre Blicke. Eigentlich hätte sie zu ihm gehen, ein paar Worte sagen, ihn vielleicht umarmen und trösten müssen, sofern das überhaupt möglich war. Doch sie fühlte sich wie gelähmt.
Alma schlug als Erste die Augen nieder – sie konnte den Schmerz in seinen nicht ertragen.
»Was machen wir jetzt?«, wollte Iris wissen.
»Ich gehe ihn suchen.«
»Nein, bleib hier.«
Iris klammerte sich an sie. So etwas tat sie sonst nie.
Alma kannte niemanden, der so unabhängig war wie ihre Tochter, und fragte sich immer wieder, ob Iris ohne das Muttermal anders geworden wäre. Sie würde nie vergessen, wie schockiert ihr Gynäkologe und die Krankenschwestern in den ersten Sekunden nach Iris’ Geburt ausgesehen und welch bedauernde Blicke sie gewechselt hatten. War das Kind tot, war Almas erster Gedanke gewesen. Oder behindert und missgebildet? Später hatte sie, das Neugeborene fest im Arm, den Kinderarzt gefragt, ob das Mal weggehen würde. Das wisse man nicht so genau, wahrscheinlich eher nicht, lautete die Antwort.
Jedenfalls schien Iris von Anfang an zu spüren, dass es ratsam war, sich gegen die Außenwelt zu wappnen und hart gegen sich selbst zu sein. Sie weinte nie, ließ sich nie trösten und wurde schnell selbstständig. Während andere Kinder, wenn sie auf dem Spielplatz hinfielen, heulend zu ihrer Mutter rannten, wartete man darauf bei Iris vergeblich. Sie fraß alles in sich hinein und bemühte sich, ihre Probleme allein zu lösen. Alma erinnerte sich noch lebhaft an den ersten Tag im Kindergarten. Ein Junge hatte lachend auf ihr Gesicht gezeigt und sie als hässlich bezeichnet – sie versetzte ihm sofort einen heftigen Stoß.
Alma hatte einem vorbeilaufenden Polizeibeamten mitgeteilt, sie wolle sich an der Suche beteiligen. Als er ihr erklärte, da müsse er erst seinen Vorgesetzten fragen, war sie explodiert. Wollte man ihr etwa verbieten, nach ihrem eigenen Kind zu suchen?
Iris ließ sie in der Obhut einer Lehrerin zurück. Das Mädchen weinte hysterisch und schrie, die Mutter solle nicht weggehen, sie nicht alleinlassen. Obwohl es Alma schmerzte, hatte sie keine Wahl. Ihr Sohn brauchte sie in diesem Moment dringender als ihre Tochter.
Ein tief hängender Ast schlug ihr ins Gesicht und riss sie aus ihren Gedanken.
Sie schaute sich nach den anderen um. Polizisten, Soldaten und Freiwillige, die man aus ihren warmen Betten geklingelt hatte, durchkämmten Seite an Seite die Gegend. Die Hunde liefen vorweg. Alma verstand nicht, warum die Tiere ihren Jungen nicht längst gefunden hatten. Schließlich waren sie dafür ausgebildet worden, vermisste Personen ausfindig zu machen, sobald sie entsprechend Witterung aufgenommen hatten. Warum also klappte das bei Sander nicht?
Er konnte ja nicht vom Erdboden verschwunden sein.
Sie beschloss, den Mann, der den Suchtrupp anführte, danach zu fragen, konnte ihn aber nicht einholen. Mit Linc hatte sie bislang nicht gesprochen. Er beteiligte sich natürlich ebenfalls an der Suche. Es gab so viele unbeantwortete Fragen. Aber zuerst mussten sie Sander finden. Alles andere war unwichtig.
Mit viel Lärm flog ein Hubschrauber über ihre Köpfe hinweg. Das grelle Licht der Suchscheinwerfer machte Alma für ein paar Sekunden blind, und sie kniff die Augen zusammen. Sander würde sich vielleicht vor dem Licht fürchten, kam ihr unwillkürlich in den Sinn. Er würde sich wegducken, sich verstecken.
Das sollte sie einem Polizisten erklären, überlegte sie und lief etwas schneller. Sie holte ein paar Leute ein, sah jedoch nirgends jemanden in Uniform – auch nicht, als sie die Taschenlampe, die ihr irgendjemand in die Hand gedrückt hatte, auf die Rücken der Gruppe vor sich richtete.
Sie wünschte sich, im Helikopter zu sitzen. Oder sich wie ein Adler über die hohen Bäume erheben und den Wald überblicken zu können. Um dann im Sturzflug herabzuschießen, ihren Jungen zu packen und ihn heim ins sichere Nest zu bringen.
Verzweifelt blieb sie stehen.
Sie hatte keine Vorstellung, wie viele Menschen es waren, die den Wald auf der Suche nach Sander durchkämmten. Dutzende, und dennoch fühlte sie sich entsetzlich allein. Sie merkte, dass sie kaum Luft bekam, und bemühte sich, ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen. Jetzt bloß keine Panik, rief sie sich zur Ordnung. Du findest ihn.
Du musst ihn einfach finden.
Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass das hier nichts als ein Albtraum war, aus dem sie bald erwachen würde. So musste es sein. Schließlich kam ihr alles hier so unwirklich vor, so fern. Als hätte das Ganze nichts mit ihr zu tun, sondern mit jemand anders. Als schaute sie sich selbst von Weitem zu und könnte alles mitfühlen.
Mit einem Mal erregte rechts von ihr etwas ihre Aufmerksamkeit. Sie hätte nicht einmal sagen können, ob es eine Bewegung oder ein Geräusch war.
Langsam ließ sie den Lichtkegel der Taschenlampe über die Bäume und Büsche gleiten, deren Umrisse bizarr und furchteinflößend wirkten. Statt den anderen weiter geradeaus zu folgen, bog sie ab. Nach ein paar Schritten hielt sie inne, lauschte wieder. Dann sah sie es.
Zwischen den Bäumen stand ein Mann.
3
Alma schrie. Es fühlte sich an wie in ihren Albträumen, wenn niemand sie hörte und kein Laut aus ihrer Kehle drang. Diesmal war das anders, denn von allen Seiten eilten Menschen auf sie zu.
Sie wies in die Richtung, wo sie die Gestalt gesehen hatte, doch der Mann war weg. Geflohen, vor ihr davongelaufen. Einige Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Laute, erregte Stimmen hallten durch den Wald. Die Hunde, dachte sie, die sind viel schneller. Lasst die Hunde los.
Auch Alma begann zu rennen, gab aber auf, als sie die Beamten aus den Augen verlor. Verzweifelt blickte sie sich um. Keuchend und mit schlimmem Seitenstechen lehnte sie sich an einen Baum. Sie war kurz davor, sich zu übergeben, schluckte schwer.
Erschöpft legte sie ihre Stirn an den kühlen Stamm.
Sie hätte Sander nicht erlauben dürfen, auf den Ferienhof mitzufahren.
Dieser Gedanke ließ sie nicht mehr los. Warum war sie nicht ihrer Intuition, ihrem Gefühl, ihrer Eingebung gefolgt? Er hatte nicht die geringste Lust verspürt, noch mehr Zeit mit seinen Klassenkameraden zu verbringen. Er hatte es in der Schule nicht leicht, weil er der Kleinste und zudem schon immer ein bisschen pummelig war.
Alma selbst fand das nicht weiter schlimm, aber sogar der Schularzt hatte sie einmal darauf angesprochen. Und sein Klassenlehrer hatte bei einem Elternabend gemeint, Sander müsse seinen Platz noch finden.
Eine dumme Bemerkung, dachte Alma.
Immerhin war ihr Sohn seit dem Kindergarten mit ein und denselben Kindern zusammen. Ob er etwa gemobbt werde, hatte sie gefragt. Das war ihr herausgerutscht und eher als Scherz gemeint gewesen, aber der Lehrer hatte sie befremdet angesehen.
Alma hätte ihm gern erklärt, dass sie eher bei Iris Ausgrenzungen wegen des Muttermals befürchtete. Eine merkwürdige Laune des Schicksals, dass es nun nicht Iris treffen sollte, sondern Sander.
Ihr Sohn war es, der sich zurückzog, sich am liebsten allein beschäftigte und keine Freunde zu brauchen schien.
Sander war am liebsten draußen. Er fuhr allein mit seinem Fahrrad herum und erkundete die Gegend.
Nach der Schule nahm er sich gerade noch die Zeit, ein Glas Limonade hinunterzukippen und ein Stück Kuchen in sich hineinzustopfen, dann lockte das Abenteuer. Über die Felder und in die Wälder. Erst zum Abendessen tauchte er wieder auf, verdreckt und häufig voller blauer Flecken, Beulen und Schrammen.
Wenn Alma wissen wollte, was er getrieben habe, gab er nur vage Antworten. Jungszeug eben.
Fußball hasste er auch. Trainingsstunden und Turniere fand er schrecklich, und nach dem soundsovielten Streit hatten sie ihn schließlich abgemeldet. Für Linc gleichermaßen eine schwere Entscheidung wie eine herbe Enttäuschung. Zu gerne hätte er wie die anderen Väter jeden Mittwochnachmittag und Samstag an der Außenlinie gestanden und sich mit den Leistungen seines Sohnes gebrüstet.
Alma wiederum fand Lincs Verhalten manchmal inakzeptabel. Kinder suchten sich ihren Charakter und ihre Neigungen schließlich nicht aus. Ihre Eltern dagegen konnten sich darauf einstellen. Das hatte sie ihrem Mann wieder und wieder vorgehalten, wenn er und Sander miteinander stritten. Zum Glück schien er es seit Kurzem begriffen zu haben, denn er gab sich mehr Mühe und nahm sich viel Zeit für Sander.
Iris war ihrem Vater viel ähnlicher. Sie hatte eine Clique netter Mädchen um sich geschart, mit der sie viel unternahm. Seit ein paar Monaten war sie mit Christiaan zusammen, dem Sohn eines Bauern, und steckte mehr bei ihm als zu Hause.
Inzwischen hatte es angefangen zu nieseln. Alma starrte ins Dunkel und wartete angespannt, dass etwas, irgendetwas passierte. Dabei wanderten ihre Gedanken zurück zu dem Tag, als Sander geboren wurde. Eine Krankenschwester, die das Neugeborene in ihren Armen wiegte, hatte bemerkt, sie werde mit diesem Würmchen noch einiges mitmachen.
Alma empfand das damals als kränkend – der Kleine war schließlich erst wenige Stunden alt.
Doch wie sich jetzt herausstellte, schien die Frau recht behalten zu haben.
Die zweite Entbindung sei immer leichter als die erste, jeder hatte ihr das gesagt. Bloß dass Sander nicht mitspielte. Es war, als hätte er nicht auf die Welt kommen wollen. Als hätte er geahnt, dass dort Unangenehmes auf ihn wartete. Oder war es anders gewesen? Hatte sie ihn nicht loslassen wollen?
Sie hätte schrecklich gerne mehr Kinder, eine große Familie gehabt, aber für Linc war das zweite Kind eigentlich schon eins zu viel gewesen. Sie hatte es ihm regelrecht abtrotzen müssen, sogar mit Trennung gedroht.
So kam Sander zur Welt.
Umso verblüffter war sie über die postnatale Depression nach der Geburt dieses Wunschkinds gewesen, gab lange Zeit nicht zu, dass etwas nicht stimmte. In den ersten Tagen war alles eitel Freude und Sonnenschein gewesen. Alma schwebte auf einer rosa Wolke, bis ihre Gefühle für Sander plötzlich umschlugen. Was so weit ging, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte.
Monatelang, und das Gefühl wurde immer stärker.
Der Tiefpunkt war an jenem Tag erreicht, als sie sich beim Baden des Babys ausmalte, es zu ertränken. All ihre Probleme wären mit einem Schlag verschwunden, überlegte sie, und sie könnte endlich wieder sie selbst sein. Ein Teil von ihr, ihr altes Ich, hatte jedoch gewusst, wie krank diese Gedanken waren, und weinend gestand sie endlich Linc, was in ihr vorging. Ihr Mann war zutiefst erschrocken, denn er wurde von seiner Arbeit in der Bank stark in Anspruch genommen und kümmerte sich wenig darum, was zu Hause ablief. Danach dauerte es noch rund ein halbes Jahr, bis sie ihre Probleme überwand und so etwas wie Liebe für Sander empfinden konnte. Nach wie vor allerdings machte sie sich bisweilen Vorwürfe wegen der Versäumnisse der ersten Monate und empfand ihrem Sohn gegenüber ein Schuldgefühl.
Seitdem hatte sie immer alles richtig gemacht.
Immer.
Alles.
Warum also geschah das hier überhaupt?
Ein Schluchzen drang aus ihrer Kehle. Schnell hielt sie sich die freie Hand vor den Mund, um das nächste zu unterdrücken. Sie durfte auf keinen Fall die Kontrolle über sich verlieren. Vor allem wollte sie nicht als hysterische, verheulte Mutter vor ihrem Sohn stehen, der doch bestimmt bald gefunden würde.
Der Wind blies ihr den Nieselregen ins Gesicht. Ihre Wangen waren eiskalt. Erneut ließ sie das Licht der Taschenlampe über die Bäume huschen. Nichts. Was sollte sie tun: hinter den Polizisten herlaufen, die den Mann verfolgten, oder zu dem Rest des Suchtrupps zurückgehen? Sie entschied sich für Letzteres. Die Gruppe machte gerade eine Pause. Alma wandte sich an einen Polizisten, der ihr jedoch zu ihrer großen Enttäuschung keine Auskunft geben konnte, weil kein Kontakt zu der Verfolgergruppe bestand und man nicht wusste, ob der Flüchtige inzwischen gefasst werden konnte.
Alma warf einen Blick auf die Uhr. Halb drei. Nicht mehr lange, dann würde die Morgendämmerung anbrechen. In ihrem Kopf herrschte ein Chaos aus besorgten Gedanken, sodass sie kaum nachrechnen konnte. Um halb zehn, als es dunkel wurde, waren die Kinder und Jugendlichen zu dem nächtlichen Abenteuer aufgebrochen, und bereits eine halbe Stunde später hätten sie zurück auf dem Ferienhof sein sollen. Um halb eins wurde Maarten gefunden. Also war Sander jetzt zwischen zwei und fünf Stunden verschwunden.
Wie viele Kilometer schaffte man wohl pro Stunde? Moment, Sander war noch ein Kind. Und das ansteigende Gelände mit den vielen herumliegenden Ästen und aus dem Boden ragenden Wurzeln unwegsam … Es wollte Alma einfach nicht gelingen, eine sinnvolle Berechnung anzustellen. Sie hatte ja nicht einmal die geringste Ahnung, in welche Richtung er gelaufen war. Die Hunde hatten keine Spur aufnehmen können, und man hatte sich einfach so auf die Suche gemacht.
In der Kälte begann ihre Nase zu laufen, und Alma wischte sie am Jackenärmel ab. Ihr Mund war wie ausgedörrt. Ob Sander auch Durst hatte? Und Hunger? Zu Hause aß er ständig.
Alma sog den strengen Geruch ein, der in der Luft hing. Eine Mischung aus Kälte, matschigem Waldboden und verrottenden Pflanzen. Sie stellte sich vor, Sander riechen zu können, falls er in der Nähe wäre.
Nach seiner Geburt hatte sie von dem süßlichen Babyduft gar nicht genug bekommen. Hatte sich gewünscht, ihn in einem Döschen einfangen und aufbewahren zu können. Und später empfand sie es stets als eine Beruhigung, wenn sie nach Hause kam und sein Geruch im Haus hing. Wenn Kinder in die Pubertät kamen, rochen sie anders. Selbst bei Iris war es so gewesen, und bei Sander würde es auch so kommen. Schweißsocken und allzu flüchtiges Waschen sorgten dafür, wie sie von Marjo wusste, Maartens Mutter, die noch einen älteren Sohn hatte.
Marjo. Arme, arme Marjo.
Zitternd holte sie Luft. »Sander«, rief sie mit heiserer Stimme. »Wo bist du? Komm zu mir zurück. Bei mir bist du sicher.«
Hoffentlich hatte man wenigstens alle Zufahrtstraßen gesperrt, durchsuchte alle Autos, dachte sie. Doch das schien ihr kaum zu bewältigen.
In ihrer Jackentasche klingelte das Handy.
Ihre Finger waren in der Kälte ganz steif geworden, und beinahe hätte sie es nicht geschafft, den Anruf entgegenzunehmen. Linc stand auf dem Display. Ihr Herz schlug mehrere Takte schneller.
Am anderen Ende hörte sie die Stimme ihres Mannes, und die Art und Weise, wie er ihren Namen aussprach, zog ihr den Boden unter den Füßen weg. Sie glaubte, seine Stimme in den siebzehn Jahren, die sie inzwischen zusammen waren, mit all ihren Nuancen zu kennen. Doch so hatte er ihren Namen noch nie ausgesprochen.
»Wir haben eine Jacke gefunden, Alma. Seine Jacke. Und es klebt Blut daran. Ich …«
Ungläubig schüttelte sie den Kopf, und das Telefon fiel ihr aus den kraftlosen Fingern.
4
Sechs Jahre später
Er betrachtete die Grube, und der Mut verließ ihn. Sie war bei Weitem noch nicht groß und tief genug, um die Leiche aufnehmen zu können. Die Arbeit gestaltete sich schwieriger als erwartet. Die ersten Zentimeter waren einfach gewesen, doch dann kam harte Erde zum Vorschein, bei der es ihn viel Kraft kostete, den Spaten tief hineinzustechen. So langsam befürchtete er schon, nicht fertig zu werden, bevor die Sonne aufging.
Die Flamme der Öllampe, die er an einen Ast gehängt hatte, warf bizarre Schatten, aber nicht mehr lange, und sie würde verlöschen. Und die Batterien der Taschenlampe wollte er nach Möglichkeit für später schonen. Für den langen Marsch, der ihm noch bevorstand.
Die Augen im Dunkeln ließen ihn in Ruhe.
Trotz der Kälte schwitzte er stark. Seine Jacke hatte er bereits ausgezogen. Sobald das hier erledigt war und er sich auf den Weg machen konnte, sollte er trockene Kleidung anziehen. Sonst sank seine Körpertemperatur womöglich zu schnell und zu stark ab. Eine Unterkühlung konnte er nicht brauchen.
Er hielt kurz inne und trank einen Schluck Wasser, vermied es dabei sorgsam, den Leichnam anzuschauen. Längst hatte er es sich abgewöhnt, sich Gedanken über das Leben dieses Mannes zu machen. Oder über das derjenigen, die er zerstört hatte. Über sein eigenes. Irgendwie hatte dieser Dreckskerl einen gnädigen Tod gehabt, obwohl er vielleicht bereits in der Hölle schmorte. Das einzig Gute an seinem Tod war, dass dadurch hoffentlich anderen Jungen ein Haufen Elend erspart blieb. Typen wie er hörten nämlich niemals auf, ganz egal was sie sagten, was sie sogar schworen.
Der tote Mann hatte nie viel über sich erzählt. Er wusste nur, dass er Eelco hieß, über fünfzig und früher einmal verheiratet gewesen war. Wahrscheinlich war Eelco damals noch normal gewesen. Mit einem ganz gewöhnlichen Beruf und einem ganz gewöhnlichen Haus. Er wusste nicht genau, was Eelco gearbeitet hatte. Vermutlich etwas, wofür man geschickte Hände brauchte. Und die hatte Eelco gehabt. Kinder hatte Eelco keine, soviel er wusste. Aber vielleicht hatte er die auch im Stich gelassen, als er dann den Entschluss fasste, sich aus der menschlichen Gemeinschaft zurückzuziehen. Warum Eelco wie ein Einsiedler im Wald lebte, wusste er nicht. War Eelco der Boden unter den Füßen zu heiß geworden? Er hatte nie gewagt, danach zu fragen, und der andere hatte es ihm nie erklärt.
Das Schlimme war, dass er hier im Wald ohne Eelco nie überlebt hätte. Wichtige Lektionen waren das gewesen. Und er lernte schnell, auch wenn Eelco verächtlich geschnaubt hatte, als er sich beim Häuten seines ersten Hasen übergeben musste. Aber bereits nach etwa einer Woche gingen ihm solche Dinge relativ leicht von der Hand. Fast so gut wie Eelco – so empfand er es zumindest selbst.
Eelco hatte ihm außerdem beigebracht, wie man Wasser aus dem Fluss trinkbar machte, welche Pflanzen essbar waren, welche nicht und welche sich medizinisch nutzen ließen. Wie man Fallen baute und legte, wie man die Spuren von Tieren finden und erkennen konnte und wie man richtig Feuer anzündete.
Erstaunlich rasch hatte er sich diesem Leben angepasst. Nur an die ausgedehnten Wälder konnte er sich nicht gewöhnen. Vor allem wenn es stürmte, wünschte er sich weit weg. Manchmal fiel ein Baum völlig unerwartet um, als hätte er genug von dem Wind, der seit Jahrzehnten an ihm rüttelte, und einfach beschlossen, den Widerstand aufzugeben. Auch schlugen von Zeit zu Zeit Blitze ein, doch das störte ihn weniger als die Tatsache, dass kaum Sonnenlicht durch das Blätterdach drang.
Am meisten allerdings hasste er die Nächte im Wald, wenn stärker als tagsüber die Geräusche in den Vordergrund traten. Unüberhörbar. Das Rascheln der Blätter, die Geräusche der wilden Tiere, das ständige Trommeln des Regens auf dem Dach der Hütte. Manchmal, wenn es durchregnete, hatte ihn Eelco mitten in der Nacht geweckt, damit er hinaufstieg und es reparierte. Anschließend war er dann klitschnass und bis auf die Knochen durchgefroren wieder unter die Decke gekrochen.
Auch wenn er sich an das Essen gewöhnt hatte, bekam er regelmäßig Bauchschmerzen davon. Es war nicht gerade angenehm, sich mit heruntergezogener Hose über ein Loch im Boden zu hocken und statt Klopapier Blätter zu benutzen.
Was Eelco an dieser Lebensweise so anziehend fand, hatte er nie verstanden, obwohl der Mann es ihm immer wieder zu erklären versucht hatte. Er finde diese Reduzierung auf das Wesentliche ursprünglich, naturgemäß, sagte er. Betrachte sie gewissermaßen als Rückkehr zu den Wurzeln. Und noch mehr Geschwurbel dieser Art. Abendelang, hin und wieder sogar bis tief in die Nacht hatte er Eelcos selbst erdachter Philosophie lauschen müssen. Die Welt außerhalb des Waldes sei oberflächlich und genusssüchtig. Voll mit Menschen, die einander bloß das Allerschlechteste wünschten und sich dabei anlächelten. Denen es nie um den Nächsten, sondern lediglich ums Geld gehe. Die sich gegenseitig aufschaukelten mit Fragen nach dem Status: wer das größte Auto, das tollste Haus besitze und wer die teuersten Urlaubsreisen mache. Ihre Habgier habe sie verdorben, klagte Eelco. Heutzutage sei das Geld der Apfel, der zur Vertreibung der Menschen aus dem Paradies führe. Es vergifte die Seele des Menschen durch Missgunst und lasse sie schrumpfen. Bis auf Kirschkerngröße, wetterte Eeolco. Dass diese Entwicklung noch aufzuhalten sei, daran glaubte er nicht. Weil niemand die Wahrheit hören wolle, weil die Menschheit blind auf ihren eigenen Untergang zusteuere.
Zum Glück allerdings, da war er sich sicher, seien ein paar Menschen rechtzeitig aufgewacht und hätten das Joch des Kapitalismus abgeschüttelt. Nein, nein, er sei kein Kommunist, pflegte er sogleich zu beteuern – zu viele Regeln und Vorschriften, darauf habe er keine Lust. Eher sehe er sich und die wenigen anderen, die so lebten und dächten wie er, als eine verkannte Minderheit. Niemand höre auf sie. Vielfach stemple man sie gar als Irre ab. Manche hielten das nicht aus und flüchteten sich in Alkohol und Drogen. Er nicht, betonte er gerne. Nein, nein, er brauche das nicht, weil er begriffen habe, dass die Natur die Seele reinigen könne. Deshalb habe er sich hier sein eigenes Paradies erschaffen. Tiere könnten einen nicht verraten, Felsen einen niemals beschuldigen und Bäume nicht hinter dem Rücken über einen herziehen. Das Einzige, worüber man sich Sorgen machen müsse, sei die Frage, ob man jeden Tag genug zu essen bekommen würde. Und wenn nicht – nun, er habe gelernt, dass man von einem Tag Hunger nicht gleich starb. Er jedenfalls fühle sich so gesund und fit wie nie zuvor. Das Geschwätz eines Idioten.
Die Hütte hatte Eelco eigenhändig errichtet, wie er immer wieder stolz betonte. Dass er dafür Materialien aus der Zivilisation verwendet hatte, erwähnte er nicht. Auch nicht, dass er Töpfe, Tassen, Teller, Messer, Löffel und Gabeln besaß oder Kleidung und Decken. So unabhängig, wie er dachte oder es gerne darstellte, war er nicht. In regelmäßigen Abständen verließ er in aller Frühe die Hütte und kehrte am Ende des Tages mit vollen Taschen zurück. Streichhölzer, Tabak, Draht, Schrauben, Munition.
Er nahm das schweigend zur Kenntnis. Er sagte auch nicht, dass Eelco gar keine unschuldige Seele haben konnte, weil er nicht in der Lage war, die Finger von kleinen Jungs zu lassen. Ein einziges Mal hatte er es gewagt, den Mund aufzumachen – es war ihn teuer zu stehen gekommen. Bis heute erinnerte die Narbe auf seiner Wange ihn daran, wie die Flasche an der Wand hinter ihm zersprang und ein Splitter sich in sein Gesicht bohrte. Ein paar Zentimeter höher, und es hätte sein Auge getroffen. Irgendwann gab er es auf, diesen Mann verstehen zu wollen. Der Typ war verrückt. Punkt.
Eelco brannte selbst Schnaps und wurde immer fröhlich, wenn er davon trank. Ein einziges Mal hatte er davon probiert und es am nächsten Tag bitter bereut. Niemals zuvor war ihm so übel gewesen. Als säße sein Kopf nicht mehr auf dem Rumpf und als würden seine Eingeweide unbefestigt im Körper herumfliegen. Einmal und nie wieder, hatte er sich damals geschworen.
Daraufhin war er als Schwächling ausgelacht und verspottet worden. So werde er nie ein echter Mann, hatte Eelco gehöhnt.
Das machte ihm nichts aus. Er wusste, dass er nicht hierhergehörte. Es würde nicht ewig dauern. Daran hielt er sich fest, und nur so konnte er alles aushalten. Zwar dachte er des Öfteren daran aufzugeben, aber er wusste, dass es der falsche Weg wäre.
Schließlich verfolgte er einen Plan.
Das Licht der Lampe flackerte noch ein paarmal und erlosch. Sein Herz begann zu rasen. Er widerstand dem Drang, die Taschenlampe anzuschalten, und zwang seine Augen, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Schon bald vermochte er Schatten zu unterscheiden.
Widerwillig löste er sich von dem Baum. Er konnte den Toten nicht so liegen lassen. Die Tiere würden ihn finden und anfressen. Was Eelco selbst übrigens kaum schlimm gefunden, sondern als natürlichen Prozess betrachtet hätte.
Verbissen trieb er die Spitze des Spatens in den Boden. Ein Geruch nach Schmutz stieg ihm in die Nase. Seine Hose und die Schuhe waren schwarz. Sand knirschte ihm zwischen den Zähnen.
5
Stunden später war die Grube endlich groß und tief genug. Er machte die Probe aufs Exempel, indem er sich selbst hineinlegte. Wenn es für ihn reichte, dann für Eelco, der kleiner war, erst recht. Die Erde war eiskalt, und die Kälte drang durch seine Kleidung. Außerdem drückten ihn die Unebenheiten des Bodens im Rücken und am Hintern. Der Wind trieb die Zweige über seinem Kopf auseinander, sodass er den schwarzen Himmel sehen konnte, der wie mit flackernden Diamanten verziert schien. Es war fast Vollmond. Je länger er schaute, desto mehr Sterne wurden sichtbar.
Seine Muskeln protestierten, als er sich aufrichtete und den Schmutz abklopfte, und erst nach einigen Versuchen gelang es ihm, sich über den Rand der Grube zu ziehen.
Mühsam schleifte er den bereits steifen Körper zum Grab und stieß ihn hinein. Eelco landete mit dem Gesicht nach unten im Schlamm. Das fand er doch irgendwie pietätlos. Erneut sprang er in die Grube und zerrte so lange an dem Toten, bis dieser mit dem Gesicht nach oben lag. So konnte Eelco den Himmel und die Sterne sehen.