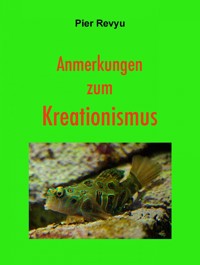
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Bereits der junge Goethe machte sich über die Behauptung lustig, dass der Formenreichtum der Organismenwelt eine "gefallene" Schöpfung repräsentieren soll, deren Urzustand dem biblischen Schöpfungsbericht zu entnehmen sei. Bis heute wird aber von – vornehmlich evangelikalen – Kreationisten versucht, evolutionsbiologische Forschung aus solch fundamentalchristlichem Schöpfungsglauben heraus zu diskreditieren. Die vorgelegte Untersuchung widmet sich besonders der evangelikalen Vereinigung Wort & Wissen, die seit langem behauptet, die Grundlagen einer wissenschaftlichen "Schöpfungsbiologie" gelegt zu haben und vor diesem Hintergrund fordert, Schöpfungsforschung als gleichberechtigte Alternative zur Evolutionsbiologie anzuerkennen. Die bizarre Dimension solcher Forderungen wird vor allem dann deutlich, wenn man aufdeckt, dass Wort & Wissen sich in ihren Pamphleten explizit auf den US-amerikanischen Vordenker Frank L. Marsh (1899-1992) berufen, der nicht nur ein Kreationist, sondern auch ein fundamentalchristlich motivierter Rassist war: was von seinen hiesigen Anhängern bislang erfolgreich verschwiegen wurde. Im Zuge der vorgelegten Argumentation wird außerdem eine (aus fachbiologischer Sicht notwendige) Distanzierung gegenüber sogenannten evolutionsbiologischen Arbeitsgruppen formuliert, welche seit gut 15 Jahren in nicht eben zielführender Weise gegen Wort & Wissen anschreiben. Stattdessen ordneten sich AG Evolutionsbiologie bzw. AK Evolutionsbiologie einem auffällig superfiziellen "Naturalismus" ihres biologistisch agitierenden Wortführers Ulrich Kutschera unter, obwohl dieser schon 2004 einen "vorsätzlichen genetischen Suizid der deutschen Bevölkerung" und ähnliches verkündet hatte. Erst viel zu spät, im Juli 2017, erklärte der VBIO (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin), dass man mit dem AK Evolutionsbiologie nicht mehr kooperiere: ein unglücklicher Verlauf der Dinge, von dem Wort & Wissen durchaus profitiert haben könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pier Revyu
Anmerkungen zum Kreationismus
Zusammenfassung
Beeinflusst von aufklärerischen Geistesströmungen machte sich bereits der junge Goethe über die Behauptung lustig, dass der Formenreichtum der Pflanzen- und Tierwelt eine „gefallene“ Schöpfung repräsentieren soll, deren eigentlicher Urzustand dem biblischen Schöpfungsbericht zu entnehmen sei. Allen Ernstes wird bis heute aber von – vornehmlich evangelikalen – Kreationisten versucht, evolutionsbiologische Forschung aus solch fundamentalchristlichem Schöpfungsglauben heraus zu diskreditieren.
Die vorgelegte Untersuchung widmet sich besonders den diesbezüglichen Machenschaften der evangelikalen Vereinigung Wort & Wissen, die seit Jahrzehnten behauptet, die Grundlagen einer wissenschaftlichen „Schöpfungsbiologie“ gelegt zu haben und vor diesem Hintergrund fordert, Schöpfungsvorstellungen als gleichberechtigte Alternative zur Evolutionsbiologie anzuerkennen. Die bizarre Dimension solcher Forderungen wird vor allem dann deutlich, wenn man aufdeckt, dass Wort & Wissen sich in ihren Pamphleten explizit auf den US-amerikanischen Vordenker Frank L. Marsh (1899-1992) berufen, der nicht nur ein Kreationist, sondern auch ein fundamentalchristlich motivierter Rassist war: was von seiner deutschsprachigen Anhängerschaft bislang erfolgreich verschwiegen wurde.
Im Zuge der vorgelegten Argumentation wird nicht versäumt, eine aus fachbiologischer Sicht notwendige Distanzierung gegenüber sogenannten evolutionsbiologischen Arbeitskreisen bzw. Arbeitsgemeinschaften zu formulieren, welche seit gut 15 Jahren in nicht eben zielführender Weise gegen Wort & Wissen anschreiben. Stattdessen ordneten sich AG Evolutionsbiologie bzw. AK Evolutionsbiologie einem auffällig superfiziellen „Naturalismus“ ihres biologistisch agitierenden Wortführers Ulrich Kutschera unter, obwohl dieser schon 2004 einen »vorsätzlichen genetischen Suizid der deutschen Bevölkerung« und ähnliches verkündet hatte. Erst viel zu spät, im Juli 2017, erklärte der VBIO (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin) dass man mit Ulrich Kutschera bzw. dessen AK Evolutionsbiologie nicht mehr kooperiere: ein dem Ansehen fachbiologischer Forschung nicht eben förderlicher Verlauf der Dinge, von dem Wort & Wissen durchaus profitiert haben könnte.
»Jeder Glaube an ein Göttliches, der mehr enthält, als den Begriff der moralischen Weltordnung, ist mir ein Gräuel und eines vernünftigen Wesens höchst unwürdig.«
Johann Gottlieb Fichte
1 – Einleitung: (Anti-)Kreationismus – Grundsätzliches
Es gibt mindestens zwei Motive, sich kritisch mit dem sogenannten Kreationismus auseinanderzusetzen, d.h. mit all jenen religiös geprägten Vorstellungen, in denen der wissenschaftliche Erklärungswert der modernen Evolutionstheorie abgestritten und stattdessen eine göttliche Schöpfung (bzw. eine weitgehende evolutive Unveränderlichkeit „geschaffener“ Lebewesen) als richtige Weltsicht ausgegeben wird.
Das primäre Motiv ist ein übergeordnetes und betrifft die Freiheit des Denkens: Es muss größtes Unbehagen erzeugen, wenn trotz aller Errungenschaften der Aufklärung ernsthaft wieder behauptet wird, bestimmte sogenannte „Offenbarungsschriften“ enthielten Wahrheiten, die man nicht hinterfragen könne oder dürfe. Bekanntlich vermochten schon frühe Aufklärer auf solche Forderungen mit einem naheliegenden Einwand zu reagieren: es gibt sehr viele einander widersprechende Offenbarungsschriften, die allesamt von sich behaupten, göttliche Wahrheiten wiederzugeben – welche von diesen hat Recht? Bedauerlicherweise sind die objektiven Möglichkeiten, eine bestimmte Offenbarungsschrift für „wahrer“ auszugeben als eine andere, arg limitiert: Entweder bleiben die betreffenden Dispute offen für endlose Wiederholungen, oder sie müssen ergebnislos abgebrochen werden – im günstigsten Fall durch Schweigen, im ungünstigsten durch verschiedene Formen von Gewaltanwendung. Das o.g. Unbehagen wird ebenso durch die vermutliche Unlösbarkeit und das andauernde Konfliktpotential religiöser Differenzen hervorgerufen, wie auch aus der Befürchtung heraus, dass weltanschaulicher Dogmatismus eine ernste Gefahr für aufgeklärte, freie Gesellschaftsformen darstellt.1
Ein weiteres Motiv betrifft den direkten Angriff auf die Grundlagen wissenschaftlicher – und hier speziell naturwissenschaftlicher – Disziplinen. Offensichtlich ist es unzumutbar, wenn Anhänger aller erdenklichen „Offenbarungsschriften“ von seriös arbeitenden Wissenschaftlern einfordern, sich in der Interpretation der Faktenlage nach (zumeist archaischen) religiösen Vorgaben auszurichten.2 Die Konsequenz einer solchen geistigen Unterordnung wäre eine Vielzahl separiert vor sich hin existierender Scheinwissenschaften: für jede Offenbarungsschrift3 mindestens eine (wenn man die inhaltlichen Streitigkeiten innerhalb bestimmter Religionen zunächst einmal ausblendet – zählt man diese hinzu, erhöht sich die Anzahl der „gefügigen“ Scheinwissenschaften entsprechend).
Ausgehend von diesen beiden Einwänden bräuchte unter aufgeklärten Menschen eigentlich keine weitere Diskussion um Kreationismus geführt werden, und tatsächlich haben bekannte Evolutionsforscher wie Stephen Jay Gould sich dem Dialog mit Kreationisten explizit verweigert (und diese Strategie des Ignorierens ihren Kollegen als die beste empfohlen – Vorläufer von Gould, wie z.B. Theodosius Dobzhansky, kamen erst über Umwege zu dieser Einsicht, vgl. Numbers 2004 S.96, sowie unten Kapitel 8). Kreationismus in all seinen Spielarten zuzulassen bedeutet in einem ersten Schritt, die Grundlagen objektiver, ergebnisoffener Naturwissenschaft zu opfern; in einem zweiten liefe es darauf hinaus, auch die Grundlagen einer freien Gesellschaft zu verlieren. Wer dies nicht riskieren möchte, kann schwerlich anders, als eine den Erkenntnissen der Naturwissenschaft entgegenlaufende Schöpfungsvorstellung abzulehnen. Abgesehen von diesem konfrontativen Szenario gibt es aber „Mittelwege“, die gar nicht so selten beschritten werden: dass es beim Verzicht auf sogenannte wörtliche Auslegungen von Offenbarungsschriften durchaus Kompromissmöglichkeiten zwischen Wissen und Glauben gibt, ist oft genug festgestellt worden.4 In der wohl bequemsten Kompromissformel stellt sich die wissenschaftliche Rekonstruktion der Kosmogenese als so etwas wie der „menschenmögliche Rückblick“ auf einen göttlichen Schöpfungsakt dar (d.h. auf eine Creatio, die gleichsam als Unbekannte jenseits der mittels Forschung rekonstruierbaren Kausalketten zu verorten ist). Nur wird dabei die Creatio als solche eben in keiner Weise wissenschaftlich bewiesen: Es wäre dies eine rein private Sicht der Dinge, die jedem freisteht, der etablierte naturwissenschaftliche Modellierungen wie die eines „Big Bang“ für sich persönlich mit einer zusätzlichen religiösen Dimension ergänzen möchte. Genau diese individualistisch-kompromisshafte Sicht aber wird typischerweise von Kreationisten nicht zugelassen, da sie auf einer (angeblich! – s.u.) textgetreuen Auslegung ihrer jeweiligen Offenbarungsschrift beharren und auf dieser Grundlage an anderen Abläufen und anderen Zeiträumen als den naturwissenschaftlich ermittelten festhalten (besonders der sogenannte „Kurzzeit“-Kreationismus, auch als young earth creationism bekannt, vgl. folgende Kapitel). Die Zuspitzung „entweder Evolution oder religiös offenbarte Schöpfung“ soll also dem Gegensatz „entweder Unglaube oder (von der richtigen Schrift offenbarter!) Glaube“ entsprechen. Letztgenannte Differenz soll unüberbrückbar sein, und führt mit der doppelt dogmatischen Behauptung einer „einzigen“ Auslegung der „richtigen“ Offenbarungsschrift zu dem zurück, was oben bereits zur Freiheit des Denkens festgestellt wurde.
Im Voranstehenden ist neutral von „Offenbarungsschriften“ die Rede, um die Vielzahl infrage kommender religiöser Vorgaben zu betonen. Im Folgenden wird aus rein pragmatischen Gründen nur noch von der Bibel bzw. der Offenbarungsschrift des Christentums die Rede sein (für die z. Z. zweitgrößte Weltreligion nach dem Christentum, nämlich dem Islam, siehe beispielhaft Riexinger 2009). Ab Kapitel 4 soll dann die in Deutschland aktivste kreationistische Bewegung Wort & Wissen im Fokus stehen, deren fundamentalchristliches Weltbild sich in einigen Besonderheiten von dem anderer radikaler Christen unterscheidet.
2 – Neuere kreationistische Strategien
Ausführliche Auseinandersetzungen mit den Inhalten eines fundamentalreligiösen, auf angeblich „wortwörtlich“-genauen Schriftauslegungen beruhenden Kreationismus sind aus wissenschaftlicher Sicht reine Zeitverschwendung. Wenn solche differenzierten Zurückweisungen trotzdem immer wieder unternommen werden, so gibt es hierfür verschiedene Grundmotive, die nicht selten miteinander vermengt auftreten. Es kann sich z.B. um reine „Liebhaberei“ handeln, also eine durch intellektuelle Redlichkeit motivierte Aufdeckung all zu offensichtlicher rhetorischer Manipulationsversuche. Oft geht es hier um die rein argumentativen Strukturen, so dass an diesem Teil der Diskussion häufig auch Nicht-Biologen beteiligt sind, wie etwa Philosophen. Ein anderer Schwerpunkt kann vorzugsweise die speziellen biologischen/geologischen/kosmologischen Inhalte betreffen und entsprechende Falschdarstellungen aufzeigen (z.B. wenn von Kreationistenseite fälschlich behauptet wird, bestimmte biologische Strukturen könnten nicht auf natürlichem Wege entstanden sein). Der nicht-naturwissenschaftliche Gegenpol hierzu wäre die rein theologische Ebene, etwa wenn Vertreter der historisch-kritischen Bibelforschung sich gegen vereinfachende, ideologisch motivierte Lesarten der Bibel stellen.5 Diese „Mehrdimensionalität“ der Kreationismus-Debatte gibt einen Hinweis darauf, warum Schöpfungsvorstellungen trotz teilweise absurder inhaltlicher Positionen als Phänomen präsent bleiben: Die „natürlichen“ Gegner kreationistischen Denkens, wie eben Biologen, Geologen, (Astro-)Physiker, Philosophen und kritische Theologen, bilden keine besonders gut eingespielte Allianz, und zum anderen sind sie von jener wissenschaftlich eher unaufgeklärten Öffentlichkeit, in der Kreationisten erfolgreich Propaganda betreiben können, meist „zu weit entfernt“ (die Theologen möglicherweise weniger als die Naturwissenschaftler, was ihrem spezifischen Beitrag eine zusätzliche Bedeutung verleiht). In dem Versuch, komplexe wissenschaftliche Argumentationen so stark zu vereinfachen, dass man sie auch der nicht vorgebildeten Öffentlichkeit gut vermitteln kann, machen sich Fachleute zuweilen angreifbar (oft freilich nur scheinbar, weil ihre kreationistischen Kritiker die betreffenden Vereinfachungen absichtlich falsch auslegen!) und kommen damit ihren Gegnern entgegen. Erneut wird hier klar, dass die von Gould und anderen empfohlene Strategie des Ignorierens sinnvoll ist, sofern man diese „populärwissenschaftliche Falle“ bewusst zu vermeiden gedenkt.
Das Erfolgsrezept „moderner“ Kreationisten besteht darin, sich mit fachlichen Inhalten detailliert auseinanderzusetzen, dabei die eigene fundamentalistische Denkweise nach Möglichkeit zu verschleiern und auf diese Weise auch außerhalb der sogenannten bildungsfernen Schichten auf Ausbreitung zu hoffen. Zusätzlich bietet jede solchermaßen erneuerte Strategie ihnen die Chance, dass die Vorgabe der „Gould-Doktrin“ verlassen wird und es doch wieder zu einer Diskussion um konkrekte fachliche Inhalte kommt, also zu einem direkten Disput zwischen Wissenschaftlern und Schöpfungsbefürwortern, wodurch der Anschein entsteht, Kreationismus wäre so etwas wie eine diskutierenswerte Alternative zur biologischen Evolutionstheorie oder zu wissenschaftlich etablierten Kosmogenese-Modellen. Mit diesem Anschein einer Debatte „auf Augenhöhe“ ist schon ein großer Teilerfolg erzielt, der dann rein situativ weiter ausgebaut werden kann.
Dass sich letzteres oft gar nicht vermeiden lässt, wird klar, wenn man sich vergegenwärtigt, dass „die“ Evolutionstheorie aus mehreren Teiltheorien zusammensetzt ist und hinsichtlich zahlreicher Einzelprobleme noch sehr offen diskutiert wird. An dem Hervorgehen allen Lebens aus frühen, Protozellen-artigen Einheiten und einer über Jahrmillionen erfolgten evolutiven Umwandlung innerhalb verschiedener Haupt-Abstammungslinien besteht nach dem heutigen Stand des Wissens aber kein Zweifel, während der genaue Verlauf und die dabei anzunehmenden Einzelmechanismen unter Fachleuten immer wieder kontrovers diskutiert werden. Einzelne Aspekte dieser fachlich völlig gerechtfertigten Debatten herauszugreifen und als widersprüchlich für die Annahme einer Evolution insgesamt herauszustellen ist sozusagen ein Standardverfahren kreationistischer Pseudokritik: Die Komplexität der Evolutionstheorie (und ihrer zentralen Themenbereiche, nämlich die Wandlungsfähigkeit des Körperbaues und des Verhaltens von Organismen) wird auf diese Weise für den simpelsten denkbaren Totalangriff genutzt. Sobald unredliche (oder schlicht auf fachlicher Inkompetenz beruhende) Manöver dieser Art aber argumentativ aufgedeckt werden, bietet das Thema Evolution genügend Möglichkeiten, sogleich auf Nebenschauplätze auszuweichen. Auf diese Weise werden Wissenschaftler von jenen zahlreichen Sachverhalten, die die Annahme eines natürlichen Evolutionsprozesses als sehr gut bestätigt ausweisen, abgelenkt und planvoll „auf die andere Seite des Spielfeldes“ hinüber gelotst, nämlich in den Bereich der offenen Forschungsfragen – sie geraten dadurch in eine Position, die besonders Laien gegenüber als andauernde Defensivhaltung verkauft werden kann. Der angestrebte Eindruck nach außen soll folglich zunächst einmal der sein, dass die Evolutionstheorie ganz enorme Erklärungsdefizite hinsichtlich aller möglichen Fragen aufweist (und deren Gültigkeit deshalb insgesamt angezweifelt werden darf – ein angesichts der Faktenlage unzulässiger Gedankensprung, der aber einem fachlich nicht vorgebildeten Publikum leicht suggeriert werden kann). Ist das betreffende Zerrbild etabliert, kann im zweiten Schritt darauf hingearbeitet werden, dass der Rückgriff auf eine „einzig wahre“ Offenbarungsschrift eine Lösung bietet, die von den Fachwissenschaftlern jedoch aus reiner Arroganz (bzw. aus der Verblendung des Unglaubens heraus) nicht akzeptiert wird.
Wie bereits festgestellt wurde, muss zum Erreichen dieser kreationistischen Minimalziele die Debatte mit allen Mitteln am Laufen gehalten werden,6 um dann der Gegenseite bei etwaigen Unklarheiten eine Verworrenheit vorzuwerfen, die wesentlich erst durch die eigenen (inhaltlichen und „kognitiven“) Ausweichmanöver erzeugt wird. Praktischerweise bleibt bei diesem Verfahren die Verworrenheit und Dunkelheit der eigenen Thesen oft gänzlich verdeckt: kaum ein Kreationist kommt z.B. in die Verlegenheit, die Anfänge der Schöpfung so detailliert schildern zu müssen, wie er von der Gegenseite Details zur Entstehung der ersten Lebensformen, oder anderweitige Einzelheiten evolutiver Abläufe, zu hören verlangt. Die Extremform solcher Vermeidungsstrategien sind neuere Formen des Kreationismus, die sich auf „Intelligentes Design“ oder „Intelligente Signale“ eines planenden Weltenurhebers berufen und den fundamentalreligiösen Aspekt hinter einem angeblich objektiven – in Wirklichkeit aber wissenschaftlich unsinnigen – Denkansatz verschleiern (vgl. auch Kapitel 12). Ein vorrangiges politisches Ziel dieser Gruppierungen besteht darin, Scheinforschung unter der Prämisse von Intelligent Design (= ID) als angeblich weltanschaulich neutrales Erkenntnisstreben „universitätstauglich“ zu machen.
3 – Politische Unterstützung sogenannter wissenschaftlicher Schöpfungsforschung
Hat man sich die o.g. allgemeine Strategie „moderner“ Kreationisten klar gemacht – also besonders solchen, die sich in den offenen biologischen Forschungsfragen gut auskennen oder gar selbst ein biowissenschaftliches Studium absolviert haben, s. u. – so stellt sich abermals die Frage, ob bzw. unter welchen Umständen man ihnen argumentativ entgegentreten sollte. Dies führt unweigerlich auf die beiden im Einleitungskapitel genannten Hauptmotive zurück. Wie hoch das Gefahrenpotential eines religiösen Fanatismus auch im „aufgeklärten“ Europa sein kann, war schon vor mehr als zehn Jahren zu bemerken, als nämlich 2006 der stellvertretende Bildungsminister Polens die Evolutionstheorie als eine »Lüge« bezeichnete (Kraus 2009, S.139) und im Oktober 2007 aufgrund ähnlicher Tendenzen die parlamentarische Versammlung des Europarates eine mit The Dangers of Creationism in Education überschriebene Resolution abgab (ebd., S.141). In Absatz 2 dieser Resolution heißt es:
»For some people the Creation, as a matter of religious belief, gives a meaning to life. Nevertheless, the Parliamentary Assembly is worried about the possible ill-effects of the spread of creationist ideas within our education systems and about the consequences for our democracies. If we are not careful, creationism could become a threat to human rights, which are a key concern of the Council of Europe.«
Der Titel der Resolution verweist auf gewisse „Erfolge“ des Kreationismus im Bildungswesen, was anhand von Einzelfällen an Schulen und auch Universitäten weiter ausgeführt werden könnte. Dies braucht hier nicht zu geschehen; es reicht die Feststellung, dass religiös indoktrinierte Politiker wie der oben zitierte stellvertretende polnische Bildungsminister reelle Möglichkeiten besäßen, kreationistisches Gedankengut auf den Lehrplan zu setzen – etwa nach der aus diesen Kreisen immer wieder auftauchenden Formel, Evolutionstheorie und Schöpfungsvorstellungen sollten im Schulunterricht „gleich behandelt“ werden. Gut zehn Jahre nach o.g. Resolution kann man anhand der politischen Entwicklungen in Ländern wie Polen, der Türkei und auch den USA7 feststellen, dass die im zitierten Abs. 2 genannten Befürchtungen nicht realitätsfern waren. Es ist naheliegend, dass spätestens bei politischen Konstellationen dieses Typs die von Stephen Jay Gould empfohlene Strategie des Ignorierens ihre Nachteile haben könnte und stattdessen eine offensive Auseinandersetzung mit erfolgreich verbreiteten, pseudo- und antiwissenschaftlichen Denkströmungen geboten erscheint: vor allem, wenn man damit ihre entscheidende Aufwertung durch fundamentalreligiös beeinflusste Politiker und Regierungen noch rechtzeitig verhindern kann.





























