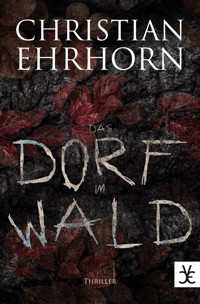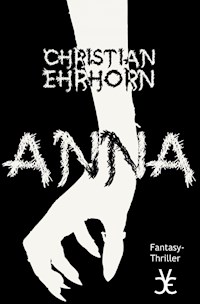
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es ist eine finstere Nacht, als die riesige weiße Kreatur unvermittelt vor Annas Bett auftaucht. Wie ein lauerndes Unheil verharrt sie dort, nur um im nächsten Moment wieder zu verschwinden. Gezeichnet von der Begegnung, ist sie zehn Jahre später, als sechzehnjähriger Teenager, noch immer traumatisiert. Nur mit einem Nachtlicht schafft Anna es, Schlaf zu finden. Doch niemand glaubt ihr. So wird das Zusammentreffen mit dem hellhäutigen Monster wie ein Albtraum abgetan. Als nach der nächsten Begegnung mit der Kreatur plötzlich ihr kleiner Bruder verschwindet, wird Anna gezwungen, sich dem Wesen zu stellen und zu ergründen, warum es sie heimsuchte. Dabei stößt sie auf Geheimnisse in der Vergangenheit, die alle Welten zu zerstören drohen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANNA
Von Christian Ehrhorn
Buchbeschreibung:
Es ist eine finstere Nacht, als die riesige weiße Kreatur unvermittelt vor Annas Bett auftaucht. Wie ein lauerndes Unheil verharrt sie dort, nur um im nächsten Moment wieder zu verschwinden.
Gezeichnet von der Begegnung, ist sie zehn Jahre später, als sechzehnjähriger Teenager, noch immer traumatisiert. Nur mit einem Nachtlicht schafft Anna es, Schlaf zu finden. Doch niemand glaubt ihr. So wird das Zusammentreffen mit dem hellhäutigen Monster wie ein Albtraum abgetan. Als nach der nächsten Begegnung mit der Kreatur plötzlich ihr kleiner Bruder verschwindet, wird Anna gezwungen, sich dem Wesen zu stellen und zu ergründen, warum es sie heimsuchte. Dabei stößt sie auf Geheimnisse in der Vergangenheit, die alle Welten zu zerstören drohen.
ANNA
Von Christian Ehrhorn
CE-Verlag
Königsberger Straße 12
22175 Hamburg
1. Auflage, 2021
© Christian Ehrhorn – alle Rechte vorbehalten.
CE-Verlag, Hamburg
»Gäbe es Wesen, die den Menschen alle Wünsche erfüllen, so wären das keine Götter, sondern Dämonen.«
(FRIEDRICH GEORG JÜNGER)
»Wer die Seele tötet, weckt die Dämonen.«
(SAUL BELLOW)
Prolog
Es war eine dieser finsteren Nächte, die einem jegliches Augenlicht raubte. Eine durchdringende Dunkelheit, die alles verschlang. Bis in die hinterste Ecke hatte die Schwärze der Nacht den Raum geflutet. Nicht einmal der helle Schein des Mondes schaffte es, durch die dunklen Vorhänge vor dem Fenster zu schlüpfen. Nur die blau leuchtenden Ziffern des digitalen Weckers, der auf dem Nachtisch neben dem Bett ruhte, warfen ein blasses Glimmen in den Raum. Es war 45 Minuten nach zwei Uhr in der Nacht.
Anna lag in tiefem Schlaf. Die weiße Decke mit den rosa Blumen hatte sie bis zu ihrem Kinn hochgezogen. Ihre langen, kastanienbraunen Haare waren wie ein Fächer auf dem weichen Kopfkissen ausgebreitet, dessen Muster dem der Decke glich. Am Ende des Bettes lag einer ihrer Füße frei und berührte ihre schwarze Schultasche, welche über den buchenhölzernen Bettpfosten gehängt war. Die Tasche stand offen und eine große gelbe Schultüte ragte heraus.
Es war die Nacht ihres ersten Schultages, als es geschah. Die Nacht, in der sich ihr Leben von Grund auf veränderte.
Anfangs nahm sie es kaum wahr. Ein leichtes Kitzeln, das über ihren Fußrücken glitt. Das ihre Zehen geringfügig Zucken ließ. Gleichwohl so merklich, dass es sie aus dem Schlaf riss. Von Müdigkeit benommen, war der zarte Reiz noch immer spürbar. Das Kribbeln einer sanften Berührung.
Anna bewegte ihren Fuß. Sie streifte etwas. Etwas, das über ihre Bettkante herausragte. Weich und kalt. Es wirkte starr, doch konnte sie eine leichte Bewegung ausmachen. Schwach, kaum merklich, schwang dieses Etwas hin und her. Erneut verspürte sie das Kitzeln, wie es kalt über ihren Fuß strich.
Anna rümpfte die Nase. Ein merkwürdiger Geruch schwebte in ihrem Zimmer. Wie verbranntes Holz. Und da war noch etwas. Ein Aroma, dass sie nicht kannte. Es roch unangenehm, ja es stank regelrecht.
Ein Knarren. Anna erschrak vor dem plötzlichen Geräusch. Ihr Atem wurde schneller. Sie schnappte nach Luft. Das Pochen ihres Herzens wandelte sich in ein Hämmern. Sie erstarrte. Jemand war in ihrem Zimmer!
Ihr Vater sah beizeiten in der Nacht nach ihr. Aber immer wenn sie aufwachte, sprach er mit seiner Tochter. Seine Worte hatten einen Zauber inne, der in ihr das Gefühl von Geborgenheit erweckte. Mit sanfter Stimme erzählte er seiner Kleinen eine Geschichte, die sie wieder in ihre Träume gleiten ließ. Doch nun war kein Wort zu hören.
»Papa?«, haschte sie flüsternd nach dem Klang einer vertrauten Stimme.
Wieder knarrte es. Dieses Mal etwas lauter. Anna hielt die Luft an. War mucksmäuschenstill. Und dennoch hörte sie das leise Zischen eines Atems. Entfernt, aber doch in ihrer Nähe. Langsam hob Anna ihren Kopf.
Weiß. Immer wenn Anna an diese Nacht zurückdachte, kam ihr das Weiß in den Sinn, das selbst die tiefste Dunkelheit durchdrang. Diese fahle, kalte Haut der Gestalt, welche hinter ihrem Bett stand und seine knochigen, langen Finger an ihren Fuß legte. Sie erinnerte sich, wie der ovale, gesichtslose Kopf bis weit über die Decke ihres Zimmers herausragte. Dieser dürre Körper mit den langen Gliedmaßen, der auf sie eher wie eine Spinne als ein Mensch wirkte. Der Schädel des Wesens war durch eine tiefe Falte gespalten, die sich von der Stirn bis zum Kinn erstreckte. Leicht geöffnet, lugten vor Speichel glänzende Reißzähne draus hervor.
In der Bewegung ihres Atems hob und senkte sich der Körper der Kreatur. Ruhig, aber bedrohlich verharrte sie. Trotzdem das Wesen keine Augen hatte, spürte das junge Mädchen wie sein Blick sie durchbohrte.
Anna begann zu zittern, während sie mit weit aufgerissenen Augen auf das weiße Monstrum starrte. Ihre Lippen öffneten sich zu einem Schrei. Doch kein Ton entwich ihrer Kehle. Von Angst erdrückt kniff sie ihre Lider krampfhaft zu.
Erneut ächzte der Boden.
Mit offenem Mund gaffte das Mädchen in grenzenloses Schwarz. Von einem Augenblick auf den anderen war die Gestalt verschwunden. Einsam saß sie in der Finsternis. Und konnte endlich schreien.
Kapitel 1
Das Nachtlicht
Prasseln. Anna Frey liebte das Prasseln. Sie öffnete das Fenster und lauschte der sanften Melodie der Regentropfen. Mit einem tiefen Atemzug genoss sie den erdigen Duft, den das Gemisch aus Regen und Erde freisetzte. Sie streckte ihre Hand aus und beobachtete die Tropfen, wie sie sanft auf ihre Haut fielen. Gebannt sah Anna auf das Nass, das ihre Finger hinab floss. Ihre Gedanken gingen auf Wanderschaft und reisten in die Vergangenheit. Vor ihrem inneren Auge erblickte sie sich selber. Sie war ein Kind. Nicht älter als vier Jahre. Lachend rannte sie durch einen Vorhang aus Tropfen, den der Regen beim Hinabfallen spann. Die kleine Anna hatte immer wieder versucht, die Regentropfen mit ihrem Mund zu fangen. Während sie voller Freunde in ihren rosa Gummistiefeln von Pfütze zu Pfütze hüpfte. Wie gerne sah sie dabei zu, wie das Wasser zu allen Seiten spritzte, wenn sie in die Lachen sprang.
Heute mit sechzehn Jahren vermisste sie diese unbeschwerte Zeit. Die Zeit ohne Sorgen und ohne Angst.
»Das Essen ist fertig«, tönte es durch die geöffnete Zimmertür.
»Ja Mama, ich komme«, antwortete Anna.
Auf dem Flur war das Trampeln ihres jüngeren Bruders zu hören, der die steinerne Treppe des kleinen Reihenhauses mehr herunterfiel, wie lief.
Anna wischte ihre nasse Hand an ihrem weiten, schwarzen T-Shirt ab, auf dessen Brust ein weißer Totenkopf prangte, und schloss das Fenster. Sie raffte ihre langen braunen Haare am Hinterkopf zusammen und band sie mit dem dunklen Gummi, welches um ihr Handgelenk gelegt war, zu einem Zopf. Anna liebte ihre Haare. Hätte man sie gefragt, würde sie antworten, dass sie das Beste an ihr waren. Sie empfand sich selber als hässlich. Trotzdem sie einen schlanken Körper hatte, wurde ihr Gesicht von kleinen Pausbäckchen umrandet. Noch grässlicher fand sie nur die hellbraunen Sommersprossen, die darauf verteilt waren und sich in einer Spur über ihre Nase zogen. Der Herbst brach an und die Sonne war selten zu sehen. Wodurch man die Pigmentflecke nur leicht erahnen konnte. Doch, genau wie ihr Name es schon verriet, kam der Sommer, kamen sie wieder in ihrer ganzen Pracht zum Vorschein.
Sie nahm ihr Smartphone vom Nachttisch und steckte es in die Tasche ihrer hellen Jeans, auf deren Knien zwei große Risslöcher klafften. Dann schlüpfte sie in ihre schwarz-weißen Sneaker und begab sich aus dem Zimmer.
Anna seufzte. Ihr grauste es jeden Tag vor den Tischgesprächen mit ihrer Mutter. Denn selten verliefen diese friedlich und harmonisch. Von cholerischem Geschrei bis zu körperlicher Gewalt schlug Anna alles von ihrer Mutter entgegen. Und auch dieses Mal würde es nicht anders verlaufen. Da war sie sich sicher.
Seitdem sie alleine mit den Kindern war, hatte ihre Mutter sich verändert. Wut, Frust und Überforderung vergifteten ihr Gemüt, wodurch ihre Nerven gespannt waren wie Drahtseile. Wurde nur ein bisschen daran gezupft, rissen sie und entfesselten einen tollwütigen Dämon in ihrem Inneren. Doch während sie ihren jungen Sohn vor ihren Ausbrüchen bewahrte, wurde Anna regelmäßig von ihrem Groll überrollt.
Anna betrat die Küche, in der der buchenhölzerne Esstisch bereits gedeckt war. Zwei Räume weiter lag zwar ihr Esszimmer, aber dies wurde nur genutzt, wenn sie Besuch hatten.
In einem roten Plastiksieb, welches auf einen silbernen Topf gestellt war, befanden sich Spaghetti. Daneben stand eine weiße Schale mit Tomatensauce. Drumherum platziert waren drei Teller aus hellem Porzellan mit einem blauen Rand. Ihr Bruder Frank war dabei das Besteck auf dem Geschirr zu verteilen. Seine zotteligen braunen Haare fielen ihm bis ins Gesicht und vor seine Augen, weswegen er immer wieder seinen Kopf schüttelte. Er trug ein weißes Shirt mit dem Logo von Superman darauf.
»Eine schlechte Wahl«, dachte Anna, in Anbetracht der Tomatensauce und der Essgewohnheiten ihres kleinen Bruders.
»Du könntest auch mal ein bisschen helfen«, fuhr die Mutter Anna an, sowie sie sich an den Tisch setzen wollte.
Sie wandte den Blick von ihrer Tochter ab, hin zu ihrem Sohn.
»Du bist super mein Spatz«, sagte sie lächelnd und warf eine Kussgeste hinterher.
Frank sah zu seiner Schwester und grinste verschmitzt. Anna stöhnte genervt und verdrehte die Augen, während sie sich auf den Stuhl setzte. Wie Frank es genoss, der Liebling ihrer Mutter zu sein, kotze sie an. Dieser Schleimer ließ keine Gelegenheit aus, um zu beweisen, dass er das bessere Kind war. Nicht dass Anna sonderlich bemüht war, ihm diesen Rang streitig zu machen. Die Verachtung ihrer Tochter gegenüber, stand wie eine massive Steinmauer zwischen Anna und ihrer Mutter. Über die Jahre hinweg hatte diese Mauer an Substanz gewonnen. Weswegen es schier unmöglich für Anna war, sie einzureißen. Sie vermutete, der Hass ihrer Mutter rührte daher, dass sie ihr die Schuld für das Verschwinden ihres Ehemanns David gab. Zwar hatte Kelandra Frey es nie offen zugegeben. Doch hin und wieder ließ sie Sätze fallen, aus deren Kontext Anna diese Vermutung ableitete.
Ihre Mutter stellte eine kleine Schale mit Parmesankäse auf den Tisch, dann setzten auch sie und Frank sich.
»Es ist Freitagabend, habt ihr etwas für das Wochenende geplant?«, fragte Kelandra in die Runde, mit der Nudelkelle Spaghetti aufnehmend.
»Ich gehe morgen zu Tom, wir wollen zocken«, antwortete Frank kaum verständlich mit dem Mund voller Nudeln.
»Schläfst du auch dort?«, fragte die Mutter.
»Weiß nicht«, murmelte Frank nur wenig verständlicher.
»Ich würde gerne morgen Abend ausgehen. Es wäre schön, wenn du dort schlafen könntest.«
Die Mutter strich ihm durch sein braunes Haar. Frank sowie Anna hatten ihre Haarfarbe von ihrem Vater geerbt, während der Schopf ihrer Mutter hellblond war. Insgesamt sahen die beiden Kinder ihrer Mama kaum ähnlich. Lediglich die leuchtend hellblauen Augen hatten sie alle gemeinsam.
»Ich frag«, sagte Frank kurz und knapp, auf das Bändigen der langen Nudeln auf seinem Teller konzentriert.
Der Blick der Mutter wanderte zu Anna.
»Was ist mit dir?«
Anna starrte auf ihren Teller, die Spaghetti in einem Strudel um ihre Gabel rollend.
»Ich wollte morgen ein neues Buch anfangen.«
»Lesen?« Kelandra klang verwundert. »Du bist sechzehn. Geh raus, geh zu deinen Freunden. Mach Party.«
»Welche Freunde?«, murmelte Anna genervt.
»Du hättest sicher mehr Freunde, wenn du nicht immer so eine miese Laune haben würdest. Und lauf nicht immer herum wie ein Junge. Zieh dir mal ordentliche Klamotten an. Mal ein bisschen sexy. Dann findest du auch Freunde. Wäre ich in deinem Alter, würde ich so auch nichts mit dir zu tun haben wollen.«
Anna zuckte mit den Schultern.
»Und wenn wir schon einmal dabei sind«, fuhr ihre Mutter fort. »Wir müssen dringend mal über dein Nachtlicht reden. Du bist kein kleines Kind mehr. Selbst dein Bruder kann ohne Licht schlafen und der ist zwölf.«
Frank setzte ein mit Tomatensauce beschmiertes Grinsen auf, während ihm Spaghetti bis zum Kinn aus dem Mund hingen.
»Du hattest als Kind einen Albtraum. Das ist zehn Jahre her. Komm darüber hinweg. Das ist bestimmt auch ein Grund, warum du keine Freunde hast.«
Zornig blickte Anna zu ihrer Mutter.
»Das mit dem Licht ist meine Sache und geht dich rein gar nichts an«, fauchte sie mit erhobener Stimme.
Das Klatschen hallte durch die gesamte Küche, als die flache Hand ihrer Mutter auf Annas Wange einschlug.
»Du entsorgst das Licht am Wochenende, sonst tue ich das, während du in der Schule bist!«, drohte die Mutter.
Tränen sammelten sich in Annas Augen. Klirrend schmiss sie ihr Besteck auf den Teller.
»Du hast keine Ahnung wie es mir geht!«, schrie Anna.
Kelandra schlug mit der Faust auf den Tisch. Frank zuckte zusammen.
»Ich habe mein eigenes Leben«, schrie sie zurück. »Ich will mich nicht mehr um eine Fünfjährige im Körper einer Sechzehnjährigen kümmern. Es reicht. Werde endlich erwachsen!«
Anna vergrub ihr Gesicht in den Händen. Schluchzen drang darunter hervor.
»Guck dir deinen Bruder an«, wütete die Mutter weiter. »Ich kann ihn nicht einmal bei dir lassen, wenn ich mal ausgehen will, sondern muss ihn zu anderen Leuten geben. Er ist erst zwölf und ich traue ihm viel mehr zu als dir. Das ist doch erbärmlich!«
Während Frank und ihre Mutter weiteraßen, rannte Anna mit tränenverschmiertem Gesicht die Treppe hinauf. In einem lauten Knall gipfelnd, schmiss sie ihre Zimmertür zu. Sie atmete tief durch, das wohlig klingende, metallische Klicken des Türschlosses in den Ohren. Anna zog den Schlüssel aus dem Schloss und legte ihn auf ihren Nachttisch. Dann stellte sie sich an das Fenster.
Gedankenverloren folgten ihre Augen den Regentropfen, wie sie die Scheibe hinunterliefen, sich trafen und vereint ihren Weg fortsetzten. Anna wünschte sich, sie wäre eine dieser Wasserperlen. Jede wurde von den anderen empfangen. Egal wie groß oder klein, langsam oder schnell, schmutzig oder sauber. Alle Tropfen harmonierten.
Nur ein Mensch würde ihr schon reichen. Ein Mensch wie ein Tropfen. Der sie annehmen würde, wie sie ist. Mit all ihren Macken und Fehlern. Und mit allem, was sie erlebt hatte.
Die Nacht brach ein. Anna lag in ihrem Bett. Das Flackern des Fernsehers spiegelte sich in der mit Tropfen gesprenkelten Fensterscheibe. Auf dem Bildschirm lief der Abspann einer Dokumentation über die Löwen in Afrika, welche sie sich bei Netflix angesehen hatte. Neben ihrem Bett auf dem Nachttisch brannte das Nachtlicht. Es sah aus wie eine Laterne aus dem 19. Jahrhundert. Das schwarze, angelaufene Metall vermittelte den Anschein, es würde sich um ein antikes Stück handeln. Die kleine Glühbirne im Inneren und das Stromkabel auf der Unterseite trübten diesen Eindruck etwas.
Anna schaltete den Fernseher aus. Anschließend begab sie sich hinüber zum Fenster. Sie verharrte einige Sekunden davor. Blickte durch das Glas, in ihr Spiegelbild. In diesem Moment sah sie nur ihr eigenes Gesicht. Doch was wäre, wenn ihr dort ein anderes entgegengaffen würde? Das eines Monsters? Anna war bewusst, dass es die irrationale Angst eines Kindes war, die sie trieb. Dass sie sich im Obergeschoss des Hauses befand. Dort war es mehr als unwahrscheinlich, dass jemand vor ihrem Fenster erscheinen würde. Dennoch fühlte sie sich sicherer, wenn die Vorhänge es verdeckten. Sah sie das Monster nicht, würde es sie auch nicht sehen. Anna ertappte sich immer wieder bei diesem kindischen Gedanken. Doch er bot ihr freies Geleit in den Schlaf. Und so zog sie die Vorhänge ruckartig zu.
Wieder im Bett, nahm sie das Smartphone von ihrem Nachttisch und schaltete das Display ein. Das Hintergrundbild zeigte einen rot-weißen Leuchtturm, an dem eine große Welle brach. Anna liebte das Meer. Die Sicht auf die endlose See erfüllte sie mit einem Gefühl von innerem Frieden. Oft stellte sie sich vor, wie sie auf ein Schiff sprang und ohne einen Blick zurück hinaus auf das offene Meer segelte. Gespannt, wohin sie Wind und Wellen tragen würden.
Gedankenverloren sah sie auf den Bildschirm des Telefons. Darauf prangte in schwarze Zahlen die Uhrzeit. 22:45 Uhr. Anna seufzte. Sie war froh, dass ein weiterer anstrengender Tag sein Ende fand. Sie rückte ihr langes weißes Shirt zurecht, das sie zum Schlafen trug. Schlüpfte unter die mit blauer Bettwäsche bezogene Decke. Und schmiegte ihren Kopf an das blaue Kissen, wie an die wohlig weiche Mutterbrust, die sie nie zu spüren bekommen hatte. Sie starrte an die Decke, die vom warmen Schein der Lampe in ein orangenes Licht getaucht wurde. In Gedanken friedlich über das Wasser des offenen Meeres gleitend, setzte sie die Segel in Richtung des fantastischen Landes der Träume.
Anna öffnete die Augen. Und starrte in die Dunkelheit. Hätte sie den Mond nicht hinter den Vorhängen versteckt, würde er sein silbriges Licht durch das Fenster scheinen lassen. Doch so sah sie nur eines. Unendliche Finsternis.
Ein kalter Schauer zog über ihren Rücken. Ihr Innerstes schnürte sich krampfhaft zusammen. Leicht begann sie zu zittern. War sie wach? Oder träumte sie von der Dunkelheit? Nie war es in ihrem Zimmer so düster gewesen. Sie mied die Schwärze der Nacht. Vertrieb sie mit hellem Leuchten.
Anna blickte zur Seite. Auf das Nachtlicht. Ihre Rettung vor der Finsternis. Es war erloschen.
»Warum ist es aus?«, war ihr erster Gedanke.
Es war nicht von ihr ausgeschaltet worden. War es ihre Mutter? Ihr Zimmer war verschlossen. Wie hätte sie das machen sollen?
Sie griff ihr Smartphone. Es war zwei Uhr und 45 Minuten in der Nacht. Anna tastete nach dem Schalter des Nachtlichts, welcher sich am Stromkabel befand. Klick. Nichts geschah. Sie betätigte den Schalter erneut. Erst jetzt bemerkte sie, dass das Kabel ungewöhnlich lose hing. Sie schaltete die Taschenlampe an ihrem Smartphone ein. Dann beugte Anna sich über den Rand des Bettes. Sie spürte, wie die Innenflächen ihrer Hände plötzlich feucht wurden. Ihr Puls begann sich zu beschleunigen, er hämmerte regelrecht. Anna hatte das Gefühl, ihr Herz würde jeden Moment den Brustkorb durchbrechen. Sie schluckte schwer, als sie sich der Düsternis näherte.
Würde etwas unter dem Bett auf sie lauern? Würde es sie packen und unters Bett ziehen? So wie sie es in vielen Vorschauen zu Gruselfilmen gesehen hatte.
Das Licht des Smartphones erhellte das erste Stück unter dem Bett. Anna verfolgte das Kabel des Nachtlichts, welches in der Finsternis verschwand. Der Schein drang weiter in die Dunkelheit vor. An der Wand unter ihrem Bett entdeckte sie die Steckdose, in die das Nachtlicht eingesteckt war. Wie zwei schwarze Augen glotzten sie die Löcher des leeren Anschlusses an. Lose lag das Kabel der Lampe davor.
Hektisch leuchtete Anna den restlichen Teil unter dem Bett ab. Um sich sicher zu sein, dass dort nicht jemand oder Etwas auf sie lauerte. Sie entdeckte ein rosa Haargummi, ein paar rote Socken, einen kleinen blauen Ball und jede Menge aufgetürmten Staub. Jedoch nichts, was ihr gefährlich erschien.
Anna rollte aus dem Bett und ließ sich auf den Boden fallen. Sie schob das leuchtende Smartphone unter das Bett. Ihre Hand griff nach dem Kabel des Nachtlichts.
Ein Knarren. Anna schreckte auf. In Sekundenschnelle schoss ihr Puls in die Höhe. Ihr Atmen wurde schwerer und wandelte sich in ein Keuchen. Sie holte das Smartphone unter dem Bett hervor und durchleuchtete den Raum. Annas Blick wanderte durch das Zimmer. Immer dem Punkt folgend, den der Lichtkegel der Lampe erhellte. Kantige Schatten türmten sich wie gruselige Scherenschnitte an den Wänden auf und wanderten mit dem Licht. Nie hatte sie ihre Zimmereinrichtung so furchteinflößend wahrgenommen.
Mit einem erleichterten Schnauben wandte Anna sich wieder der Steckdose unter dem Bett zu. Doch die Entspannung währte nicht lange. Trotzdem sie im Zimmer nichts entdeckt hatte, hatte sie ein ungutes Gefühl dabei, dem offenen Raum den Rücken zu kehren. Ruhelosigkeit überfiel sie.
Hektisch griff Anna nach dem Kabel. In der Eile rutschte es ihr aus den schweißnassen Fingern. Als sie es endlich fest in der Hand hielt, verband sie es wieder mit der Steckdose. Der warme Schein des Nachtlichts verdrängte die Dunkelheit. Anna atmete tief durch. Sie ließ ein erlösendes Seufzen los.
Mit der Ruhe kam die Erkenntnis, dass etwas anders war. Erst nahm Anna den Geruch wahr. Nur leicht, aber dennoch stechend drang ihr das Aroma von Schwefel und verbranntem Fleisch in die Nase. Gefolgt von einem merkwürdig stumpfen Gefühl in ihren Händen. Fahles Grau hatte sich auf ihren Fingern und der Handinnenfläche ausgebreitet. Sie rieb das feine Pulver zwischen ihren Fingerspitzen.
»Asche?«, stieß Anna verwundert aus.
Sie nahm das Smartphone und leuchtete erneut unter das Bett. Dieses Mal sah sie genauer hin. Sofort fielen ihr die Aschehaufen ins Auge, welche sie zuvor fälschlicherweise für Staub gehalten hatte. Sie waren in Linien aufgehäuft. Ein Muster. Doch Anna konnte es vom Boden aus nicht erkennen.
»Fuck!«, entfuhr es ihr.
Sie kroch unter dem Bett hervor. Die staubigen Finger klopfte sie an ihrem Nachthemd ab. Graue Abdrücke ihrer Hände blieben darauf zurück.
Anna griff die hinteren Pfosten ihres Bettes. Keuchend begann sie mit aller Kraft zu schieben. Elendig heulte der hölzerne Boden, während die Füße des Gestells über ihn kratzten.
Einen Augenblick erstarrte Anna. Trotz der Anstrengung ruhte ihr Atem für einen kurzen Moment. Totenstille herrschte, während Sie betrachtete, was sie freigelegt hatte.
Große, aus Asche geschriebene Lettern gafften ihr entgegen.
ET ORP SON.
Mit wirrem Blick betrachtete Anna die Worte, angestrengt einen Sinn in den Buchstaben zu finden. In Gedanken ordnete sie die Zeichen neu. Wie ein Scrabble-Spieler tauschte sie hin und her. Doch die Lettern ließen keine Bedeutung erkennen.
Ein helles Licht blitzte auf, als sie mit ihrem Smartphone ein Foto von der Ascheschrift machte.
Ihr Herzschlag überschlug sich schlagartig beim Geräusch des erneut krachenden Fußbodens. In Windeseile fuhr ihr Körper herum. Während sie einen Blick in den leeren Raum warf, stöhnte der Boden erneut.
»Der Flur«, kam ihr in den Sinn. Von dort ertönte es, das Knarren, welches ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Schon oft war Anna aufgrund des Geräusches in der Nacht hochgeschreckt. Zu ihrer Beruhigung waren die Erklärungen dafür meist schnell gefunden. Der nächtliche Toilettengang ihrer Mutter oder das Plündern des Kühlschrankes durch Frank für einen Mitternachtssnack versetzten sie immer wieder in Todesangst. Die rotgetigerte Katze, welche sich mit Vorliebe nachts in ihr Haus verirrte, tat das übrige, um Anna in Panik zu versetzen.
In Gedanken führte sie es sich vor Augen. Wie sie Frank oder ihre Mutter auf dem Flur antraf. Und wusste, dass alles in Ordnung war. Dieses Mal würde es wieder so sein. Dessen war sich Anna sicher. Fast sicher. Wäre da nicht ein Detail, welches nicht in das heile Bild passte. Die Buchstaben aus Asche.
Wieder krächzte der Boden.
Anna nahm ihren Zimmerschlüssel vom Nachttisch. Bedachten Schrittes bewegte sie sich zur Tür des Raumes. Sie erstarrte bei jedem metallischen Klicken, welches das Schloss von sich gab.
Der orangene Schein des Nachtlichts ergoss sich in den Flur und durchbrach die Schwärze der Nacht. Anna trat mit einem Fuß aus ihrem Zimmer hervor. Sie blickte geradeaus. Auf die Treppe, welche in das Erdgeschoss führte. Mit jeder weiteren Stufe hinab verlor das Nachtlicht seine Kraft, bis das Ende der Treppe wieder völlig in der Finsternis verschwand.
Ein Knacken.
Annas Kopf schoss nach links. Es befanden sich zwei weitere Räume im ersten Stock des Hauses. Einen Raum weiter war das Schlafzimmer ihrer Mutter. Und am Ende des Flures lag das Zimmer von Frank. Dessen Tür stand offen.
Anna erspähte etwas. Eine Bewegung. Das Fragment eines Körpers. Rasch war es in Franks Zimmer verschwunden. Es bewegte sich zu schnell, um zu erfassen, was es war. Nur eines konnte Anna erkennen. Klar und deutlich. Und es ließ ihr einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Weiß.
Kapitel 2
Frank
Verdutzt blickte Frank seiner Schwester nach, wie diese wütend und weinend davonstürmte. Das Grinsen wich von seinem mit Tomatensauce verschmierten Mund.
»Das war jetzt krass!«, bemerkte Frank, während er sich eine weitere Gabel mit Spaghetti in den Mund steckte.
»Die beruhigt sich wieder«, sagte seine Mutter.
Er zuckte mit den Schultern.
»Mag sein.«
»Willst du ihren Rest haben?«, fragte mit Annas Teller in der Hand, den sie vom Tisch räumen wollte.
»Ich hab noch«, quoll undeutlich aus Franks vollen Mund.
Nachdenklich sah er auf seinen Teller, noch immer auf der Masse aus Nudeln und Tomatensauce kauend.
»Und wenn es kein Albtraum war?«
»Bist du bescheuert?«, entgegnete seine Mutter, von der Frage sichtlich überrascht.
»Na ja, sie wird immer echt aggro, wenn man sagt es war nur ein Albtraum. Sie sagt immer, es war keiner.«
»Hat sie dich jetzt schon mit ihren Hirngespinsten angesteckt?«
Frank schüttelte langsam den Kopf.
»Ich meine ja nur. Sie scheint zu glauben, es war keiner.«
Seine Mutter beugte sich zu ihm herunter, mit ihrem Gesicht dicht an seines heran.
»Ein weißes Spinnenmonster, bohoo«, sagte sie mit tiefer, kratziger Stimme und begann zu lachen. Sie formte ihre Finger zu Krallen und fuchtelte mit ihren Händen vor seinem Gesicht.
Fragend hob Frank seine Arme.
»Du glaubst an Gott, ist das nicht genauso bescheuert?«
Das Lachen wich aus dem Gesicht seiner Mutter. Und wechselte in Franks.
Das bläuliche Licht des Fernsehers flackerte im sonst dunklen Wohnzimmer und ließ die Schatten über die weiße Raufasertapete tanzen. Schüsse dröhnten aus den Lautsprechern des Gerätes. Auf dem Bildschirm tobte ein wilder Schusswechsel.
Frank schreckte auf. Von der Müdigkeit benebelt blickte er orientierungslos im Raum umher. Erst nach kurzer Zeit erinnerte er sich, dass er im Anschluss an das Abendessen ins Wohnzimmer ging und sich vor den Fernseher gesetzt hatte.
Frank saß in einem klobigen Sessel. Auf den Armlehnen des kastanienbraunen Lederbezugs klafften mehrere tiefe Risse. Mit der verblassten Farbe der Rückenlehne konnte das in die Jahre gekommene Möbelstück sein Alter nicht verbergen. Das Knacken und Knarren, welche es bei jeder Bewegung darauf von sich gab, klang wie das Knurren eines griesgrämigen alten Mannes.
Der Sessel war das Einzige, was Frank von seinem Vater geblieben war, seit dieser sie vor neun Jahren verlassen hatte. Auch wenn Frank seinen Vater kaum kannte, ohne ihn fehlte ein wichtiger Teil in der Familie. Er merkte oft, dass es seiner Mutter ebenso erging. Dennoch war der Verbleib von David ein Thema, das nicht angesprochen werden durfte. Hatte Frank das Bedürfnis über seinen Vater zu reden, erhielt er meist dieselbe Antwort: »Es ist besser, dass er weg ist!« Frank hatte keine Ahnung, wo sein Vater war. Warum er ging. Und er bekam keine Antworten. Diese Ungewissheit fraß sich durch Franks Seele wie ein Krebsgeschwür. Sie nagte an ihm, zermürbte ihn förmlich. Nach Außen zeigte er es kaum. Für seine Mutter spielte er das unbekümmerte Kind. Jeden Tag focht er einen elendigen Kampf, um zu verhindern, dass sein leidvolles Innerstes nicht die vor Glück strotzende Fassade bröckeln ließ, die er sich mühsam aufgebaut hatte.
Frank rutschte von dem Sessel herunter. Noch immer lag ihm das Abendessen schwer im Bauch. »Deine Augen sind größer als dein Magen«, bekam er immer wieder von seiner Mutter zu hören. Und auch bei diesem Essen war der letzte Bissen einer zu viel gewesen.
»Aua«, stieß Frank aus. Schlaftrunken war er mit dem Knie gegen den massiven, hellen Marmortisch geknallt, dessen kurze Seite direkt zum Sessel ragte. Die mit Ornamenten umrandete Tischplatte stand auf einem dicken Sockel. Es war ein alter Tisch, der seinen Großeltern gehört hatte. Er thronte vor einem Stoffsofa. Der ehemals weiße Bezug, welcher durch den Tabakgenuss seiner Mutter eine gelbliche Färbung angenommen hatte, stand in intensivem Kontrast zum dunklen Sessel.
Frank schaltete den Fernseher aus. Er rieb sich die Augen und gähnte beim Heraustreten aus der Wohnzimmertür. Schlaftrunken erreichte er die Treppe. Kurz war er unentschlossen, ob er für den Weg hinauf die Lampe, welche auf mittlerer Höhe des Aufgangs hing, anschalten sollte. Doch als die hellen Strahlen in seine Augen stachen, entschied er sich rasch, das Licht wieder auszuschalten. Mit gemächlichen Schritten stapfte er Stufe für Stufe in das obere Stockwerk des Hauses.
Vorbei an Annas Raum ging er direkt auf sein Zimmer zu. Verwundert blieb er stehen und drehte sich um, kurz bevor er seine Tür erreichte. Er sah zurück. Es war dunkel. Warum war es dunkel? Frank konnte sich nicht erinnern, ob er schon einmal gesehen hatte, dass kein Lichtschein unter der Tür von Anna leuchtete.
»Hatte Anna auf Mama gehört?«, fragte sich Frank. Es wäre für ihn etwas Neues gewesen. Die Diskussion über das Nachtlicht wurde in ihrer Familie mindestens einmal die Woche geführt. Und auch die Drohung, es zu entsorgen, stieß ihre Mutter öfter aus, als Frank es zählen konnte.
Nun war das Licht aber aus. Frank zuckte mit den Schultern. Das war mal eine Abwechslung. Vielleicht würden die gemeinsamen Essen in Zukunft friedlicher und mit weniger Geschrei ablaufen. Also langweilig.
Noch etwas war merkwürdig. Frank konnte nicht erfassen, was es war. Es war einfach da. Ein Gefühl, eine Ahnung. Die Luft hatte sich verändert. Sie war drückender, zum Schneiden dichter. Sie roch fremd, schmeckte anders. Ein beißendes Aroma traktierte seine Riechzellen. Ein fauliger Geschmack legte sich auf seine Zunge. Schwefel. Frank kannte diesen Geruch. In der Schule hatten sie damit experimentiert. Doch hier hatte er es noch nie gerochen. Frank witterte etwas Finsteres. Ein ungutes Gefühl stieg in ihm auf. Das Gefühl, er wäre nicht alleine in der Dunkelheit der Nacht. Doch, als er sich umsah, stand er einsam auf dem Flur.
Frank betrat sein Zimmer. Das silberne Mondlicht schien durch das blanke Fenster. Der reflektierte Schein des Erdtrabanten stand Annas Nachtlicht in puncto Helligkeit kaum nach. Zum Schlafen bereit, streckte er unter Gähnen seinen Körper in voller Länge aus. Mit einem Schwung schlug er die schwarze Decke auf seinem von einem grauen Metallgestell umrandeten Bett zurück. Geschmeidig ließ er sich auf das weiße Laken gleiten und legte seinen Kopf auf dem ebenfalls schwarzen Kissen ab. Dann drehte er sich. Frank war ein Bauchschläfer. Weder Seite noch Rücken fand er bequem.
Seine Gedanken wanderten wieder zu seinem Vater. Er hatte nicht viele Erinnerungen an ihn. Jedoch wusste er noch, dass David ebenfalls gerne auf dem Bauch schlief. Als er jünger war, sprang Frank seinem Vater mit Vorliebe auf den Rücken, um ihn am Morgen zu wecken. Sie spielten und rauften anschließend im Bett, bis sie zum Frühstück gerufen wurden. Lebhaft erinnerte sich Frank an den vollen braunen Bart, den sein Papa im Gesicht trug. Gerne vergrub er seine kleinen Finger darin und hielt sich an den Haaren fest. Frank genoss die Zeit mit seinem Vater.
Er dachte an die Erzählungen über David. Seine Großmutter hatte ihm viel über seinen Vater erzählt. Nachdem er verschwand, erfuhr Frank einzig von seiner Oma Einzelheiten über ihn. David und Frank hatten eine besondere Beziehung zueinander. Eine Verbindung, wie nur Vater und Sohn sie teilten. Als Vater hatte er ein Gespür dafür, wie Franks Befinden war. Auch wenn der kleine Junge noch kaum sprach. Selbst wenn er nicht bei seinem Sohn war. Als Vater wusste er genau, wann sein Sohn ihn brauchte. So merkte er es, dass Frank eine Krankheit ausbrütete, noch bevor das Kind es tat. Er war immer zur Stelle. Wie ein Superheld ohne Kostüm. Bis er eines Tages nicht mehr kam.
Frank seufzte leise. Je länger sein Vater fort war, desto öfter dachte er an ihn. Immer wieder begegnetem ihm Bilder, Geräusche oder Gerüche, die ihm einen kleinen Augenblick den Eindruck vermittelten, David wäre bei ihm. Wenn die anderen Kinder aus der Schule abgeholt wurden, starrte er oft hoffnungsvoll auf das Eingangstor. In der Erwartung, dort seinen Vater zu sehen. Mit seinem beruhigenden Lächeln würde er auf ihn warten. Ihm einen Kuss auf die Stirn geben und mit ihm nach Hause fahren. Doch Tag für Tag wartete Frank vergeblich.
Gerade jetzt hätte er seinen Vater gebraucht. In diesem Moment. In dem das Gefühl eines lauernden Unheils sich noch immer in ihm rekelte.
Von Müdigkeit übermannt schloss er die Augen. Atmete tief ein. Und riss sie wieder auf. Was war das? Dieses Geräusch? Es klang wie das Knarren des Fußbodens. Das Ächzen der Holzdielen ging ihm durch Mark und Bein. Frank lauschte in die Stille. Machte die unheimliche Aura dieser Nacht ihn überempfindlich? Spielte sein Kopf ihm diese Geräusche nur vor? Annas Gerede von ihrem Albtraum spukte mit Sicherheit noch in seinem Kopf herum. Und projizierte fiktive Monster in seine Gedanken. Doch warum spürte er dann erneut diese drückende Luft? Diese Schwere, die ihn plötzlich wieder umgab? Der Geruch von Schwefel schwoll abermals an, wie der Odem des Todes. Einmal mehr ein Knarren. Nein, es war keine Einbildung. Das Geräusch war da. Er war hellwach und hörte ihn. Den hölzernen Boden, der schrie. Jemand war in seinem Zimmer. Die Schritte auf den stöhnenden Dielen verrieten ihn.
»Mama? Anna?«, fragte Frank leise. Doch der Eindringling hüllte sich weiter in Schweigen.
Ein feuchtes Zischen fauchte durch den Raum. Gefolgt von einem Knurren. Definitiv, jemand war in seinem Zimmer. Jemand oder … Etwas.
Ein Schatten legte sich über das Bett, dessen Dunkelheit die Wand zu seinem Kopfende verhüllte. Die Last der Finsternis ließ die Luft noch schwerer werden. Sie erdrückte Frank regelrecht.
Er drehte sich auf den Rücken. Nicht Anna, nicht Mama, es war das Etwas, was dort vor seinem Bett lauerte. Das Erste, was er sah, war die leuchtend weiße Haut der riesigen Gestalt. Dann bemerkte er die glänzenden, spitzen Zähne, welche aus einer weit geöffneten Falte lugten, die sich vom Kinn bis zur Stirn über den gesamten gesichtslosen Kopf zog. Und Frank erkannte, dass Annas Albtraum nie einer gewesen war.
Kapitel 3
Die Feinde
Drei Wochen waren seit dem Entschwinden von Frank vergangen. Noch immer bekam Anna den Anblick nicht aus dem Kopf, welcher sich ihr bot. Die kleinen Blutspritzer an der blassorangenen Wand hinter dem Bett. Das weiße Laken, das in Fetzen über die Matratze hing und wirkte, wie von einem wilden Tier zerrissen. Ihr hallte das Bellen der Hunde in den Ohren, mit deren Hilfe die Suchmannschaften den Ort durchkämmten. Ebenso das Rattern des Polizeihubschraubers, der mithilfe einer Wärmebildkamera die Wälder und Felder absuchte.
Sie erinnerte sich an Kommissar Köster. Den großen kräftigen Mann, mit dem tiefschwarzem Haar, den hellbraunen Augen und der langen Narbe auf der linken Wange, der ihr mit seiner beruhigenden tiefen Stimme Fragen zum Verbleib ihres Bruders stellte. Insbesondere das Rollen des R fiel ihr auf, wenn er sprach. Hörte er ihr zu, schrieb er Notizen auf einem kleinen Block und rieb sich den fein gestutzten Bart, der rund um seinen Mund verlief.
»Hast du Irgendetwas ungewöhnliches gesehen oder gehört? In der letzten Nacht? Oder davor?«, hatte Kommissar Köster sie gefragt.
»Nein!«, fiel Annas Antwort knapp aus.
Sie blickte zurück auf die Schrift aus Asche, auf das ausgeschaltete Nachtlicht, das Knarren und Knacken des Bodens im Flur. Und an die weiße Gestalt. Doch was sollte sie dem Kommissar erzählen? Würde er ihr abkaufen, dass sie davon überzeugt sei, ihr Bruder wäre von einem Monster verschleppt worden? Einem Monster, welches sie bereits vor 10 Jahren heimsuchte.
Anna war bewusst, es würde sich alles verrückt anhören. Vielmehr würde sie sich selber mit solch skurrilen Aussagen verdächtig machen. Und so behielt sie es für sich.
»Hatten du oder deine Mutter Streit mit deinem Bruder gehabt? Weißt du einen Ort, an dem er sich verstecken könnte?« Kommissar Köster bohrte weiter nach.
Anna zuckte mit den Schultern. »Vielleicht bei seinem besten Freund…«
Der Polizist unterbrach sie. »Tom Zier, das haben wir schon überprüft. Dort hält er sich nicht auf. Fällt dir noch etwas anderes ein?«
Sie schüttelte den Kopf.
Anna erinnerte sich, wie ihr ein kalter Schauer über den Rücken lief. Wie sie aus dem Augenwinkel das grelle Weiß der Schutzanzüge sah. Und das Knistern des beschichteten Stoffs hörte. Wie in einem Flashback schossen ihr die Bilder des weißen Monsters in den Sinn. Ließen sie innerlich zusammenzucken. Immer wieder huschten die Männer und Frauen der Spurensicherung durch das Haus, während Anna mit dem Kommissar im Wohnzimmer sprach.
Sie erinnerte sich auch an ihre Mutter, in ihrem weißen Nachthemd mit rosa Punkten. Wie sie gedankenverloren mit glasigen Augen auf ihrem Bett saß, unfähig ein Wort zu sagen. Und an den älteren glatzköpfigen Mann mit der blauen Weste, auf der »Polizeiseelsorge« geschrieben stand, der bei ihr saß.
Natürlich sinnierte sie auch oft über ihren Bruder. Das Lieblingskind ihrer Mutter. Wie Anna es nervte, dass sie Frank immer so sehr verhätschelte. Und ihr im Gegenzug kaum Beachtung schenkte. Lebten sie in einem Märchen, hätte Frank den Part des verwöhnten Prinzen innegehabt, dem jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde. Anna hingegen wäre die ungewollte Stieftochter, die man in das Verlies eines finsteren Turmes gesperrt hatte.
Anna verabscheute es zu sehen, wie sehr Frank es genoss, im Mittelpunkt zu stehen und die Privilegien zu genießen, die sie nie bekommen hatte. Wie oft er sie mit Schimpfwörtern wie »dumme Nuss« oder »blöde Kuh« belegt hatte.
Anna wunderte sich, dass es diese Unerträglichkeiten waren, die ihr am meisten fehlten. Frank brachte Leben in das Haus. Nerviges Leben. Aber es war immer noch besser als die Totenstille, die jetzt einen Großteil der Zeit im Haus herrschte. Anna vermisste sein dreckiges Lachen, nachdem er ihr mal wieder Zahnpasta unter die Türklinke schmierte. Sie trauerte dem Poltern und Donnern nach, wenn er seinen Fußball quer durch die Zimmer des Hauses kickte. Und sie sehnte sich regelrecht nach seinem Motzen, während er versuchte, seine Hausaufgaben zu erledigen.
Seit dem Verschwinden von Frank war Anna nicht mehr in der Schule gewesen. Man hatte sie freigestellt. Zu groß, glaubten die Verantwortlichen, war die seelische Belastung durch das plötzliche Entschwinden ihres Bruders. Doch welche Belastung es für Anna sein würde, alleine mit ihrer Mutter in dem ansonsten leeren Haus zu sein, ahnte niemand. Gepeinigt von der Sorge um ihren geliebten Sohn, kam sie dem Wahnsinn gefährlich nah. Ihr Gemütszustand wechselte willkürlich von katatonischer Starre über rasende Wut, bis hin zu von Krämpfen geschüttelten Heulanfällen. Anna wünschte sich schon fast die fiese, hinterlistige Furie zurück, die ihr zuvor das Leben schwermachte.
»Besser den Teufel, den du kennst, als den Teufel, den du nicht kennst«, sagte ein altes englisches Sprichwort. Wie viel Wahrheit in diesem Satz steckte, erlebte Anna derzeit am eigenen Leib. In ihren Augen war ihre Mutter schon immer ein Miststück gewesen. Aber sie war berechenbar. Jetzt aber war sie zu einem launenhaften Monstrum mutiert, welches mit unvorhersehbaren Anfällen tyrannischer Raserei über Anna herfiel. Hatte sie die Zeit in der Schule auch gehasst, so kamen ihr jetzt die mobbenden Arschlöcher in ihrer Klasse wie das kleinere Übel vor.
Nun stand sie wieder vor dem Tor des grauen, klobigen Gebäudes, an dessen Stirn in großen schwarzen Buchstaben der Name der Schule stand: »Gymnasium Schwarzenburg.«
Anna war bewusst, was sie dort erwarten würde. Sie kannte ihr Dorf. Tratsch war hier wie eine Seuche. Nichts blieb verborgen und jeder der zwölftausend Einwohner war ein offenes Buch. Es wurde gemauschelt und getuschelt. Selbstverständlich immer hinter dem Rücken der anderen. Es wurde sich echauffiert über das Verhalten seiner Mitmenschen, während man selber im vermeintlich Verborgenen das gleiche tat. Jeder war sich sicher, er hätte seine kleinen Geheimnisse. Die Wahrheit war, fast jedes Geheimnis in Schwarzenburg lag unter einer spiegelgläsernen Kuppel. Von innen hatte man das Gefühl, keiner würde es bemerken. Man sah nur sich selbst. Doch von außen gafften alle hemmungslos hinein. Und wenn man jemanden nicht mochte, stecke man ihn unter so eine Glaskuppel. Gemeinsam mit einer Lüge. Gerne verbreiteten die Schwarzenburger Gerüchte und Vermutungen. Ob diese der Wahrheit entsprachen, war zweitrangig. Hauptsache der primitive Vorstadtaffe hatte etwas, über das man sich das Maul zerreißen konnte. Worüber man sich so sehr aufregte, bis das Herz versagte. Wüten war die Volksdroge. Und jeder lechzte nach dem nächsten Schuss. Nach dem großen Skandal, dessen Einzelheiten man in die Stammtischrunde kotzen konnte. So war Schwarzenburg. Und Anna hasste es.
Ihren dunkelgrauen Rucksack geschultert, trat sie langsam den Weg in das Gebäude an. Sie betrachtete ihr Spiegelbild in der großen Glastür am Eingang. Durch das Schwarz ihres Shirts wirkte ihr Oberkörper in der Reflexion wie durchsichtig. Fast unsichtbar. So wie sie sich all die Jahre fühlte. Und bis heute hatte sich nichts dran geändert. Keiner der anderen Schüler würdigte sie eines Blickes beim Eintreten in das Gebäude.
Anna packte den massigen schwarzen Griff der Schwingtür und zog sie auf. Sie kam sich vor, wie der schuleigene Portier, als die anderen Jugendlichen wortlos durch die offene Tür liefen. Wiederholt setzte sie zum Hereintreten an, wurde aber stets abgedrängt.
Mit einem heftigen Stoß schlug etwas auf ihrer Schulter ein. Erschrocken wandte Anna sich um. Und erkannte ihn sofort. Sven hatte ihr mit der Faust einen Schlag verpasst. Eitel wie er war, fuhr er sich mit der Hand durch die kurzen schwarzen Haare. Der Polyester seiner dunklen Bomberjacke knisterte bei jedem Schritt. Anna bemerkte, wie er sie mit dem Blick seiner hellbraunen Augen löcherte. Er war ein großer Kerl, mit breiten Schultern und einer, selbst für einen Mann, schmalen Hüfte. Viele bewunderten Sven für seine enorme Sportlichkeit. Er war einer der bekanntesten Schüler. Nicht, dass ihn jeder leiden konnte. Er war der klassische Mobber, der alle anderen von oben herab betrachtete. Viele sahen in ihm das typische Alphamännchen. Für Anna jedoch war Sven das Musterbeispiel eines Vollidioten. Wenn er sprach, klang es für sie wie das Gebrabbel eines besoffenen Kleinkindes. Und seine Sätze waren ebenso gehaltvoll. Die Größe seines Körpers musste in einer krassen Unverhältnismäßigkeit zur Größe seines Gehirnes stehen.
»Hey Killer«, rief er ihr im Vorbeigehen zu.
Direkt dahinter folgte ihm Nina, die wie immer komplett in Pink gekleidet war. Selbst die Haarspangen, die ihre schulterlangen hellbraunen Haare schmückte, strahlten in einem Neonrosa. Unter ihrer pinken Jacke mit weißem Pelzkragen trug sie ein hautenges rosa Top, welches ihre schlanke Figur und die, für ihr Alter, großen Brüste betonte. Dabei gab das Oberteil den Blick auf ihren Bauchnabel frei. Ihre grünen Augen hob sie mit aufgeklebten Wimpern hervor. Nina war die Oberflächlichkeit in Person. Wer nicht ihrem Ideal von Schönheit entsprach, war es in ihren Augen nicht würdig, mit ihr zu reden. Zusammen mit Sven ergaben sie das perfekte Duo infernale.
»Na, wo hast du deinen kleinen Bruder verscharrt?«, frotzelte Nina im Vorbeigehen und lachte.
Schnellen Schrittes folgte sie Sven und gab ihm einen Kuss. Während die Beiden Hand in Hand fortgingen, drehte sich Nina zu Anna um und reckte ihr den Mittelfinger entgegen.
Da war es wieder. Das Ziehen im Magen. Der Druck im Bauch. Dieser schnürende Knoten im Hals. Es war, als würde ihr Organismus die Schule wie einen Fremdkörper abstoßen. Und ihre Mitschüler waren die Parasiten, welche diesen Fremdkörper bewohnten.
Anna atmete tief durch. Sie kramte mit ihrer Hand in der Hosentasche und zog einen zerknüllten Zettel hervor. Sie faltete ihn auf und ihr Stundenplan kam zu Vorschein. Es war Montag. Das bedeutete, der Tag würde mit Sport beginnen.
Anna musste den gesamten Schulhof überqueren, um zur Sporthalle zu gelangen. Neben anderen Schülern standen Nina und Sven schon dort. Anna trat zwischen den Stämmen der großen Eichen hervor, die den Eingangsbereich säumten. Eine leichte Brise strich durch deren Blattwerk. Leise wie das Flüstern des Windes wehte ein Getuschel durch die Gruppe von Schülern. Verhalten tönte Anna ein Raunen entgegen. Bis Nina das Wort ergriff.
»Ich bin überrascht dich hier zu sehen. Wir dachten du hättest dich bereits erhängt, weil du deinen Bruder umgebracht hast!«
Mit dem trügerischsten Lächeln, das Anna je gesehen hatte, grinste sie ihr entgegen. Wie vom Donner gerührt verstummten alle anderen Mitschüler. Nur Sven, der seinen Arm um Nina gelegt hatte, verfiel in lautes Gelächter.
»Was nicht ist, kann noch werden«, setzte er nach.
Ihr erster Tag in der Klasse und es wirkte, als wäre sie nie weg gewesen. Nicht nur, dass sie Zuhause den Launen ihrer Mutter ausgesetzt war. Kaum war sie wieder in der Schule, schlugen ihr Hohn und Spott entgegen.
Der Groll auf Nina quoll regelrecht aus Annas Augen. Sie fühlte, wie sich Wut in ihrem Bauch anstaute. In ihr brodelte es wie in einem Vulkan. Sie war kurz davor zu explodieren und ihr verbales Magma über Nina zu ergießen.
Immer wieder fragte Anna sich, was sie Nina getan hatte. Was mit der Zeit passiert war. Sie konnte sich nicht erinnern, was sie entzweit hatten. Die beiden Mädchen hatten sich im Kindergarten kennengelernt. Seitdem waren sie beste Freunde. Sie waren unzertrennlich. Hand in Hand erkundeten sie ihre Welt. Es war eine dieser Freundschaften, von der man dachte, sie würden ein Leben lang halten.
Doch heute war nichts mehr von der einstigen Einigkeit zu spüren. Aus Freundschaft wurde Feindschaft. Aus Liebe wurde Hass. Und Anna war es unerklärlich, wie es dazu gekommen war. Hatte es etwas mit Ninas Mutter zu tun? Mit dem Vorfall im Schlafzimmer? Aber Anna trug doch keine Schuld daran – was dort gesagt und getan wurde.
»Guten Morgen liebe Schüler«, tönte es von hinten, unterlegt vom Gerassel eines großen Schlüsselbundes. Herr Wiemann, der Sportlehrer, trat in die Menge und bahnte sich seinen Weg zum Tor der Sporthalle.
»Hallo Anna, schön dass du wieder hier bist!«, sagte er lächelnd, als er sie zwischen den anderen Schülern entdeckte.
Kurz war der Anflug eines Schmunzelns auf Annas Gesicht zu erkennen. Es war das erste freundliche Wort, das sie hörte, seit sie die Schule betreten hatte.
Eine der beiden Neonröhren, welche den fensterlosen Umkleideraum der Mädchen erhellten, durchzuckte ein intensives Flackern. Es verwandelte den Raum in einen Saal voll tanzender Schatten.
Die kleinen hellgrauen Kacheln des Fußbodens wirkten in heftigem Kontrast zu den dunkelbraun lackierten Holzbänken, welche die Wände an drei Seiten säumten.
Anna zog sich in die hinterste Ecke des Umkleideraumes zurück. Sie hängte ihren Rucksack an einen der Metallhaken, welche an einem Gerüst hinter den Bänken angebracht waren. Die dunkelgrüne Farbe war von einem Großteil des Metalls abgeblättert, was vermuten ließ, dass deren Pflege nicht zu den wichtigen Aufgaben des Hausmeisters zählten.
Anna schnürte das zu lang geratene Band ihrer verwaschenen roten Sportshorts zu einer Schleife und stopfte die überhängenden Schlaufen in den Bund der Hose. Hektisch streifte sie sich ihr schwarzes Shirt ab und tauschte es gegen ein Dunkelgraues. Sie war versucht, nicht zu viel von ihrem Körper preiszugeben. Um den anderen Mädchen nicht noch mehr Angriffsfläche für Beleidigungen zu bieten.
Diese waren kurioserweise alle mit sich selbst beschäftigt und achteten weder aufeinander noch auf Anna. Sie war verwundert und dennoch erleichtert. Waren die Mädchen sonst immer erpicht darauf, die Schwachstellen der anderen zu erkennen und gnadenlos offenzulegen, herrschte an diesem Tag eine schon fast meditative Stimmung. Ein Umstand, der Anna mit wohligem Grusel erfüllte.
Sie band sich ihre weißen, mit roten Streifen verzierten Turnschuhe und war bereit für den Sportunterricht. Auf dem Weg zur Tür, welche die Umkleidekabine mit der Sporthalle verband, raffte sie ihre Haare zu einem Pferdeschwanz. Dann verließ sie die Kabine und trat in die Halle. Knallend fiel die schwere Tür hinter ihr ins Schloss.
Nina blickte auf, nachdem Anna den Raum verlassen hatte.
»Geht an die Türen!«, forderte sie die anderen Mädchen in militärischem Befehlston auf. Diese stellten sich an die beiden Ausgänge, jeweils zum Flur und zur Sporthalle, und hielten diese zu. Nina eilte zu der Ecke, in der Anna ihre Kleidung abgelegt hatte. Sie öffnete ihren Rucksack und durchwühlte ihn vorsichtig.
»Ist Sven schon da?«, fragte Nina.
Die rothaarige lispelnde Lisa, mit der großen Zahnlücke und den krummen O-Beinen, öffnete die Tür einen Spalt.
»Ja, er steht schon da«, antwortete sie in ihrer hohen piepsenden Stimme.
»Ich hab’s!«, flüsterte Nina. Sachte zog sie eine weiße Trinkflasche aus Annas Rucksack. Sie hatte die Form einer langgezogenen Birne, mit einem runden, Knauf ähnlichem Deckel auf dem Hals. Mit der Flasche in der Hand eilte sie zu der Tür, welche zum Flur führte. Lisa öffnete sie. Sven, der ungeduldig dahinterstand, nahm die Trinkflasche von Nina entgegen.
»Beeilt euch!«, forderte Nina.
Sven blinzelte ihr mit dem linken Auge zu. Dann verschwand er in der Umkleidekabine der Jungen.
Mit schallendem Ploppen knallten die Fußbälle gegen die Wände, welche die ersten Jungs in Sporthalle durch die Gegend schossen. Immer wieder hörte man ein lautes Klatschen, gefolgt von einem schmerzverzerrten Stöhnen, während die Jugendlichen sich gegenseitig mit harten Schüssen traktierten.
Anna joggte langsam um den mit dunkelgrünem Linoleum belegten Platz. Sie wünschte sich, es würde so bleiben wie jetzt. Nur sie und ein paar Jungen in der Halle. Die meisten Kerle auf der Schule schenkten ihr keinerlei Beachtung. Keiner sprach mit ihr oder sah sie bewusst an. Doch das störte sie nicht. Es war ihr lieber ignoriert zu werden, als die Attacken zu ertragen, welche die Mädchen immer wieder auf sie abfeuerten.
Ein Knall. Heftiger Schmerz durchzog Annas Schädel. Ihr Kopf schlug stoßartig zur Seite. Sie taumelte. Hatte Mühe, sich auf den Füßen zu halten. Langsam sah sie den blauen Fußball wegrollen, der sie getroffen hatte.
»Was läufst du blöd im Weg herum?«, konnte sie dumpf verstehen. Unterdessen verschwamm das Bild vor ihren Augen zu einem Sumpf aus Farben.
Anna ging zu Boden. Sie atmete langsam und tief ein. Starr verharrte sie auf allen vieren. Zögernd schärfte sich ihr Blick. Die dumpfen Geräusche gewannen an Deutlichkeit.
»Ist alles in Ordnung?«
Sanft legte sich eine Hand auf Annas Schulter. Mit noch wackeligen Knien stand sie langsam auf. Klarheit kehrte in ihren Kopf und Kraft in ihren Körper zurück. Sie wandte sich um. Ihr Augenmerk fiel sofort auf das entzückende, von Grübchen umklammerte Lächeln. Gefolgt von einem Blick in die glänzenden, tiefblauen Augen.
»Ja, es geht schon wieder, danke«, antwortete Anna, sich mühselig ein Grinsen abringend.
»Ich bin Ralf«, stellte sich der Junge ihr gegenüber mit den raspelkurzen blonden Haaren vor. Anna wusste, wer er war. Seit Jahren besuchten sie dieselbe Klasse. Doch noch nie hatten sie ein Wort miteinander gewechselt. Und wie Anna jetzt bemerkte, hatte er sie nie wahrgenommen.
Eine kurze Phase der Stille folgte. Noch immer lächelte Ralf ihr entgegen.
»Darf ich fragen, wie du heißt?«
»Anna?«, antwortete sie und ertappte sich bei einem überraschend fragenden Tonfall.
»Das klingt, als wärst du dir nicht ganz sicher.«
Ein breites Lächeln zog sich über Annas Gesicht.
»Doch Anna!«
»Freut mich sehr Anna!«
Es klopfte an der Tür des Mädchenumkleideraums. Lisa klemmte sich die langen roten Haare, welche ihr ins Gesicht hingen, hinter die Ohren und öffnete. Sven stand im Flur, Annas Trinkflasche in der Hand.
»Hey Babe«, begrüßte ihn Nina, als sie auf ihn zuging. »Habt ihr es geschafft?«
»Sie ist randvoll«, antwortete Sven mit einem fiesen Grienen auf dem Gesicht. »Die Jungs haben alle geholfen.«
»Ist außen noch irgendwas dran?«, erkundigte Nina sich angeekelt, bevor sie die Flasche zaghaft mit Zeigefinger und Daumen packte.
»Kevin hatte die Idee sie nochmal abzuwaschen, bevor wir sie euch geben«, beruhigte Sven seine Freundin.
Erleichtert packte Nina die Flasche mit ganzer Hand.
»Das ist ja noch ganz warm!«
Sie begab sich zurück zu Annas Tasche. Behutsam schob sie die Trinkflasche hinein.
»Ich wette, dass ist das Härteste, was sie je gesoffen hat.« Ninas Worte verhallten im Gelächter der Mädchen.
Ein schriller Pfiff gellte auf. In einem hellgrauen Sportanzug mit roten Nähten betrat Herr Wiemann die Sporthalle. Seine große, runde Brille mit dem silbernen Rahmen saß etwas schief auf seiner Nase. Die letzten verbliebenen schwarzen Haare bildeten einen Kranz um den ansonsten kahlen Kopf. Er war ein großer, schlaksiger Mann, dessen Arme zu lang für seinen Körper wirkten.
»Zum Aufwärmen eine Partie Völkerball«, rief der Lehrer in die Runde. »Nina, Anna, ihr wählt die Teams. Anna, du fängst an.«
Verunsichert und verloren stand Anna mitten in der Halle. Nie war sie in der Position, die Mannschaften im Sportunterricht zu wählen. Im Gegenteil. Sie war immer die Letzte, die übrigblieb. Und selbst dann stritten sich die Teamkapitäne darum, sie nicht in ihr Team nehmen zu müssen.
»Anna, du stellst dich links an die Wand. Nina, du rechts. Und fangt an«, forderte Herr Wiemann.
Annas Atem wurde schwerer. Beim Weg zum Rand der Halle, wirkten ihre Füße wie aus Blei. Sie, die sonst keine Beachtung fand und für die das größte Kompliment komplette Ignoranz war, sollte plötzlich über die anderen Schüler bestimmen. Anna ließ ihren Blick durch die Halle schweifen. Alle Augen waren auf sie gerichtet. In Erwartung, dass sie den ersten Namen ausrief. Im Gewirr der bunten Sportkleidungen, deren Farben selbst einen Regenbogen blass aussehen ließen, entdeckte sie ihn wieder. Ralf. Er Stand dort, noch immer sein Lächeln aufgesetzt. Nickte ihr aufbauend zu.
Dann fiel Annas Blick auf Nina. Die am anderen Ende der Sporthalle ungeduldig ihre mit pinkem Lack überdeckten Fingernägel betrachtete und wartend mit dem Fuß wippte. Sie erkannte ihre Chance. Nina würde es nicht kommen sehen, denn keiner in der Klasse wagte es sich gegen sie zu stellen. Doch Anna hatte nichts zu verlieren. Im Gegensatz zu Nina.
»Sven«, schrie Anna durch die Halle.
Atemlose Stille trat ein. Niemand bewegte sich. Nur der Hall des Namens, den Anna rief, klang bedächtig aus. Die erstaunten Augen der Schüler wechselten zwischen Anna und ihrer Kontrahentin. Nina wandte ihre Aufmerksamkeit von den Fingernägeln ab und warf Anna einen vernichtenden Blick zu. Niemand hatte es zuvor gewagt, sie und ihren Sven zu trennen. Wüsste man nicht, dass die beiden ein Paar waren, hätte man sie fast für siamesische Zwillinge halten können. Immer nah beieinander, immer im Körperkontakt.
»Sven, geh zu Anna hinüber«, forderte Herr Wiemann, nachdem sich niemand bewegte.
»Nina, du bist dran!«
Mit einem lauten Donnern flog die Tür der Umkleidekabine auf. Wutentbrannt stürmte Nina herein. Drei weitere Mädchen folgten ihr.
Anna schlenderte unterdes durch die Halle und erhaschte einen Blick in die offene Kabinentür. Wie wildgeworden, durchwühlte Nina ihre pinke Tasche.
Herr Wiemann trat an Anna heran.
»Zieht bitte einfach beim Gehen die Hallentür zu. Ich muss schnell ins Lehrerzimmer«, bat er sie.
Mit einem kurzen Nicken antworte sie auf die Bitte ihres Lehrers.
»Und lass dich nicht ärgern«, fügte er beim Betreten der Lehrerkabine hinzu. »Schön, dass du wieder da bist!«
Nun wagte auch Anna den Weg in die Umkleidekabine. Nina und die meisten anderen Mädchen hatten den Raum längst verlassen. Einzig Kim und Paula, zwei wasserstoffblonde »Chicks«, wie sie sich selbst bezeichneten, waren in ein Gespräch vertieft und vergaßen dabei, sich umzuziehen. Die beiden Mädchen sahen sich so ähnlich, dass Anna sie anfangs für Zwillinge hielt. Oft hatte sie sich gefragt, ob bei ihnen dasselbe Phänomen griff, welches man angeblich bei Hunden und ihren Frauchen beobachten konnten. So wie Hund und Halterin sich mit der Zeit immer ähnlicher sehen sollten, so stellte sich Anna vor, dass auch Kim und Paula im Laufe der Jahre eine optische Einheit gebildet hatten. Vermutlich lag der Grund für die Gleichartigkeit der Mädchen nur darin, dass sie sich gleich kleideten und schminkten. So trugen beide kirschroten Lippenstift und hellblauen Lidschatten, der der Farbe ihrer Augen glich. Ihre Kleidung hatte jeden Tag, Anna glaubt nicht aus Zufall, den gleichen Ton.
Als Kim und Paula bemerkten, dass Anna die Umkleidekabine betrat, verstummten sie. Prüfend ließen sie ihre Blicke über sie wandern.
»Na da hast du dir ja was eingebrockt«, spottete Kim.
In ihrem Ton schwangen Arroganz und Schadenfreude mit. Was bei Anna immer wieder das Bedürfnis auslöste, ihr wie ein tollwütiger Puma das Gesicht zu zerkratzen. Aber sie beließ es bei einem gleichgültigen Schulterzucken.