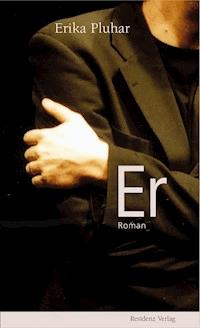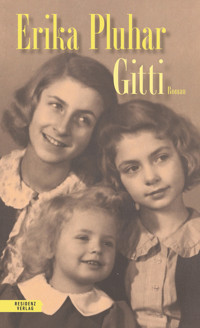Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Kindheit im Ausnahmezustand – eine berührende Geschichte, schonungslos erzählt. Anna ist die Tochter einer Schauspielerin und eines geschäftstüchtigen, machtverliebten, genialischen Designers. Die Eltern stehen im Licht der Öffentlichkeit. Die Familie leidet unter dem exzessiven Lebensstil des Vaters, die Mutter wird vom Schauspielberuf immer intensiver gefordert. Anna verbringt viel Zeit mit häufig wechselnden Kindermädchen, glückliche Familienmomente sind gezählt. Ein gemeinsamer Urlaub auf Mykonos erweist sich für die junge Familie als lebensverändernd, belastet jedoch Annas Kinderwelt noch einschneidender … Erika Pluhar beschreibt eine Kindheit im Ausnahmezustand. Einfühlsam, offen, schonungslos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Pluhar
Anna
Eine Kindheit
Bibliografische Information der Deutschen BibliothekDie Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2018 Residenz Verlag GmbH, Salzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
Lektorat: Isabella Suppanz
ISBN eBook 978 3 7017 4584 5
ISBN Print 978 3 7017 1701 9
Gezeugt wurde sie in einem Schloß. Man nannte es sogar ›das weiße Schloß‹, im Gegensatz zum ›roten Schloß‹, das es in diesem Ort ebenfalls gab. Zusätzlich befand sich eine Burg in nächster Nähe. Es war also eine zwar dörfliche, aber dennoch illustre Umgebung gewesen, die ihre Eltern dazu angeregt hatte, ein Kind ins Leben zu rufen. Die Mutter hatte ihrer Tochter oft davon erzählt. Von der altertümlichen Schönheit des weißen Schlosses, von dem großen, schweren Schlüssel, der in einer Steinvase lag, wenn sie nachts ihr Zimmer aufsuchte. Von den dunklen Gängen dorthin, sie mußte vorbei an ebenfalls dunkel vergilbenden Gemälden, es waren Porträts, aus denen Augen aus ferner Vergangenheit angsteinflößend auf sie herabzublicken schienen. Dann endlich das große Eckzimmer, dessen Fenster in den nächtlichen Park hinausführten. Sanftes Licht aus Lampen mit Seidenschirmen, ein riesengroßes, weißes Bett, von gedrechselten Säulchen flankiert. Ja, und dort sei es dann eben geschehen. Der Liebhaber und spätere Vater des Kindes hatte sie am Ende ihrer Theaterarbeit abgeholt, freudig gab sie sich ihm in diesem großen, weißen Bett hin, und bereits als sie gemeinsam weiterreisten, sei ihr ständig leicht übel gewesen.
Die Mutter war Schauspielerin. Knapp nach der Schauspielschule bereits am Burgtheater in Wien als Elevin engagiert, hatte sie bei diesen sommerlichen Burg-Festspielen in Goethes »Götz von Berlichingen« die Rolle der Adelheid angeboten bekommen und dann auch gespielt. Es war ihr erster beruflicher Ausflug ins deutschsprachige Nachbarland gewesen. Wie man auf die Idee gekommen war, die junge Wienerin dorthin zu holen, hatte die Mutter bereits vergessen, als sie davon erzählte. Jedenfalls sei der exzentrische ehemalige Kunststudent, der jetzt Brillenfassungen entwarf und sie zum ersten Mal mit dem Begriff ›Designer‹ konfrontiert hatte, mit seinem weißen, offenen Jaguar aus Österreich angebraust gekommen und als Ereignis in das Dorf eingefallen. Dorfbewohner, Bühnenkollegen, Burgherren, alles staunte, und die junge Schauspielerin wurde ob dieses Verehrers teils bewundert, teils belächelt. War er doch klein gewachsen, jedenfalls einen Kopf kleiner als die große, schlanke Mutter. Aber sein stämmiger Körper war wendig, ein blonder Lockenkopf milderte die kräftigen Gesichtszüge, und sein Lächeln, seine originelle Art sich auszudrücken bezwang letztlich alle. Vor allem eben die Mutter selbst, die mit unsicheren Gefühlen diesem Mann gegenüber aus Wien weggefahren war. Aber hier, zwischen Dörflichkeit und Adelswelt, zwischen Freilichttheater und Schloß, hier lernte sie einen Menschen kennen, der sie berührte. Sie verliebte sich endgültig. Und ihr Körper sprach das so sehr aus, daß sofort ein Kind empfangen wurde. Ein Kind der Liebe. Das sei sie gewesen, betonte die Mutter immer wieder, ein Kind der überraschendsten und ergreifendsten Liebe, die man sich vorstellen könne.
Völlig benommen von diesem sie plötzlich so gänzlich erfüllenden Empfinden war sie neben dem Designer in seinem offenen Wagen gesessen. Er mit einer russischen Pelzmütze, sie mit einem Kopftuch gegen Wind und Wetter geschützt, so fuhren sie auf endlosen Straßen bis nach Schweden. Stockholm sollte die Mutter ihr Leben lang als eine Stadt in Erinnerung behalten, in der eine ständige Übelkeit mit Brechreiz nicht abzuschütteln war. Sie hätte es anfangs auf die nördliche Witterung und die bei jeder Mahlzeit servierten Fischgerichte geschoben, sich jedoch allmählich darüber zu wundern begonnen.
Der Designer hatte als Student lange in Schweden gelebt und war dort unter anderem sogar als Leichenwäscher tätig gewesen, um in Wien sein Studium zu finanzieren. Einer seiner Brüder aber blieb dort vorübergehend wohnhaft, und den hatten sie besucht. Mehrmals und immer wieder erzählte die Mutter der Tochter von dieser Reise, erzählte, daß sie dort in Schweden, anfangs ungläubig und erstaunt, schließlich aber mit aller Entschiedenheit auf das Leben des Kindes in ihrem Leib hingewiesen worden sei. In Wien zurück, genügte der Besuch beim Frauenarzt, es zu bestätigen.
Und sie hatte sich darüber gefreut. Nicht, weil sie gern schon Mutter sein wollte, im Gegenteil, dieser Gedanke war ihr noch nie gekommen. Hatte sie doch gerade erst als Schauspielerin ein wenig Fuß gefasst und liebte diesen Beruf. Aber auch diesen Mann liebte sie, und so hatte sie sich auf romantische Weise darüber gefreut, gerade von ihm ein Kind zu erwarten. Man konnte damals noch nicht im voraus feststellen, welchen Geschlechts es sein würde, aber er wünschte sich ein Mädchen.
Sie kam an einem achten Mai zur Welt.
Das war um einiges später, als vorhergesagt worden war. Die Mutter erzählte von ihrem schweren, stark hervorgewölbten Leib, auch Fotos gab es aus dieser Zeit, die die Tochter später betrachten konnte. Noch während der Schwangerschaft war aber auf Wunsch der Anverwandten und weil es sich damals so gehörte, die Heirat der Eltern vollzogen worden. Ohne viel Aufwand, nur standesamtlich, ein Geschäftsfreund des werdenden Vaters und der Portier des Amtes seien die Trauzeugen gewesen. In der Konditorei Demel hatten sie zur Feier des Tages Apfelstrudel mit Schlagobers verzehrt, und die Mutter war später allein nach Hause gegangen, um weiterhin, auch meist allein und sich selbst überlassen, dieses Kind zu erwarten.
Aber es wollte und wollte nicht erscheinen. Nach einem vergeblichen Spitalsbesuch, der nochmaligen Rückkehr in ihre Wohnung, hatte der Kindesvater sie kurzerhand einen ganzen Tag lang zu Fuß kreuz und quer durch die Stadt geschleppt und sich nachts neben sie gelegt. Und irgendwann war tatsächlich die Fruchtblase geplatzt, das Bett feucht, und die Mutter per Sportwagen in die Klinik verfrachtet worden. Die Wehen hatten eingesetzt, in den frühen Morgenstunden wurde das Kind geboren.
Sofort, noch im Kreißsaal, hatte die Mutter nach einem Telefon verlangt und dem Kindesvater mit leuchtender Stimme mitgeteilt: »Es ist ein Mädchen!«
Er war es, der seiner Tochter später mehrmals diese Stimme der Mutter beschrieb, er sei davon tief beeindruckt gewesen und in Tränen ausgebrochen.
Aber nach einem kurzen Besuch in der Klinik, einen riesigen Strauß roter Rosen herbeischleppend, das Baby mit männlichem Stolz ins Auge fassend und die noch geschwächte Wöchnerin hochlobend, ward er nicht mehr oft gesehen. Er war ständig unterwegs, notorisch getrieben und unstet, eine Konstante seines Wesens, die die Mutter jetzt erst erfuhr.
Mit dem Säugling war sie erschöpft und allein in ihre eigene dunkle Innenstadtwohnung zurückgekehrt. Eine alte, bäuerliche Kinderfrau, die er von irgendwoher kannte, hatte der Ehemann ihr jedoch zur Seite gestellt. Diese kam in der ersten Zeit täglich zu Mutter und Kind, legte nach ländlicher Sitte ein hellkariertes Kopftuch niemals ab und versorgte das Neugeborene mit wissenden Händen. Wenn diese Frau Maria bei ihnen hätte bleiben können, wäre vielleicht alles harmonischer verlaufen, befand die Mutter, als sie von dieser ersten Kinderfrau erzählte. Denn der Vater hatte sich ab nun nicht mehr sonderlich an seiner neuen Familie interessiert gezeigt. Diese Kränkung und die plötzliche Mutterschaft überforderten und schwächten sie, nur die alte Frau war der Mutter in dieser Zeit zu einer Stütze geworden, zu einem Quell von Wärme und Ruhe. Und auch sie, Anna, hatte sich in dieser kurzen Zeit als ruhiger und zufriedener Säugling erwiesen.
Anna.
Diesen Namen hatte sie von ihren Eltern sofort nach der Geburt erhalten. Obwohl damals eher abschätzig als altmodisch befunden und kaum je gewählt, bestand die Mutter darauf. Und der Vater umkränzte ihn noch pompös, er benannte seine Tochter stolz: Anna Katharina Nastassja! Die Mutter widersprach nicht, wie sie dem Mann ja fast nie widersprach, nannte ihr Kind jedoch stets nur schlicht und einfach Anna. Es sei der schönste Name auf Erden, betonte sie immer wieder, er enthielte Unendlichkeit, endloses Anfangen und Enden.
Obwohl Annas Geburt problemlos verlaufen war, kam es zu Komplikationen, als die junge Mutter bereits daheim war. Die Blutungen wollten nicht enden, und der Arzt wurde unsicher. In einem von Nonnen geleiteten Spital nahm er eine Ausschabung vor. Die Mutter hatte niemandem etwas davon gesagt, weil sie meinte, nach diesem, wie vom Arzt erklärt, ›Routineeingriff‹ ohnehin gleich wieder in ihre Wohnung zurückkehren zu können. Stattdessen jedoch strömte nach der Operation weiterhin Blut aus ihr und tränkte die Bettwäsche. »Die Nonnen haben mich deswegen beschimpft«, erzählte die Mutter. Anna erfuhr mehrmals und mit diversen Ausschmückungen vom ruhmreichen Geschehen, das dem folgte: wie der Vater – nachdem die Mutter eine Nonne mit Geld hatte bestechen müssen, ihn anzurufen – als machtvoller Held aufgetaucht war, die blutende Frau mit starken Armen aus dem Bett gehoben, sie aus dem Krankenzimmer und zum Auto getragen und nach Hause zurückgebracht hatte.
Dort allerdings sei es dann jedoch weitaus weniger ruhmreich zugegangen, ein Ärztekonsilium wurde einberufen, und die Mutter erhielt Medikamente, die alles versiegen ließen, ihre Blutung, aber auch das Fließen der Muttermilch. Der winzige Säugling mußte also allzu früh und abrupt auf Flaschennahrung umgestellt werden.
Trotzdem sah Anna später Fotos, auf denen eine schmal gewordene Mutter sich über ihr wohlgenährtes Baby beugte, lächelnd, mütterlich, hübsch geschminkt, ja, es waren hübsche Bilder.
Anna wurde von Beginn an viel fotografiert, stets zusammen mit der Mutter, und diese Fotos kursierten oft in Zeitungen. Der Vater liebte Öffentlichkeit in jeder Form, und er hatte schließlich eine junge Schauspielerin geheiratet. Also ließ er sich nicht lumpen und bugsierte diese so oft es ging ins Rampenlicht, vorrangig in das der Boulevard-Presse, wo Meldungen in der Art von ›Weiblicher Jung-Star mit reizendem Kind‹ bevorzugt wurden. Der Mutter gefiel das nicht wirklich, wie sie ihrer Tochter später gestand, aber sie fügte sich.
Davon abgesehen lag Anna gut genährt, heiter und ahnungslos in fürsorglichen weiblichen Händen. Es waren vornehmlich die der alten Kinderfrau, denn die Mutter, unerfahren, matt, oft bettlägerig, überließ ihr den Säugling, wann immer es ging. Die ihr für eine Weile aufgezwungene berufliche Untätigkeit und das Vermissen des selten erscheinenden Kindesvaters taten das Ihre, die junge Schauspielerin melancholisch und antriebslos werden zu lassen. Aber es herrschte Frieden in der dunklen Stadtwohnung, Frieden umgab das kleine Mädchen. Ohne Aufruhr verliefen die ersten Monate seines Lebens.
Bis eines Tages die alte Kinderfrau von ihrer Familie mit aller Strenge in das heimatliche Dorf zurückgerufen wurde. Sie sei schließlich selbst Großmutter, ihre eigenen Enkelkinder bräuchten sie, hieß es, warum dort in der Stadt weiterhin einen fremden Säugling betreuen!
Also mußte schweren Herzens Abschied genommen werden. Die alte Frau selbst sei überaus betrübt gewesen und mit Tränen in den Augen fortgegangen, erzählte die Mutter. Sie erzählte von diesem Geschehen, wie man von einem nicht wiedergutzumachenden Unglücksfall berichtet. Und das war es wohl auch, denn die Kindermädchen und Kinderfrauen, die Anna nachträglich zu versorgen hatten, erwiesen sich weitgehend nicht als Glücksfälle.
Annas bewußt wahrgenommenes Leben begann, nachdem man aus der Innenstadtwohnung am Kohlmarkt ausgezogen und in eine Zimmerflucht in der Weyrgasse im dritten Bezirk übersiedelt war. Hier entstanden ihre ersten Erinnerungsbilder.
Der Vater hatte diesen Umzug letztendlich bestimmt. Wenn schon Familie, dann in großem Stil, befand er. Ausschließlich nach seinen Wünschen wurden die hohen Räume der neuen Wohnung in dunklem Weinrot, Aubergine oder Ocker gestrichen, schwere, goldene Bilderrahmen, meist ohne ein Gemälde zu beinhalten, zierten die Wände. Er folgte auch hier seinen eigenen verwegenen Vorstellungen, die jedoch keinerlei Wohnlichkeit für ein kleines Kind erschufen. Die Mutter bemühte sich am Rande dieser düster gestalteten Pracht um eine freundlichere Umgebung für ihr Kind, einen kleinen Hort der Geborgenheit, in dem auch sie selbst sich vielleicht ein wenig geborgen fühlen konnte. Diese riesige Wohnung hätte sie immer erschreckt, gestand sie Anna später.
Nun befanden sich hinter der riesigen Küche mit altem, gekacheltem Herd zwei kleine Räume, die ehemals den Dienstboten zugedacht gewesen waren. Einer davon wurde als Kinderzimmer eingerichtet, daneben wurde das jeweilige Kindermädchen untergebracht. Anna sollte in einem überschaubareren Lebensbereich Kind sein dürfen. Sie schlief in einem weißlackierten Bett, das goldene Krönchen verzierten, und an der Wand neben ihr hing das ehrwürdige Gemälde eines großen Hundes. Der würde sie beschützen, sagte die Mutter.
Denn die kleine Anna schien des Schutzes zu bedürfen. Schon ihre ersten Lebenserinnerungen hatten wenig mit unbeschwerter kindlicher Wahrnehmung zu tun, sehr rasch fühlte das Kleinkind hinter dem hellen Augenschein dunkel Bedrohliches und Traurigkeit. Sie erinnerte sich zwar an ein junges, rotbackiges Kindermädchen, das sie fröhlich umsorgte, allem Anschein nach fehlte es ihr an nichts. Aber eine vertrauensvoll vorhandene, sie herzende Mutter fehlte. Nie vergaß Anna ein nächtliches Erwachen in ihrem Bett, die rosa Nachttischlampe brannte, und neben ihr saß die Mutter und weinte. Leise liefen Tränen über ihr Gesicht. Rasch schloß das Kind Anna seine Augen wieder und tat so, als schliefe es.
Als die Familie sich in der großen Wohnung niedergelassen hatte, begann die junge Schauspielerin allmählich wieder ihrem Beruf nachzugehen. Der Vater hingegen tauchte nach wie vor selten bei seiner Familie auf, er war irgendwo in der Stadt unterwegs oder auf Reisen. Wenn also nicht am Theater tätig, blieb die Mutter zu Hause meist allein sich selbst und ihrem Kind überlassen. Sie fühlte eine Welle von Traurigkeit, wenn sie sich über die kleine Anna beugte, sie hochnahm, fütterte oder zu ihr sprach.
Das neue Kindermädchen hieß Hildegard und bezog das Zimmer nebenan. Jung und unbekümmert tat es alles mit leichter Hand, war oft ein wenig nachlässig und ganz sicher nicht die perfekte Betreuerin. Ihre Frische jedoch hob sich wohltuend von der Gemütsverfassung der Mutter ab, bei Hildegard war es Anna so, als würde sie von einer stets gut gelaunten, älteren Schwester umsorgt.
Das Mädchen reiste auch mit ihnen, als die Mutter beschloß, mit ihrer kleinen Tochter einen ganzen langen Sommer in Kärnten zu verbringen. Sie logierten im Anwesen einer befreundeten Schauspielerin namens Angelika, die dort zur Aufbesserung ihres Lebensstandards auch Urlaubsgäste beherbergte. Die körperlichen Schwierigkeiten nach Annas Geburt und die allzu baldige Wiederaufnahme ihrer Theaterarbeit hatten die Mutter nicht wieder zu Kräften kommen lassen, sie war sehr dünn geworden und litt unter ständiger Müdigkeit. Erholung tat not. Außerdem war Angelikas ebenfalls anwesender Ehemann, ein bekannter Internist, darum bemüht, die erschöpfte Schauspielerin kraft eines ausgeklügelten Ernährungsplanes wieder aufzupäppeln.
Während also die Mutter in diesen Sommerwochen viel für sich blieb und ruhte, war meist Hildegard an Annas Seite. Sie schliefen gemeinsam in einem der hübsch eingerichteten Zimmer, vor dem Zubettgehen tollten sie vergnügt herum, und auch am Morgen herrschte sofort wieder gute Laune. Diese unbeschwerte Gemeinsamkeit ließ Anna aufleben. Wohl auch, weil sie die Mutter nachts im Nebenzimmer wußte, ihr ganz nah. Und tagsüber gab es ja ebenfalls mütterliche Nähe, bei den Mahlzeiten etwa, oder auf einem Spaziergang zu zweit. Und vor allem entfernte die Mutter sich nie gänzlich, sie war nie bei einer Vormittagsprobe oder Abendvorstellung, also weit weg, in dieser unbekannten Welt des Theaters. Anna fühlte sich hier keinen Augenblick zurückgelassen, auf ewig verlassen, ein Gefühl, das sie aus der großen düsteren Wiener Wohnung nur allzu gut kannte. Deshalb war sie zufrieden und glücklich in diesem Sommer, den sie zwischen hochstehenden Wiesen und weiten Waldungen in Angelikas Landhaus verbrachten, sie erlebte hier eine kurze Zeit schattenlosen Kindseins.
Auch die Besuche eines jungen Mannes, der ab und zu nachts vor dem Fenster des Kinderzimmers stand und Einlaß begehrte, empfand sie als etwas, das zu diesem Sommer zu gehören schien. Der etwa vierzehnjährige Sohn Angelikas, der Claudius hieß und Claudi gerufen wurde, hatte sich unsterblich in Hildegard verliebt. Daß seine Mutter diese frühe Liaison, noch dazu ›mit einem Dienstmädchen‹, als äußerst unangenehm und unpassend empfand, erfuhr die kleine Anna ja nicht, und daß die zwei jungen Menschen sich neben ihrem Bettchen küssten, oder vielleicht sogar liebten, tat ihrem tiefen und festen Schlaf keinen Abbruch. Sie war fröhlich und gesund in diesem Sommer.
Auf dem Anwesen gab es auch einige Pfauen. Deren seltsame Laute, ihr majestätisches Stolzieren und die großen Räder aus Gold und Türkis, die sie aus ihrer Federschleppe hochschlagen konnten, all dies begeisterte Anna. Aber trotz ihrer Begeisterung hielt sie sich von diesen seltsamen, großen Vögeln fern, nur in gebührendem Abstand zu ihnen hockte sie oft im Gras und beobachtete sie.
Es war eine Zeit friedlicher Stunden. Die Mutter saß nicht weit von ihr entfernt neben dem Arzt in der damals üblichen, blumengemusterten ›Hollywoodschaukel‹. Sie schwangen leise plaudernd hin und her, im Haus hörte man Angelika telefonieren oder in der Küche Befehle erteilen, Hildegard lehnte am Fenster des ebenerdigen Kinderzimmers und schäkerte mit Claudi, der Sommer wölbte sich warm und blau, die Wiese um Anna duftete, sie sah den Pfauen zu und war mit sich und ihrem Kinderleben zufrieden.
Nur wenige Male kam der Vater vorbei, er fiel sofort auf ein Bett und schlief übermüdet ein. Meist blieb er dann auch nur eine Nacht. Anna hörte die Stimmen aus dem Zimmer der Eltern und war erleichtert, wenn der Vater mit seinem Sportwagen am nächsten Morgen wieder davonsauste, die Mutter neuerlich allein blieb und die friedvolle ländliche Stille zurückkehrte. Bei diesen kurzen Besuchen kümmerte sich der Vater auch kaum um seine kleine Tochter, ein knappes Tätscheln, ein »Na, du bist ja schon ordentlich g’wachsen!«, nicht viel mehr. Anna lernte den Vater aus der Ferne zu betrachten wie einen ihrer Pfauen. Aus der Ferne beeindruckte er sie auch wie ein schillernder, räderschlagender Pfau, und ebenso erfüllte es sie auch stets mit leiser Angst, wenn er ihr näher kam.
Anna genoß in dieser sommerlichen Zeit das Genesen der Mutter. Sie fühlte ihre Erholung, den Atem ihrer Gegenwart, sobald der Vater wieder davon war. Und unauslöschlich in Erinnerung blieb Anna ein Lied, das die Mutter und Angelika gemeinsam immer wieder zu einer Schallplatte, oder auch völlig frei, mit stets verzückt schimmernden Augen trällerten: »Überall blühen Rosen – überall blühen Rosen – überall blühen Ro-o-sen für Dich – –«
Zurück in Wien, nahm alles wieder in unveränderter Form seinen Lauf. Zwar blieb Hildegard noch eine Weile bei Anna in der Weyrgasse, gemeinsam spazierten sie an so manchem Nachmittag durch den Prater, dort, wo es Alleen, Laub, Rasenflächen und gesundheitsfördernden Abstand zur staubgetränkten Stadtluft gab. Aber das Kindermädchen wurde langsam zur jungen Frau, und sich ständig an der Seite eines Kindes zu befinden, geriet ihr zur Langeweile. Immer lustloser erfüllte Hildegard die unerläßlichen Pflichten und sehnte sich gleichzeitig nach dem großen Abenteuer. Das Kind spürte ihr Abstandnehmen und vermisste wieder die Nähe der Mutter.
Am Burgtheater hatte eine neue Saison begonnen, der Betrieb voll eingesetzt. Die junge Schauspielerin erhielt größere Rollen, mußte schwierige Aufgaben meistern, sie arbeitete hart und wirkte zu Hause meist nur müde, wie erloschen. Diese Rosen, die sie im Sommer besungen hatte, schienen für sie nicht zu blühen.
Anna wartete stets sehnsüchtig darauf, einige Stunden gemeinsam mit der Mutter verbringen zu können. Etwa bei einem schlichten Abendessen am Küchentisch, wenn keine Vorstellung lief. ›Spielfrei‹ hieß das, rasch erlernte Anna dieses Wort. Oder bei einem gemeinsamen Besuch der Großeltern, die jenseits der Donau lebten, in einer bescheidenen, aber hoch gelegenen Wohnung mit Balkon.
Da gab es die Omi, die umarmte, küßte und viel seufzte, und es gab den Opi, der stets heiter blieb und mit seinem Taschenmesser für Anna Spazierstöckchen schnitzen konnte. Beide waren sie stolz auf die schauspielerischen Erfolge ihrer Tochter, und sie liebten natürlich die kleine Enkelin Anna. Den Kindesvater aber betrachteten sie mit Argwohn. Ihrem elterlichen Spürsinn entging nicht, daß er Frau und Töchterchen nicht glücklich machte, daß etwas Dunkles, Bedrohliches über dieser Ehe lag.
Doch sie bemühten sich, Tochter und Enkelin ungetrübte Stunden zu schenken, man aß Schnitzel mit Kartoffelsalat und man unternahm Spaziergänge unter den Bäumen des Spitzer-Parks. Die Schauspielerin erzählte viel vom Theater, wenig vom Kindesvater, und ließ sich ihr Unglück nicht anmerken. Und Anna faßte von Anfang an eine ganz besondere, innige Zuneigung zum ›Opi‹.
Auch zu den Großeltern väterlicherseits stellte sich bald ein liebevolles Verhältnis ein, vor allem zur ›Omaliese‹, wie Anna diese Großmutter, die Anneliese hieß, sehr bald nennen sollte. Die kam des öfteren aus Salzburg angereist, wo die Eltern des Vaters lebten, und verbrachte einige Tage in der Weyrgasse. Und diese Tage bedeuteten für Anna stets familiäre Geborgenheit und warmes Umsorgtsein. Omaliese selbst, die ihren Sohn Udo ja über alles liebte, war erbost und traurig darüber, daß er nicht Familienvater sein konnte. Auch sie sah und fühlte schwelendes Unglück und bedauerte Enkelin und Schwiegertochter.
Anna hörte Gespräche zwischen ihrer Mutter und Omaliese, die sie zwar nicht gänzlich verstehen konnte, aber mit dem Erfühlen eines Kindes begriff sie Trauer und Tröstung. Begriff, daß die Mutter dankbar war für jeden Beistand, daß sie sich bemühte, verantwortungsvoll ihre Pflichten zu erfüllen, neben denen des Theaterberufes eben auch die einer Mutter.
Als wieder einmal ›Nikolo und Krampus‹ angesagt war, wollte sie für Anna ein ganz besonderes Fest ausrichten. Was aber dazu führte, daß sie allzu wirkungsvolle Darsteller dieser Figuren engagierte. Vor allem einen überaus talentierten, grausig überzeugenden Krampus, einen Teufel mir Hörnern, langer, roter Zunge und wild peitschender Rute. So lebensecht war er, daß Anna zutiefst verängstigt in Tränen ausbrach. Und auch der anschließend sich gütig gebärdende und Geschenke austeilende Nikolaus konnte sie nicht mehr beruhigen. Anna weinte, und die Mutter war hilflos bemüht, sie wieder aufzurichten.
Als die Tochter älter und verständiger geworden war, befand die Mutter, daß ihr auch ein Weihnachtsfest zu Hause geboten werden sollte. Bisher hatten sie den Weihnachtsabend stets bei den Großeltern und stets ohne den Vater verbracht.
Also wurde in einem der hohen Räume der großen Wohnung, zwischen auberginefarbenen Wänden, eine mächtige Tanne aufgestellt. Die Mutter schmückte sie mit Hilfe einer Leiter und Hildegards Handreichungen, befestigte an ihren Zweigen bunte Kugeln, Goldfäden, Kerzen, der Weihnachtsbaum gelang ihr, er sah prächtig aus. Sie hatte Geschenke besorgt und verpackt, alles tagelang vorbereitet. Auch eine erlesene ›kalte Platte‹ ließ sie sich in einem teuren Delikatessenladen zusammenstellen, eine Flasche Champagner stand bereit, und der runde Tisch im Salon war weihnachtlich gedeckt und geschmückt.
Nun erwartete man also den Vater, der sein pünktliches Kommen versprochen hatte, um als Familie diesen ›Heiligen Abend‹ gemeinsam zu begehen. Aber es wurde später und später und der Vater erschien nicht. Anna sah Traurigkeit in der Mutter hochsteigen, die sich zwang, nicht zu weinen und ihrer Tochter trotzdem Weihnachten vorzuspielen. Sie tat schließlich selbst, was der Vater versprochen hatte, für sie beide zu tun. Sie ließ das Kind im Korridor warten, ging voraus ins Weihnachtszimmer und zündete am Baum alle Kerzen an. Dann öffnete sie die Tür. Anna trat ehrfürchtig ein, stand bewundernd vor dieser Pracht, diesem Leuchten in dem sonst so düsteren Raum, und begann dann eifrig ihre Päckchen aufzuschnüren.
Bis plötzlich ein betrunkener Vater hereinstürmte, böse lachend etwas vom ›Weihnachtsschmaus‹ lallte und drei tote Fische unter den Tannenbaum warf.
Da erlebte Anna ihre Mutter so aufgebracht und verzweifelt wie noch nie zuvor. Laut aufweinend und völlig außer Fassung riß sie ihre kleine Tochter an sich und verließ mit ihr die Wohnung. Sie stolperten durch das Stiegenhaus, standen bei bitterer Kälte frierend auf der Straße herum, bis ein zufällig vorbeikommendes Taxi sie beide aufnahm und zu den Großeltern nach Floridsdorf brachte.
Dort herrschten Wärme, Kerzenschein und der Geruch nach Gebackenem. Als Überraschung und Bestürzung sich etwas gelegt hatten, gab es Umarmungen, heißen Tee und Wolldecken. Später Worte des Trostes, jedoch immer wieder unterbrochen von lautstark geäußerter Empörung über einen so furchterregenden Mann an der Seite dieser zwei armen Wesen, die an einem Weihnachtsabend bei ihnen Zuflucht suchen mußten!
Von elterlicher Liebe umfangen, weinte die Mutter lange und haltlos, sie weinte sich aus. Anna beobachtete. Sie sah einen Schmerz, der ihr bislang so ungeschützt nicht gezeigt worden war.
Später, als sie reichlich Kekse gegessen hatte und ihr die Augen zufallen wollten, legte man sie in das Ehebett der Großeltern. Fest eingepackt in warme Decken, hörte sie nebenan das Aneinanderklingen von Weingläsern und weiterhin leises Klagen und tröstende Worte. Es wiegte sie in den Schlaf.
Solange Mutter und Vater zusammenlebten, gab es kein Weihnachtsfest in der Weyrgasse mehr. Immer wurde bei den Großeltern gefeiert, in Wien oder in Salzburg. Der Vater war selten dabei, er kam höchstens mit Geschenken bepackt ein Stündchen vorbeigeflitzt. Wie er ja stets, zu jedem Anlaß, zu jeder Verabredung, zu spät erschien, dann alle Aufmerksamkeit an sich riß, nur kurz blieb und eilig wieder verschwand. Nichts schien ihn mehr zu quälen als ein Irgendwo-Bleiben-Müssen, es trieb ihn aus jeder Nähe, jedem Aufenthalt, nach kürzester Zeit davon und weiter. Die Liebe seiner Frau hing an ihm als Gewicht, mit der kleinen Tochter wußte er nichts anzufangen, und seine Sucht nach Frauen mußte trotz dieser Ehe ausgelebt werden.
Also versuchte er sich der familiären Nähe noch entschiedener zu entziehen, indem er der Mutter, die seit ihrer Kindheit von einem Leben auf dem Lande träumte, ein ländliches Zweit-Domizil vorschlug. Hätte er doch unlängst einen Gutsherrn kennengelernt, der würde in seinem Landschloß einige Räume im Stockwerk und auch das hübsch adaptierte bäuerliche Nebengebäude vermieten. Wolfpassing hieß der kleine Ort, nicht weit von Wien entfernt, und vom Schloß aus, erhöht am Rand bewaldeter Hügel liegend, könne man das Dorf bis hin zur Weite des Tullnerfeldes überschauen. Ob man nicht einmal dorthin fahren und sich das gemeinsam ansehen sollte? Landluft wäre doch gut für die Kleine, nicht wahr? Und so schnell erreichbar sei das Schloß, da könne sie, die Schauspielerin, aus der Stadt jederzeit, und sogar noch nachts, nach einer Abendvorstellung, in das von ihr doch so geliebte Landleben entfliehen! Das wäre doch was, oder?
Anna war dabei, als die Eltern zum ersten Mal nach Wolfpassing fuhren. Im Porsche der Mutter fuhren sie. Die hatte inzwischen den Führerschein erworben und vom Vater bald dieses Auto aufgedrängt bekommen. Es sei sicherer, fand er, als der bescheidene VW, den sie anfangs besaß. Und bald wurde dieser schwarze Porsche in Wien eine Art Markenzeichen für die mittlerweile recht bekannte Schauspielerin, wo immer sie sich in der Stadt mit ihm bewegte, fiel es Leuten auf. Anna, wenn sie ab und zu mitfahren durfte, sah vom Rücksitz aus Menschen aufmerksam werden, herschauen, herlachen, ja sogar herüberwinken. Und es war ihr von Anfang an unangenehm. Daß ihre Eltern, wo immer sie sich mit ihnen befand, stets Aufmerksamkeit erregten, daß dabei Blicke stets auch sie selbst trafen, wurde für sie ein unliebsamer, ja oft sogar quälender Aspekt ihres Kinderlebens.
Aber als die Mutter an einem Frühsommertag das Auto Richtung Wolfpassing lenkte, der Vater breit neben ihr saß und gute Laune versprühte, da gefiel es Anna hinter den beiden am Rücksitz. War sie doch überaus selten mit Vater und Mutter beisammen, noch dazu in so heiterer und harmonischer Stimmung, wie es bei dieser Ausfahrt der Fall war.
Sie verließen die Stadt, fuhren eine Weile flußaufwärts an der Donau entlang, und dann weiter auf einer schmalen Straße, die sich, von Obstbäumen gesäumt, am Fuß des Wienerwaldes dahinschlängelte. Der Mutter gefiel diese sanfte, unaufdringliche Landschaft, es gab Hügel und Laubwälder zur einen, Flachland und Felder zur anderen Seite. Und dem Vater wiederum gefiel sehr, daß es ihr gefiel.
Sie erreichten nach etwa einer Stunde das Dörfchen. Dort befahl der Vater das Abbiegen. Zwischen ebenerdigen Bauernhäusern rumpelten sie einen leicht ansteigenden, sandigen Fahrweg aufwärts, und gelangten schließlich zu einem großen Gittertor. Dahinter lag das Schloß Wolfpassing.
Der Begriff ›Schloß‹ erwies sich als ein wenig zu pompös, das Gebäude konnte gerade noch als Herrschaftshaus eines Landgutes durchgehen, besaß aber bauliche Schönheit. Es war mit einem Säulengang ausgestattet und endete in einem turmartigen Rundbau.
Der sogenannte Schloßherr hingegen war ein etwas verworrener Mann, Landwirt und Jäger, und ständig im Streit mit seiner hübschen Frau, die ihn aus Langeweile wahllos mit irgendwelchen Bauern betrog.
An diesem Nachmittag jedoch begrüßte er die Eltern und Anna als jovialer Landjunker, führte sie im Schloß eine Treppe aufwärts und zeigte ihnen das zu vermietende sogenannte ›Turmzimmer‹, mit Bad und kleiner Küche. An den Blicken der Mutter, die an das Fenster getreten war und hinaus ins Weite sah, erkannte Anna sofort, wie sehr dieser Raum etwas in ihr beflügelte.
Danach überquerten sie auf einem Kiesweg ein gepflegtes Gartenstück und betraten die niedrigen Räume des ehemaligen Gesindehauses. Mit feinem Gespür hatte man hier restauriert, das Schöne des Ländlichen mit Komfort versehen, lauschige Behaglichkeit schlug einem sofort entgegen. Der Wohnraum, Küche, Nebenräume, alles war geschmackvoll eingerichtet und teilweise mit Treppen aus altem, glänzendem Holz verbunden. Dieses Häuschen schien wie dazu geschaffen, sich wohl zu fühlen. Anna sah freudige Bereitschaft in den Augen der Mutter entstehen, und das schien dem Vater mehr als zuzusagen, er strahlte siegesgewiß. Ohne viel Federlesens einigte er sich mit dem Besitzer, beides wurde von ihm gemietet, das Turmzimmer und vor allem das gemütliche, kindergerechte, kleine Haus.
Anna gefiel dieser Ausflug, und sie mochte die begeisterte Einigkeit der Eltern. Je hier wohnen zu bleiben, kam ihr nicht in den Sinn, obwohl Vater und Mutter angeregt darüber sprachen. Fuhr man doch abends zurück in die Weyrgasse, und sie wurde von Hildegard, die sie erwartet hatte, in ihr weißes Bett unter dem Gemälde des großen Hundes schlafen gelegt wie an anderen Abenden auch.
Daß ihr vertrautes Kindermädchen, das kein Mädchen mehr sein wollte, sie jedoch bald verlassen würde, das wußte Anna nicht. Einige Tage später, während sie am großen Küchentisch gemeinsam eine Jause zu sich nahmen, sagte Hildegard: »Jetzt kriegst eine Neue!«
Das Kind sah sie fragend an.
»Na ja, eine Neue als Kinderfräulein«, fügte sie hinzu, und strich Anna übers Haar. »Mach dir nix draus, es wird sicher lustig mit der, du kriegst jetzt nämlich eine Negerin.«
Anna verstand nicht recht, was Hildegard mit ›Negerin‹ meinte, aber wie sie es aussprach, klang so, als käme etwas Unheimliches auf sie zu.
Am Morgen danach, als Hildegard ihre Sachen zusammenpackte und das Mädchenzimmer räumte, war die Mutter dabei und geleitete sie freundlich, mit guten Wünschen für die Zukunft, an die Wohnungstür. Anna verstand diesen Abschied nicht, er fiel ihr schwer, ihr war, als müsse sie sich von einer Schwester trennen. Hildegard hatte kurz Tränen in den Augen, als sie einander ein letztes Mal umarmten, aber sie schien gerne aus der düsteren Wohnung, aus ihrem Kämmerchen hinter der altmodischen Küche, in ein weitläufigeres, erfreulicheres Leben aufzubrechen.