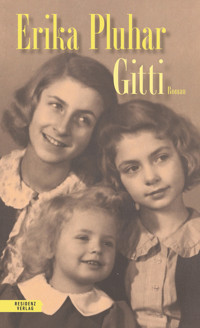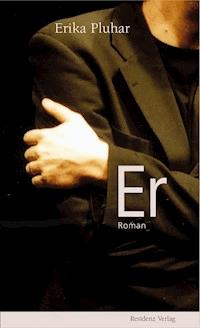
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erika Pluhar beschreibt die Reise eines Mannes zu sich selbst. Emil Windhacker ist ein Mann in den besten Jahren. Karrierebewusst, sportlich, immer in guter Gesellschaft genießt er sein Leben in vollen Zügen. Doch ein Laborbefund und ein ihm neues Gefühl von Schwäche und Versagen lassen ihn nachdenklich werden. Bedeutet dieser Befund sein Todesurteil? Als Emil der Schauspielerin Marie Liebner begegnet, überstürzen sich die Ereignisse... Erika Pluhar beschreibt drei Tage im Leben eines Mannes. Aus der subjektiven Perspektive Emils vollzieht Pluhar eine punktgenaue Abrechnung mit der männlichen Sicht auf die großen Lebensthemen Liebe, Krankheit und Tod. Poetisch, humorvoll, erzählerisch dicht und zutiefst berührend schildert die Autorin die Geschichte einer späten Einsicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ERIKA PLUHAR ER
Erika Pluhar
ER
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2008 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4254-7
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1491-9
Er rannte abwärts, zu seinem Auto zurück, das er auf dem großen Parkplatz bei der städtischen Badeanstalt abgestellt hatte. Er wußte nicht recht, warum er dann doch nicht zum Schwimmen gegangen, sondern in die umliegenden Waldungen und Weingärten hochgestiegen war. Genauso, wie er jetzt nicht wußte, warum er den Pfad zurücklief, als wäre ihm jemand auf den Fersen. Vielleicht war es auch so, vielleicht war ihm jemand auf den Fersen. Sein absehbarer Tod. Nichts Neues für ihn, es lag zwei Wochen zurück, da hatte er diesen trostlosen Befund erhalten. Aber er lebte immer noch und pflegte nicht ständig herumzulaufen wie gejagt. Warum also heute?
Jogger keuchten an ihm vorbei, den Weg hinauf. Sie musterten mit kurzen, erschöpften Blicken den Mann, der ohne die übliche sportliche Ausrüstung und ohne zu schwitzen an ihnen vorbeilief, mit großen Schritten abwärts sprang, sich ab und zu mit einer Hand an Baumstämmen abfedernd und den Blick auf den steinigen Pfad geheftet. Emil sah, wie die Steine unter seinen Füßen zurückblieben, sich hinter ihm verloren, er sah die Vielfalt von Gestein in dieser von Ausflüglern begangenen Waldgegend, nahe der Stadt, sah sie, als würde er Steinwüsten durchqueren.
Birken begleiteten den Weg, die fasrige, weiße Rinde fühlte sich warm an. Er wich den Bäumen geschmeidig aus und hielt sich nur ab und zu kurz an einem von ihnen fest, um die Geschwindigkeit seines Laufs zu bremsen. Was seinen gesenkten Blick jedoch gefangenhielt, war die Musterung des Gesteins, Korrosionen im felsigen Erdreich, Kiesel, die neben seinen Schuhen zur Seite sprangen, feiner Sand aus zermalmtem Stein, der unter seinen Sohlen knirschte. Er wäre wohl mehrmals ausgeglitten, wenn er sich nicht elastisch bewegen würde, nach wie vor. Wenn er nicht nach wie vor seinen Körper beherrschte. Darauf war er immer stolz gewesen, auf seine Körperbeherrschung, der jede Anstrengung fremd zu sein schien. Sein Körper hatte ihm immer mühelos gehorcht. Und jetzt das, dieses Entgleiten.
Er war fassungslos gewesen, als er vom Ausmaß der Krankheit erfuhr. Ja, vor allem fassungslos. Daß sein Körper das Eigenleben gefräßiger Zellen in sich zuließ, erschien ihm als Beleidigung. Sein Körper, schlank, gut gewachsen, seit der Kindheit sportlich gestählt, verläßlich, nie krank, kaum zu ermüden, war fünfzig Jahre lang die Basis seines Vertrauens in sich selbst gewesen. Er hatte in ihm gewohnt und gelebt und ihn geliebt. Er würde ihm nie einen Streich spielen, nie von sich reden machen, ihn stets als Freund begleiten, dessen war er sich sicher gewesen. Er konnte ihn einsetzen, wo immer er wollte, und erntete niemals seinen Widerspruch. Ob bei sportlichen Höchstleistungen oder in der Liebe, nie hatte sein Körper ihn enttäuscht oder im Stich gelassen, und er hatte sich immer wohl gefühlt in diesem Männerkörper. Ja, er war immer gern der Mann in diesem und mit diesem Körper gewesen, er war stolz auf ihn. Er sah gut aus, sein Körper. Nicht, daß Emil sein Gesicht je häßlich gefunden hätte, aber auf sein Gesicht war er weniger stolz. Er beachtete es weniger. Nur flüchtig, beim Rasieren und wenn er sich vor dem Spiegel die Krawatte band, sah er es vor sich. Die kräftige Nase, die hellgrauen Augen, ein kleiner, aber, wie zu passender Gelegenheit behauptet wurde, dennoch sinnlicher Mund, ein typisches, unaufwendiges Männergesicht eben, er war damit zufrieden. Aber seinen Körper hatte er immer gern angesehen, beim Duschen oder Sonnen, nackt und auch im Sportdreß oder in der Badehose. Das Zusammenspiel der gut entwickelten Muskeln, die erstaunlich weiche und gepflegte Haut, kein Gramm Fett zuviel, keine Anzeichen von Alter, auch als er die Vierzig hinter sich gelassen hatte. Auch als er fünfzig geworden war. Und dann, nach diesem Geburtstag, etwa einen Monat danach, Beleidigung und Verrat. Sein Körper hatte sich selbständig gemacht, ihn verlassen, war plötzlich nicht mehr sein Körper, der, den er ein Leben lang besessen hatte. Jetzt besaß dieser Körper ihn, irgendein Mensch namens Emil Windhacker lebte noch in diesem Körper, er konnte weder aus ihm fliehen noch ihm weiterhin vertrauen. Er konnte ihn nur noch schonungslos benutzen, so wie jetzt, über Steine und Geröll hinweg abwärts laufend, die gesamte Muskulatur herausfordernd, sich um kein Krankheitsbild kümmernd, die fernen Ansätze von Schmerz negierend, und in tiefen Zügen aus- und einatmend.
Emil mußte zur Seite springen, als ein junges Paar mit Mountainbikes sich den Pfad hinauf quälte. Beide trugen Helme und Brillen und grellfarbige synthetische Trikots, der kurze Blick, mit dem er sie wahrnahm, ließ den Eindruck zurück, als wären ihm Rieseninsekten oder Bewohner eines anderen Sterns über den Weg gelaufen. Er federte nach seinem Sprung zwischen die Bäume locker aus der Hocke hoch und lief durch das Birkenwäldchen weiter, ohne von Ästen geritzt oder verletzt zu werden. Ihm war einen Augenblick lang so, als würde er durch die Birken tanzen. Dann kehrte er in einem Bogen wieder auf den Pfad zurück, der nun abschüssiger wurde. Auch das Gestein schien scharfkantiger, von Regenbächen ausgewaschen zu sein, sein rechter Fuß kippte zur Seite. Er fing sich rasch wieder und hielt sich am Stamm einer jungen Erle fest, die den Birkensaum verlassen und sich zur Mitte des Pfades hin im steinigen Erdreich festgekrallt hatte. Im Schwung, es mit nur einer Hand umfassend, wollte er das Bäumchen umrunden, um dann weiter abwärts zu laufen, aber ehe er den dünnen, glatten Stamm losließ, wurde er gezwungen, abzubremsen und anzuhalten. Staub und Kiesel spritzten zur Seite, seine Schuhsohlen schlitterten über glattes Gestein, doch er konnte stehen bleiben. Hätte er es nicht gekonnt, wären sie wohl beide gestürzt, er und die Frau, die so plötzlich vor ihm aufgetaucht war.
Erschrocken blieb sie stehen und hob den Blick. Er sah in zwei große graue Augen, die ihn anstarrten, als hätte man sie aus dem Schlaf gerissen. Er hatte sich nie sehr für den Ausdruck in Frauenaugen interessiert, außer es war der von sexueller Lust oder argloser Fröhlichkeit. Sobald Schatten in ihnen aufstiegen, versuchte er dies nicht mehr wahrzunehmen, das Schmerzliche in Frauenaugen übersah er möglichst. Blieb es jedoch bei dunkler Schwermut im Blick einer Frau, trieb es ihn bald davon.
Was ihn jetzt aus diesen Augen anschaute, wußte er nicht genau zu deuten. Nachdem das Erschrecken sich gelegt hatte, musterten sie ihn kurz und gleichgültig. Diese Gleichgültigkeit verdeckte vielleicht einen Ausdruck von Trauer, aber Emil konnte es nicht mit Sicherheit feststellen, auch, weil die Frau nur »Tut mir leid« murmelte und an ihm vorbei weiter den Pfad aufwärts schritt. Warum er sich jetzt umwandte und ihr hinterhersah, war ihm auch unklar, und das störte ihn. Alles, was nicht Sicherheit und sachliche Feststellung war, störte ihn, und das seit eh und je. Trotzdem nahm er jetzt mit seltsamer Genauigkeit alles an dieser sich entfernenden Frau wahr. Den in der Taille gebundenen, fischgrätengemusterten Mantel, das locker im Nacken zusammengehaltene, aschblonde Haar, die nackten braungebrannten Waden über dicken Socken und weißen Turnschuhen. Wie alt sie wohl war, überlegte er. Sicher über dreißig, wenn nicht mehr. Mit beiden Händen in den Manteltaschen stieg sie ohne Hast unaufhaltsam höher, ihre Gestalt verkleinerte sich und verschwand schließlich hinter einer Wegbiegung.
Warum stehe ich hier und schaue irgendeiner Frau hinterher? dachte Emil und spürte zu seinem Erstaunen, daß er zornig wurde. Seine Mundhöhle füllte sich mit einem bitteren Geschmack, ähnlich dem von Schlehdornfrüchten, die er als Junge trotz ihrer pelzigen Bitterkeit gern gegessen hatte. Woher kam dieser plötzliche Zorn? Was an dieser unscheinbaren, entschwindenden Frauengestalt hatte ihn zornig gemacht?
Mit einem Ruck wandte er sich ab und setzte seinen Weg fort. Aber die Lust zu laufen hatte er verloren, er schritt abwärts, den Blick auf seine staubigen Schuhe gesenkt und die Hände im Rücken verschränkt. Wie ein friedlicher Spaziergänger, dachte er, keiner würde mir meinen Zorn ansehen. Was ist nur los mit mir? Meine Befunde machen mich zornig, und das zu Recht. Aber was hat das mit einer Frau zu tun, in die ich fast hineingelaufen wäre?
»Scheiße«, sagte er laut.
Frauen waren ihm reihenweise begegnet, über Mangel an weiblicher Zuwendung mußte er sich nie beklagen. Frauen hatten ihm förmlich die Tür eingerannt, zeitweise war es ihm zuviel, wenn nicht zuwider gewesen. Daß er nie geheiratet hatte, lag vielleicht daran. Daß es zu viele waren. Zuviel leichte Beute. Zuviel aufgestaute Sehnsucht, zuviel Anhänglichkeit, zuviel Gier. Frauen gefielen ihm zwar, aber sie waren ihm suspekt, immer schon und bis heute.
Dieses bis heute steigerte seine Unruhe. Was war denn heute schon Suspektes geschehen? Nur der kurze, wie erwachende Blick aus großen, grauen Augen, die achtlose Entschuldigung, das ungerührte Weitergehen einer Frau, und davon ließ er sich derart irritieren?
Er blieb stehen und atmete aus. Er mußte solche Gedanken, die in seiner Situation überflüssig, vielleicht sogar schädlich waren, loswerden. Vor sportlichen Leistungen pflegte er sich durch bewußtes Ausatmen von gedanklichem Müll, wie er es nannte, zu reinigen, um sich konzentrieren zu können. So drang ein heftiger, aber gleichmäßig hervorgestoßener Strom Atem aus seinem weit geöffneten Mund, mit einem lang anhaltenden Ton, der fast zu einem Schrei wurde.
Ein älterer, magerer Mann, der so langsam, als geschähe es in Zeitlupe, an ihm vorbeijoggte, maß ihn mit einem verängstigten Blick. Emil mußte plötzlich lachen. »Alles okay!« rief er dem Mann zu. »Ich bin kein Drache, der Feuer speit!« Der ausgemergelte Jogger jedoch, vor Anstrengung unfähig, auch nur zu lächeln, taumelte schweißüberströmt und mit ausdruckslos erschöpftem Gesicht weiter. Alter Idiot, dachte Emil, er wird sich umbringen.
Der Parkplatz mit den abgestellten Autos war bereits in Sichtweite, aber Emil fehlte auf einmal die Kraft, weiterzugehen. Er fühlte eine Schwäche, wie er sie noch nie gekannt hatte, ihm war plötzlich, als könnten seine Beine ihn nicht mehr tragen. Er hockte sich an den Rand des Pfades, lehnte seinen Oberkörper gegen einen Baum und schloß die Augen. »Bravo«, murmelte er, »jetzt geht’s also los.« Er hatte keine Schmerzen, nur schien alle Kraft aus seinem Körper gewichen.
Was eigentlich hatte er, Emil, denn getan? Womit hatte er seinen Körper derart gegen sich aufgebracht? Hatte er doch immer gesund gelebt, wie er dachte, mit Vernunft, auch wenn es exzessiv wurde. Immer rechtzeitig die Bremse gezogen. Vielleicht war er nur krank, zum ersten Mal in seinem Leben ernsthaft krank, einmal mußte es wohl sein, und alles würde sich wieder zum Guten wenden.
Eine Nordic-Walking-Gruppe klirrte mit ihren Stöcken an ihm vorbei, starrte verbissen vor sich hin wie Galeerensträflinge und nahm keine Notiz von ihm. Was sonst? dachte Emil. Man konnte heutzutage erschöpft oder sterbend irgendwo am Straßenrand sitzen, und keiner würde es sehen wollen. Warum also sollte ein Waldweg noch anderen, humaneren Gesetzen unterworfen sein? Oder ist das immer schon so gewesen, nicht nur, wie oft behauptet, ein Zug unserer Zeit? Gleichgültigkeit dem Mitmenschen gegenüber gehört schließlich seit jeher zum festen Repertoire menschlicher Verhaltensmuster. Hätte er selbst denn jemals angehalten und sich um jemanden gekümmert, der schweratmend und fahl im Gesicht unter einem Baum hockte? Sicher nicht. Vielleicht hätte er ihn sogar wahrgenommen, sich aber gleichzeitig davor gehütet, einzugreifen. Er empfand es seit frühester Kindheit als Indiskretion, einem leidenden Menschen nahe zu kommen, und deshalb versuchte er dies auch immer zu vermeiden, so gut es ging. Seine Mutter hatte nach ihm gerufen, ehe sie starb, und so mußte er wohl oder übel das Krankenzimmer im Altersheim betreten und sich an ihr Bett setzen. Davor schon hatte er sie äußerst selten besucht, und diesen letzten Besuch empfand er als eine böswillige Zumutung des Lebens. Wie konnte es einen zwingen, jemandem beim Sterben zuzusehen? Die eigene Hand von zwei ausgezehrten, feuchten Händen umklammert zu fühlen, den schalen Geruch nach versagenden Körperfunktionen einatmen zu müssen, ein unkenntliches, erloschenes Gesicht vor sich zu haben, das ehemals einer hübschen, immer sorgfältig zurechtgemachten Frau gehört hatte, die seine Mutter war, und die er jetzt als fremden Rest eines Menschen und als Bedrohung empfand. Er hatte mit dem Tod seiner Mutter nichts anfangen können, er stimmte ihn auch nicht traurig, er fühlte keinerlei Schmerz. Er war erleichtert, als er ihr Sterbebett verlassen und vor dem Gebäude des Altersheims den frischen Duft feuchter Herbstbäume einsaugen konnte. Seine Mutter starb im Herbst, schon vor Jahren, nur kurz, nachdem er bei ihr gewesen war. Sobald man sie begraben hatte, vergaß er sie, und ihm schien, als habe er sie nie sonderlich geliebt, auch als Kind nicht. Den Tod des Vaters bekam Emil kaum mit, er war damals noch sehr klein gewesen, Geschwister hatte er keine, die übrige Verwandtschaft mied er wie den Teufel, eine eigene Familie hatte er sich wohlweislich nicht zugelegt. So konnte er frei von Leidensbelästigung und Besorgnis das Leben eines ungebundenen Mannes und umworbenen Junggesellen führen. Wenn Tränen und Nöte, welcher Art auch immer, sich einzuschleichen begannen, gelang es ihm meist ohne viel Dramatik, Liebesbeziehungen wieder abzubrechen. Szenen und Geschrei waren ihm zuwider, er machte dem stets ein rasches Ende, indem er ging. Wen er hinter sich zurückließ, den vergaß er auch für immer. Er fand, dies sei nötig, um Ballast abzuwerfen, und nichts wog für ihn schwerer als der Ballast weiblicher Emotionen, die er nicht teilen konnte. Auch deshalb hielt er sich gern unter Menschen auf, die ihn nichts angingen.
Und vor allem fühlte er sich immer wohl mit sich selbst. Er hatte Freude an seinem Körper, an sportlicher Leistung, am Geldverdienen, an Reisen, an gutem Essen und Trinken, an Freunden, die nichts von ihm wollten. Er hatte immer Freude an seinem Leben gehabt und nicht viel Aufhebens davon gemacht. Und jetzt machte dieses Leben plötzlich Aufhebens von sich, indem es sich von ihm abwandte, schlicht davonging wie die Frau im Fischgrätenmantel vorhin.
Ein wohlbeleibtes Paar, beide mit ähnlichen Windjacken und Rucksäcken ausgestattet, stieg schweratmend bergauf. Auch sie würdigten ihn, der am Wegrand saß, keines Blickes, so, als wäre er Teil des Baumes, gegen dessen Stamm er sich gelehnt hatte. Aber er hörte hervorgekeuchte Wortfetzen und Sätze, während das Paar an ihm vorbeiwanderte. Trotz der körperlichen Anstrengung, die Steigung zu bezwingen, schienen die beiden in ein aufgeregtes Gespräch vertieft zu sein. »Ich sage dir, sie war es«, stieß die Frau hervor. »– nicht so blond –«, war aus der Antwort des Mannes herauszuhören. Die Frau sprach lauter, war besser zu verstehen. »Blond hin oder her, ich kenne doch ihr Gesicht!« rief sie aus. Nach einer kurzen Pause, in der man nur die knirschenden Schritte auf dem Geröll hörte, fuhr sie schweratmend fort: »Wenn du nicht beim Auto – so lange gebraucht hättest – mit deinen Bergschuhen –« Sie waren schon fast außer Sichtweite, aber Emil hörte noch das atemlose Auflachen des Mannes und undeutlich eine Frage, die verärgert klang, in der jedoch nur die Worte »– vielleicht begrüßen –?« zu vernehmen waren. Dann nur noch abwechselnd Stimmen, die im Höhersteigen langsam verklangen.
Emil atmete in tiefen Zügen, um seine Schwäche in den Griff zu bekommen. Er bezweifelte, daß er jetzt noch in der Lage war, die Schwimmhalle zu besuchen. Jetzt eine Umkleidekabine zu mieten, seinen nackten Körper im kleinen Spiegel zu sehen, die Badehose überzustreifen, dann der Chlorgeruch des großen Schwimmbeckens, die Nähe all der anderen Leute, fremde nackte Haut, angeklatschte Badeanzüge, nasse Gesichter, triefende Haarsträhnen auf der Wasseroberfläche schaukelnd, das Planschen, Kreischen und die prustenden Schwimmzüge um ihn herum, während er versuchen würde, wie immer seine zwanzig, dreißig Längen zu kraulen. Er wußte, daß er das alles heute nicht mehr fertigbringen würde.
Aber vielleicht könnte ich jetzt wieder aufstehen und weitergehen, dachte er, blieb aber dennoch zwischen altem Gras und Wurzelwerk sitzen, die Beine bis an den Wegrand ausgestreckt und immer noch gegen den Baum gelehnt. Der fühlte sich gut an, sein Rücken schien in den Wölbungen der Rinde ein Bett gefunden zu haben. Emil spürte, daß er schläfrig zu werden begann, sein Kopf sank zurück, fand ebenfalls eine rundliche Vertiefung im Stamm, wie dafür geschaffen, ihn sanft zu bergen. Der Baum war eine hohe, alte Birke, das nahm Emil gerade noch wahr, die schwarzen Rillen in den silberweißen Rindenflächen, das Zittern der bereits gelblichen Blätter, durch die eine kühle Sonne fiel, er sah aufwärts in die Baumkrone, die ihn überwölbte, ehe er einschlief.
»Sind Sie tot?«
Ohne die Augen zu öffnen, ließ Emil diese Frage sein Erwachen durchdringen. Bin ich tot? fragte er sich. Und wer will wissen, ob ich es bin? Wen geht das etwas an, ob ich tot bin oder nicht?
Jemand griff nach seiner Schulter und rüttelte sie.
Es kostete Emil Mühe, die Lider ein wenig zu heben. Er sah Turnschuhe, weiße Socken, den Saum eines fischgrätengemusterten Mantels. Und als er den Blick hob, schaute er geradewegs in diese großen, grauen Augen, die ihn aufmerksam musterten.
»Ach, Sie sind es«, sagte er.
»Ist Ihnen schlecht?« fragte die Frau.
»Nein, aber Sie reden zu laut«, antwortete er, während er versuchte, sich aufzurichten, »und davon wird mir schlecht.« Warum bin ich so unhöflich zu ihr? dachte Emil gleichzeitig.
»Entschuldigen Sie. Ich weiß, ich spreche immer zu laut.«
Die Frau stand mit hängenden Armen vor ihm und blickte auf ihn hinunter. Sie ist sehr groß, dachte Emil, fast größer als ich.
»Sehen Sie nicht so auf mich herunter«, sagte er. »Weder bin ich betrunken noch ein Obdachloser, ich habe mir nur erlaubt, ein wenig einzuschlafen. Ist das verboten?«
»Keinesfalls«, antwortete sie. »Ich habe mir andererseits nur erlaubt, mir Sorgen zu machen, weil Sie mitten am Weg lagen, und das tut man selten bei einem normalen Nachmittagsschläfchen. Fast wäre ich über Ihre Beine gestolpert.«
»Tut mir leid«, sagte er.
»Mir auch. Und nichts für ungut.«
Sie wandte sich ab und wollte weitergehen, er fühlte ihren Wunsch, ihn, Emil, rasch hinter sich zu lassen.
»Und warum sprechen Sie immer zu laut?«
Was für eine blöde Frage, die Frau aufzuhalten, dachte er, aber mir fällt keine bessere ein. Ich möchte nicht, daß sie geht.
Die Frau blieb mit dem Rücken zu ihm stehen, sie wirkte unschlüssig, aber dann drehte sie sich doch nochmals zu ihm her.
»Weiß ich nicht«, sagte sie, »Gewohnheit wohl.«
»Komische Gewohnheit.«
»Ich kann es nicht ändern, Gewohnheiten sind, wie sie sind.«
»Stimmt nicht.« Etwas zwang ihn, ihr mit patzigem Ton zu widersprechen. »Gewohnheiten sind dazu da, sie zu ändern.«
Jetzt hatte sie endgültig genug von ihm, er sah es an der Falte, die zwischen ihren Augen entstanden war. »Adieu«, sagte sie, steckte ihre Hände in die Manteltaschen, musterte ihn nochmals kurz und ging davon.
Er stand auf und sah ihr hinterher. Zum Kotzen, dachte er, wie unfähig ich mit dieser Frau umgegangen bin. Dabei hätte ich gern noch mit ihr gesprochen, ihre Stimme, die mir überhaupt nicht zu laut war, klingt schön. Kenne ich diese Stimme?
»Kenne ich Ihre Stimme?« schrie er ihr plötzlich hinterher. »Sie ist schön!«
»Ich dachte, sie wäre Ihnen zu laut!« rief die Frau, ohne sich umzuwenden oder stehenzubleiben.
»Ich bin ein Trottel!« schrie er.
»Da widerspreche ich Ihnen nicht!«
Mit diesem letzten Zuruf hatte die Frau den Parkplatz erreicht. Sie ließ sich in den Sitz eines offenen Sportwagens fallen, startete das Auto, hob kurz die Hand und fuhr davon. Silbergrau war das Auto, und einige Strähnen ihres Haares flatterten ähnlich silbern auf, ehe sie hinter der Straßenbiegung verschwand.
Das hab ich jetzt davon, dachte Emil. Da will mir eine gut aussehende Frau mit ziemlich betörender Stimme helfen, wieder wach zu werden und mich weiterzubewegen, und ich behandle sie wie den letzten Dreck. Statt ihre Hand auf meiner Schulter, diese Annehmlichkeit einer weiblichen Zuwendung für mich zu nützen.
Er spürte, daß er wieder genügend Kraft in seinen Beinen hatte, um weitergehen zu können. Vorsichtig setzte er einen Schritt vor den anderen. Jetzt gehe ich, wie ein kranker Mann zu gehen hat, dachte er. Ob ich lange am Wegrand geschlafen habe? Die Sonne stand jedenfalls um einiges tiefer, diese gewisse kühle, blasse Nachmittagssonne, wenn der Sommer bricht und der Herbst sich eingeschlichen hat. So ein Tag war das heute, und er nahm ihn persönlich. Auch bei ihm hatte sich etwas eingeschlichen wie ein zu früher Herbst, und er haßte es. Noch vor kurzem hatte er sich im Sommer seines Lebens gefühlt, und er wollte dieses Gefühl wiederhaben. Mit diesem Gefühl gesegnet hätte er die Frau im fischgrätengemusterten Mantel sicher nicht so ohne weiteres gehen lassen, er hätte seinen Charme spielen lassen und einen Flirt begonnen, statt sie zu brüskieren. Er war nie darum verlegen gewesen, einen Flirt zu beginnen, er konnte das einfach. Seine Art, mit ihnen umzugehen, hatte Frauen immer angezogen. Warum nur hatte er sich vorhin so blöde verhalten, sich als Rabauke gebärdet, er, der weiblichen Wesen gegenüber meist die Höflichkeit in Person war? Hatte ihn seine Krankheit bereits so verändert?
»Unsinn!«
Er rief es laut vor sich hin. Wer weiß, ob er wirklich schwer krank war, es gab zwar diesen Befund, aber nur er selbst hatte ihn als tödlich eingestuft, kein Arzt hatte das bisher bestätigt. Obwohl Ärzte so etwas einem Patienten natürlich nicht so schnell auf die Nase zu binden pflegen. Aber wie auch immer, er selbst wollte daran glauben, nur vorübergehend eine körperliche Krise zu durchwandern und am Ende wieder blitzgesund herauszukommen, er wollte daran von nun ab felsenfest glauben! Der Glaube versetzt schließlich Berge, heißt es, und warum sollte es in seinem Fall nicht stimmen? Warum sollte sein eigener Glaube das dunkle Gewicht der Todesdrohung nicht wieder verschwinden lassen? Gott, würde er leben! Mit allen Fasern leben, wenn dies einträte! Er würde die Frau mit den großen, grauen Augen so lange suchen, bis er vor ihr auf die Knie fallen und sie um Vergebung bitten könnte, vor dem Fischgrätenmuster würde er zu Boden sinken und ihre Turnschuhe küssen. Er würde sich jede Torheit gestatten, jeden dummen Einfall auskosten, er würde nichts mehr ernst nehmen außer dem Umstand, sich selbst am Leben zu wissen!
Emil hatte den Parkplatz fast erreicht, als das Paar in den Windjacken ihn einholte, die beiden dicken Menschen ließen sich und ihre Schwere förmlich ins Tal fallen, waren bergab erstaunlich rasch unterwegs. Als sie schweratmend an ihm vorbeieilten, sagte die Frau: »Jetzt ist ihr Auto nicht mehr da.« – »Was hättest du denn gewollt von ihr?« fragte der Mann mißmutig. »Wenigstens ein Autogramm«, keuchte die Frau, »aber das verstehst du eben nicht.« Emil sah den beiden nach, sah sie zwischen den parkenden Autos verschwinden.
Und plötzlich wußte er, wer die Frau mit den grauen Augen gewesen war. Ihr Name fiel ihm nicht ein, aber daß er sie in Fernsehfilmen gesehen hatte, schon. »Wie heißt sie denn nur?« murmelte er, während er seinem Auto zusteuerte. Selten sah er mit Aufmerksamkeit fern, er drehte den Apparat meist nur an, um die Stille seiner Wohnung zu durchbrechen. Und wenn überhaupt, dann interessierten ihn Nachrichten oder Dokumentationen, Spielfilme glitten an ihm vorbei, er warf nur ab und zu und nebenbei einen Blick darauf und kannte sich dann in den Geschichten natürlich nicht aus. Und er wollte sich in den Geschichten auch gar nicht auskennen, all diese erfundenen Emotionen gingen ihm auf die Nerven, erinnerten ihn an die, die nicht erfunden waren und ihn belästigten. Eigentlich konnte er Filme nicht leiden. Aber an das Gesicht dieser Frau, wie es in Großaufnahmen den Bildschirm füllte, daran erinnerte er sich plötzlich, als er sein Auto erreichte.
Emils Sportwagen war ebenfalls grau, aber nicht silbern, sondern dunkelgrau, stahlfarben, diese Farbbezeichnung hatte ihn beim Kauf beeindruckt, sie hatte etwas mit Krieg und Kampf zu tun, fand er. Emil war heute nicht mit offenem Verdeck gefahren, denn er fror, als er sich auf den Weg gemacht hatte. Also ließ er sich jetzt, als er das Auto erreicht hatte, in dessen abgeschlossenes, dumpf riechendes Gehäuse fallen, blieb eine Weile reglos sitzen und starrte vor sich hin.
»Marie!« rief er plötzlich aus. »Marie Liebner heißt sie!«
Ihm war, als hätte der Umstand, daß ihr Name ihm eingefallen war, ihn beflügelt. Jedenfalls kam Bewegung in seinen Körper, eine, die sich in ihrer Plötzlichkeit mit dem Flügelschlag eines auffliegenden Vogels durchaus vergleichen ließ. Er schloß knallend die Wagentür, startete den Motor, schoß im Rückwärtsgang rasch, aber umsichtig aus der Parklücke, wendete mit knirschenden Reifen und brauste los. Er nahm die Kurven der Straße, die aus den Hügeln zur Stadt hinunter führte, mit Genuß. Immer schon war er ein glänzender Autofahrer gewesen, in jungen Jahren sogar Rallyes gefahren, und jede Gelegenheit, hinter dem Steuer seines Sportwagens zu sitzen, war ihm willkommen. Nie hatte er dabei unter Überdruß oder Langeweile gelitten oder es als Zwang empfunden, während viele seiner Bekannten solches immer wieder stöhnend kundtaten. Er liebte es, Auto zu fahren, und machte daraus kein Hehl, auch sich selbst gegenüber nicht.
Marie Liebner, dachte er, genau, die Filmschauspielerin. Und er hatte sie behandelt, wie er Frauen bei ersten Begegnungen sonst nie zu behandeln pflegte, großkotzig, mürrisch, gerade bei ihr mußte ihm das passieren. Sein schlechter Zustand war daran schuld gewesen, aber das konnte er ihr jetzt nicht mehr erklären. Wenn diese Frau überhaupt je an den Mann zurückdenken sollte, dem sie auf dem Waldweg begegnet war, dann sicher nur unwillig, wenn nicht gar mit Verachtung. An einen lausigen, unhöflichen, kaputten Kerl mittleren Alters würde sie denken, der sich pampig benahm und geschwächt aussah, an einen dieser verlorenen Typen eben, die auf den Straßen dieser Welt herumlungern.
Emil gab Gas und fuhr viel zu schnell, er wußte es. Aber er konnte nicht anders, die Vorstellung, wie Marie Liebner ihn einschätzen mußte, wenn sie überhaupt einen Gedanken an ihn verlor, machte ihn wütend, und mit dieser Wut im Bauch chauffierte er. Er hatte sein Leben lang Wert darauf gelegt, auf Frauen einen guten Eindruck zu machen. Auch wenn er keinerlei Absicht gehabt hatte, eine Frau zu erobern, ja sogar, wenn ihm eine überhaupt nicht gefiel, war er darauf bedacht gewesen, ihr zu gefallen, ihr zu imponieren