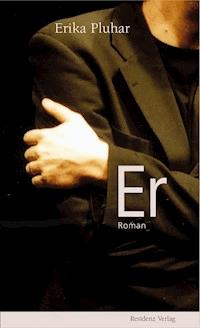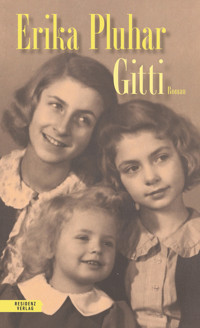Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Lebensreise einer bemerkenswerten jungen Frau im Jahrhundert der Extreme: ein sensibler, wortmächtiger und bilderreicher Roman. "Anna kam am 3. Dezember 1909 in Wien zur Welt und war die zweitälteste der vier Töchter des Glasmalermeisters Franz Goetzer." Lakonisch beginnt der neue Roman von Erika Pluhar. Er erzählt die Geschichte einer hochbegabten Frau, die zwischen den Weltkriegen an der Wiener Kunstakademie studiert und von einem selbstbestimmten Leben träumt. Doch Annas Auswanderung nach Brasilien, ihre Ehe und vor allem der aufkeimende Nationalsozialismus verhindern für lange Zeit diesen Traum. Einfühlsam beschreibt Pluhar die Hoffnungen, Sehnsüchte und Ängste der jungen Anna, die im Jahrhundert politischer Extreme aufwächst. Österreich, Brasilien, Deutschland und Polen sind die Stationen ihres Lebens, das einen unerwarteten Verlauf nimmt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Erika Pluhar
Im Schattender Zeit
Roman
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2012 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4285 1
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1588-6
Anna kam am 3. Dezember 1909 in Wien zur Welt und war die zweite der vier Töchter des Glasmalermeisters Franz Goetzer. Sie wuchs in der Schulgasse im Bezirk Währing auf. Dort besaß eines der mehrstöckigen Vorstadthäuser eine mächtige Durchfahrt zum weitläufigen Hinterhof, und an dessen Ende lag das Gebäude, in dem sich die Wohnung der Familie und die Werkstatt des Vaters befanden.
Die Wohnräume lagen ebenerdig, und der unter ihnen befindliche Keller beherbergte die Glasmalerei. Diese führte auf der Rückseite des Hauses zum tiefer gelegenen Garten hinaus. Man mußte an Kaninchenställen vorbei, eine Art Korridor überwinden, oder man wand sich zwischen buntem Glas, Arbeitstischen, am murrenden Vater und seinen freundlich grüßenden Gehilfen vorüber durch die gesamte Werkstatt, um diesen Garten zu erreichen.
Kaum hatte man ihn betreten, tat sich sofort sein Wunder auf. Er hatte sich im Andrängen der allmählich immer städtischer werdenden Bauvorhaben, zwischen Hausmauern, Hinterhöfen und Abladeplätzen, unerschütterlich sein verträumtes, ländliches Aussehen bewahrt. Da gab es Kieswege zwischen üppigen Blumenrabatten und Rasenflächen, Kastanienbäume überwölbten ihn von allen Seiten, einen Hügel zum Hof hin bedeckten hochwuchernde Himbeersträucher mit schmalen Pfaden dazwischen, und sogar ein »Salettl«, wie man das weißlackierte Gartenhäuschen nannte, krönte unter Fliedersträuchern und Laubschatten seine Idylle.
Anna liebte diesen Garten. Wie sie meinte, auf eine zärtlichere und inbrünstigere Weise, als ihre Schwestern es taten. Anna wurde Anni gerufen. Die ältere Schwester hieß Hermine, wie die Mutter, und wurde zur Minnie, die beiden jüngeren, Gertrude und Hedwig, zu Trude und Hedy.
Anna also, die keine Anni sein wollte, der aber nichts anderes übrigblieb, als sich diesem Namen zu fügen, empfand sich zwischen den weiblichen Mitgliedern der Familie in jeder Hinsicht als Außenseiterin. Und das, seit sie denken konnte.
Die Mutter, eine unbedarfte, brave Frau, terrorisierte zum allgemeinen Leidwesen alle mit ihrer Frömmigkeit. Den sonntäglichen Kirchgang zu unterlassen führte bei ihr zu einem derart ausufernden und endlosen Gezeter, daß man ihn zähneknirschend auf sich nahm oder log. Anna wurde dabei zur einfallsreichsten Lügnerin innerhalb der Familie und blieb ein Leben lang vom Religiösen in jeder Form angeekelt.
Die Schwestern hingegen waren fügsamer, sie schienen nichts anderes sein und bleiben zu wollen als nette Mädchen aus gutbürgerlichem Haus. Zwischen Minnie, Trude und Hedy kam Anna sich vor wie ein seltener Schmetterling. Sie empfand sich als Künstlerin. Sie wollte werden wie ihr Vater.
Franz Goetzer war als fahrender Handwerksbursche aus Bayern nach Wien gekommen und hatte in der Glasmalerei Seipel als Lehrling zu arbeiten begonnen. Seine Begabung und Tüchtigkeit wurden dem Meister rasch auffällig, vor allem auch im Hinblick auf einen Schwiegersohn, der den Betrieb weiterführen könnte, denn es gab nur Seipel-Mädchen. Franz sah sich also aus Karrieregründen genötigt, eine von ihnen auszuwählen, obwohl er in keine sonderlich verliebt war. Seine Wahl fiel schließlich auf Hermine, die ihm am meisten zusagte, und bald kam es zur Heirat. Er übernahm den Betrieb im Hinterhaus der Schulgasse, und bald wurde die Glasmalerei Goetzer, wie sie jetzt hieß, zu einer der bedeutendsten der Stadt. Wenn in Kirchen oder sonstwo bleiverglaste, farbige Fenster mit Bildmotiven benötigt wurden, fragte man meist bei ihm an. Er war hochbegabt als Zeichner und ein hervorragender Handwerker.
Und früh erkannte er die künstlerische Begabung seiner kleinen Tochter Anna, und diese zeigte zudem bald ein mehr als kindliches Interesse an seiner Arbeit. Ja, sie zeigte es so leidenschaftlich, daß er beschloß, das Fehlen eines Sohnes nicht mehr zu beklagen, sondern eben in dieser Tochter seine Nachfolge zu sehen. Die Anni sollte später den Betrieb übernehmen.
Im Hinblick auf die Zukunft eines weiblichen Wesens war sein Entschluß völlig unüblich, ja nahezu verpönt, und er zeugte von kühner Aufgeschlossenheit. Anna liebte ihren Vater wohl zu Recht.
Überdies fand sie ihn außergewöhnlich schön. Von eher kleiner Statur, hatte sein schlanker Körper Eleganz. Das lockige Haar, die buschigen Brauen, eine leicht geschwungene Nase und der markante Schnauzbart machten ihn zu einem gutaussehenden Mann, der den Frauen gefiel. Auch seiner Ehefrau hatte er wohl einstens gefallen. Aber schon der kleinen Anni wurde bald bewußt, daß ihr Vater, wenn er ab und zu »geschäftlich« verschwand, sein Männerglück anderswo suchte. Denn die bigotte Hermine trug Nachthemden, die vorne, über der Scham, einen Schlitz hatten, damit der Gatte sie durch diesen hindurch begatten konnte, ohne dabei ihren nackten Körper erblicken oder gar berühren zu dürfen. Anna hatte eines dieser weißleinenen Ungetüme eines Tages in der Waschküche mit Staunen inspiziert und recht schnell, obwohl noch Kind, ihre Schlüsse daraus gezogen.
*
Es war wohl auch des Vaters Wunsch nach mehr Freiheit, der ihn dazu bewog, für die Familie einen ständigen Sommerwohnsitz zu mieten, den er selbst jedoch nur an den Wochenenden aufsuchte. Er fand ein passendes Landhaus in der Ortschaft Garsten, westlich von Wien gelegen und ein in Wäldern und Wiesen verborgenes kleines Dorf. Man fuhr dorthin »aufs Land«. Und zwar mit Sack und Pack. Ein Pferdefuhrwerk wurde angeheuert und schwer beladen, denn nach des Vaters Wunsch sollten Gemahlin und Töchter auch während der Sommermonate die gewohnte Häuslichkeit um sich haben. Kleidung, Tuchenten, Bettwäsche, Geschirr und Küchengeräte wurden mitgeschleppt, um für das Landleben gerüstet zu sein.
Anna kämpfte jedesmal darum, am Ende der Anreise vorne am Kutschbock sitzen zu dürfen, und da sie Hartnäckigkeit besaß, wenn es um ihre Wünsche ging, und die anderen diesen zugigen Platz ohnehin nicht so wild begehrten wie sie selbst, gestattete man es ihr auch meist. Sie liebte diese Fahrt. Dicht neben dem Kutscher, der mit »Hü!« und »Hott!« seine Peitsche schwang, fühlte sie sich, hoch oben in wehender Luft und die Landstraße weithin überblickend, auf königliche Weise frei. Und über alles liebte sie den atemberaubenden Vorgang, wenn eines der Pferde seinen Schweif hob und, gemächlich weiterstapfend, einige wohlgeformte Äpfel ausschied und fallen ließ.
Jedesmal freute Anna sich auf die Monate in Garsten, auch das weitläufige alte Haus dort liebte sie. Es lag in einem verwilderten Garten, der ihr unendlich groß und geheimnisvoll erschien. Die Obstbäume waren alt und mächtig, und es gab je nach Jahreszeit Kirschen, Marillen, Äpfel oder Birnen, die überreif herabfielen und im dichten Gras lagen, bereit, aufgeklaubt und verspeist zu werden. Vor allem, als der Krieg die Menschen in der Großstadt Hunger leiden ließ, ging es der Familie auch dank des Garstner Obstgartens vergleichsweise gut. Anna nahm vom Kriegsgeschehen nicht allzuviel wahr, vor allem, da dem Vater seiner Zuständigkeit nach Bayern wegen, die Einberufung in die k.u.k.-Truppen erspart geblieben war. Ihre Eindrücke hatten mit besorgt wirkenden Eltern, seufzenden Gesprächen der Erwachsenen, spartanischen Mahlzeiten und vor allem mit trostlos immer wieder ausgebesserter Kleidung zu tun. Nie gab es ein eigenes neues, hübsches Kleid, stets wurden, wenn man aus einem herauswuchs, Rock und Taille mit Stoffresten verlängert, damit man es weiter tragen und dann noch der jüngeren Schwester vererben konnte.
Nur als der Bruder der Mutter als gefallen gemeldet wurde, erlebte sie Anzeichen von Klage und Schmerz, jedoch wurden die Kinder vor den heftigsten Aufwallungen meist schnell weggeschickt. »Geht spielen«, wurde ihnen mit feuchten Augen befohlen.
Als der Krieg begann, war Anna fünf Jahre alt. Sie besaß einen ungewöhnlich starken Eigenwillen, sonderte sich gerne ab und konnte oft stur auf ihren Wünschen und Vorstellungen beharren. Am liebsten befand sie sich auf dem Land. Und das wohl auch, weil sie dort, im Gegensatz zur Wiener Wohnung, von familiärer Enge verschont blieb.
Wenn dies der Fall war, konnte sie ihre Familie sogar einigermaßen gut leiden. Minnie, die ältere Schwester, begegnete ihr ohnehin meist ruhig und freundlich, und die Mutter benahm sich, von ihrer Bigotterie abgesehen, so wie Mütter sich eben zu benehmen hatten.
Kam aber Franz Goetzer am Freitag abend mit der Eisenbahn aus Wien angereist, um über das Wochenende bei der Familie zu bleiben, dann hatte Anna seinen Besuch schon den ganzen Tag lang sehnsüchtigen Herzens erwartet. Man begab sich meist viel zu früh zur kleinen Bahnstation, um den Vater abzuholen, die Mutter in weißer Sommertoilette, die Mädchen in den bunt ausgebesserten Kleidchen, Krieg hin oder her, sie wollten alle hübsch sein, wenn der Vater erschien. Und vor allem Anna wollte das.
Wenn er lachend aus dem Zug sprang, den Hut vom Kopf nahm, und jede von ihnen innig umarmte, genoß Anna dies wie eine himmlische Segnung. Sobald sie den Vater sah, war sie glücklich. Und sie blieb es auch, wenn er ab und zu unbeherrscht und streng wurde, wenn er schalt, weil sein Glas frisch gezapftes Bier, aus dem nahen Gasthaus herbeigeholt, nicht pünktlich zum Essen auf dem Tisch stand oder weil die Mädchen lärmten, während er sein nachmittägliches Schläfchen halten wollte.
Unklar blieb, ob die Mutter den Vater ebenfalls die Woche über herbeisehnte und was zwischen den Eheleuten geschah, wenn sie sich zurückzogen. Jedenfalls schien Hermine in ihrer Frömmigkeit sich nie all das vorzustellen, was die kleine Anni sich erstaunlich bald vorstellen konnte. Detailgenau malte sie sich aus, wie der Vater als einsamer Junggeselle die Wochentage in der Stadt zubrachte. Sie sah ihn zwar in seiner Werkstatt, sah ihn künstlerisch arbeiten, aber danach nur von herrlich schönen Frauen umgeben, er der strahlende Mittelpunkt. Anna war ein überreich mit Phantasie begabtes Mädchen und witterte zudem früh das Geschehen zwischen Mann und Frau. Vielleicht auch, weil sie früh ihren Vater zu lieben begonnen hatte.
*
Die Kriegsjahre verbrachten Mutter und Töchter vermehrt in Garsten, nicht nur den Sommer über zog man sich aufs Land zurück. Dort herrschten nach wie vor Verhältnisse, die man als friedlich einschätzen konnte, und es gab genügend Lebensmittel, um sich einigermaßen satt zu essen. Daß auf den Schlachtfeldern gestorben wurde, daß auch in Garsten Väter und Söhne beklagt wurden, daß allerorten Hunger und Elend herrschten, all das wurde weitgehend von Anna ferngehalten.
Da sie das dörfliche Leben genoß, den ganzen Tag über frei herumstreunte, freier, als es kleinen Mädchen sonst gestattet war, wurde die Rückkehr nach Wien für sie stets zu einer trüben Erfahrung. Man hatte Anna, ohnehin verspätet, schließlich doch für die erste Klasse der nahegelegenen Volksschule angemeldet. Wenn auch kriegsbedingt nicht allzu regelmäßig, sie mußte zur Schule gehen, ob sie wollte oder nicht.
Und sie wollte nicht. Mehr noch, sie haßte die Schule, und das vom ersten Tag an. Zwar fand sie die Möglichkeit, endlich lesen und schreiben zu lernen, nicht schlecht, aber sie fand, es sei grausam, inmitten einer Horde anderer Mädchen dazu gezwungen zu werden. Ihr fehlte jede Form von Gemeinschaftssinn. Die Mitschülerinnen waren für sie allesamt nur dumme, schnatternde Gänse, sie gewann zu niemandem Zutrauen, auch zur jungen Lehrerin nicht, sie fühlte sich allein und elend und nur Feinden ausgesetzt.
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Such’ dir doch ein nettes Mädel als Freundin aus«, meinte sie, »möglichst eines, das mit dir auch am Sonntag in die Messe geht, zu zweit ist doch alles viel lustiger.«
Daß die Sonntagsmesse je lustig sein könne, und sei es in Begleitung, fand Anna lächerlich und ebenso den Vorschlag, sich ein nettes Mädel zur Freundin zu wählen. Keines der Mädchen fand sie nett, an jedem hatte sie etwas auszusetzen, zu dick, zu häßlich, zu puppig, zu eitel, zu laut, zu ernst, zu oberflächlich, und letztlich fielen sie alle ausnahmslos unter den Sammelbegriff »blöd«.
Minnie, die ältere Schwester, war sanftmütig und um vieles umgänglicher. Sie ging nicht ungern zur Schule und hatte bereits eine »beste Freundin«.
»Was hast du denn gegen die Mädchen in deiner Klasse?« fragte sie, »sind doch alle wie du, und deine Lehrerin ist hübsch!«
»Sie mögen mich alle nicht«, sagte Anna.
»Du magst sie alle nicht!« rief Minnie.
»Stimmt, ich mag sie nicht, und die sind nicht alle wie ich! Keine ist wie ich, und die Lehrerin ist auch blöd!«
»Warum?«
»Weil sie gesagt hat, ich soll nicht frech sein.«
»Vielleicht warst du frech?«
»Ich hab nur gesagt, daß ich sowieso Künstlerin werde, sie braucht mir nicht zu zeigen, wie ich zeichnen soll.«
»Aber das ist frech!«
»Nein, das ist die Wahrheit!«
»Geh Anni!« sagte Minnie, »sei jetzt du nicht blöd!«
Und sie lächelte sanft und überlegen und wandte sich anderen Dingen zu. Wie immer blieb Anna kochenden Herzens zurück und fühlte sich verlassen. Sie bezweifelte nicht, im Recht zu sein, nur wurde sie eben von keiner Menschenseele verstanden. Einzig beim Vater fand sie Zuspruch, aber auch nur, wenn dieser gut gelaunt und nicht allzusehr in seine Arbeit vertieft war.
»Kümmer dich nicht um die Trantschen«, lautete dann sein Kommentar, »mach dein Zeug, lern was, später gehst ohnehin auf die Kunstschul’!«
Das half ihr. Schon das Wissen, daß alle um sie herum Trantschen waren, wie das Lieblingswort des Vaters für von ihm verachtete weibliche Wesen lautete, half ihr. Sie selbst würde eines Tages keine Trantschen sein, sondern Künstlerin. Sie würde die Kunstschule besuchen, Glasmalerei studieren, und die Lehrerin mit ihrem blonden Lockenköpfchen habe ja keine Ahnung!
»Tu halt so, als ob du ihr folgst«, riet der Vater, »spiel die Folgsame und ärger dich nicht.«
Und er beugte sich wieder über seine Arbeit, über einen heiligen Franziskus, den er zwischen Lämmern und Vögelchen aus farbigem Glas herausschnitt, darüber die Taube des Heiligen Geistes, die den ebenfalls heiligen Mann und das Getier vom blauen Himmel herab überwachte.
»So ein schönes Fenster!« entrang es sich Anna voll Bewunderung.
»Ja, für die Kirche zum heiligen Franziskus«, nickte der Vater, »und weißt du, was mir aufgefallen ist?«
»Was denn?«
»Daß der Heilige Geist eine Taube, also ein Tier ist. Und da sagen die Geistlichen, ein Tier hätte keine Seele! Hätte der Herrgott dann ein Tier mitten in seine Dreifaltigkeit hineingesetzt? Ha?«
»Nein!« rief Anna und liebte ihren Vater glühender denn je. Ab nun, beschloß sie, würde sie Tiere ganz anders, viel aufmerksamer beachten und ins Herz schließen, und es beglückte sie, daß die lästige Kirchenfrömmigkeit der Mutter sich ein weiteres Mal als Blödsinn erwiesen hatte.
»Warum darf eigentlich kein Hund in die Kirche?« fragte sie wie nebenbei und scheinbar damit beschäftigt, schnurzuspringen.
»Weil Tiere nicht in die Kirche dürfen«, antwortete die Mutter in mild belehrendem Ton.
»Warum nicht?« Es bereitete Anna diebisches Vergnügen, weiterzufragen.
»Tiere haben keine Seele. Sie sind zwar auch Geschöpfe Gottes, aber ohne eine Seele.«
»Aber der Heilige Geist ist ein Tier!« triumphierte Anna.
»Was?!« schrie die Mutter, sofort einer Gotteslästerung gewärtig.
»Ja, eine Taube!« Anna strahlte.
Die Mutter verstummte und starrte grübelnd vor sich hin. Dann rettete sie sich in den kurzen Satz, den Anna immer wieder hörte, wenn Erwachsene um eine Antwort verlegen wurden. »Das ist was anderes«, murmelte Hermine und fuhr kurzentschlossen damit fort, Wäschestücke von der im Garten aufgespannten Leine herunterzunehmen und in einen Korb zu werfen. Dabei seufzte sie einige Male unzufrieden auf. Anna hingegen war äußerst zufrieden mit sich, die Mutter schien für heute zur Genüge verwirrt worden zu sein.
»Tauben sind aber Tiere, Mama!« trällerte sie nur noch und hüpfte mit ihrer Springschnur über den Kiesweg davon.
*
Der Wiener Garten, seine Versunkenheit inmitten der Stadt, seine Ungepflegtheit während der Kriegsjahre, die ihn umso ungebärdiger wuchern und blühen ließ, wurde zu Annas Zuflucht. Wenn die Schule oder die Familie sie bedrängte, flüchtete sie zwischen die Himbeersträucher oder ins Gartenhäuschen, um sich Träumen hinzugeben. Aber auch, was unbedingt für die Schule vorbereitet werden mußte, erledigte sie gern im Salettl, da konnte sie für sich sein, unbelästigt, und nur vom Kastanienlaub behütet.
Im Winter, wenn es zu kalt war, sich draußen aufzuhalten, mußte sie am großen Eßzimmertisch ihre Hausaufgaben machen, neben den Schwestern, deren Geschwätz und Gekicher sie nicht teilen mochte. Nebenan in der Küche rumorte die Mutter, kam ab und zu herüber, mit guten Ratschlägen oder einer Jause, und die Töchter immer wieder zur Frömmigkeit ermahnend. Unten in der Werkstatt wiederum war es zu kalt für Anna, um untätig dabeizustehen und zuzuschauen, wie der Vater und seine Gehilfen, alle mit dicken Wollwesten und Mützen ausgerüstet, ihren Glasereiarbeiten nachgingen. Man jagte sie mit »Nix wie weg, hier erfrierst uns ja!« wieder in die Wohnung hinauf. Die Wintermonate mit ihrer häuslichen Enge waren für Anna so niederdrückend, daß sie sogar weniger laut stöhnte und schimpfte, wenn sie an kalten Wintermorgen aus dem warmen Bett kriechen und zur Schule eilen mußte.
Aber kaum wurde es Frühling, kaum wurden die Tage länger und wärmer, setzte ihre innere Revolte wieder unvermindert ein. Sie schleppte sich schlechtgelaunt und maulend Richtung Schule, ertrug die trüben Stunden dort mit Mühe, eilte nach Hause, verbarg sich bald im Garten oder sah dem Vater bei seiner Arbeit zu.
Doch Glanz erhielt das Leben erst wieder, wenn die Wochenenden oder Urlaubstage in Garsten möglich wurden, wenn Anna frei durch den Obstgarten oder das Dorf streifen, sich alle ihre Geschichten ausdenken und verträumt den Besuch des Vaters erwarten konnte. Nur dann war sie glücklich.
*
Das Kriegsende brachte vorerst keine einschneidende Veränderung für die Familie. Weiterhin galt es, gegen den Mangel an Nahrungsmitteln anzukämpfen. Aber durch die Umsicht der Mutter und die Fähigkeit des Vaters, seinen Betrieb den Anforderungen der Nachkriegszeit anzupassen, gelang es, bitterem Hunger oder Verarmung zu entgehen, ein Schicksal, das rundum vielen Menschen nicht erspart blieb. Nur die arme Großmutter Seipel trauerte um ihren Sohn. Mutter Hermine, den Bruder vermissend, besuchte sie oft, um gemeinsam zu weinen oder sie zu trösten.
Die Wohnung der Großmutter lag nur ein paar Häuser entfernt in derselben Gasse, manchmal wurde eines der Goetzer-Mädchen an der Hand gepackt und mitgeschleift. Zumindest für Anna bedeutete es stets Gewaltanwendung, zur Großmutter befördert zu werden, sie konnte deren mit Möbeln und Nippes vollgestopfte, ungelüftete Räume kaum ertragen. Außerdem erschienen dann meist auch die Schwestern der Mutter, Tante Lilli und Anna-Tant’ genannt, die, schluchzend den toten Bruder beklagend, Unmengen von selbstgebackenem Streuselkuchen oder Topfenstrudel vertilgten und dazu aus großen Tassen Milchkaffee schlürften. Anna litt an der Unappetitlichkeit der mit Kuchenbröseln und Kaffeerändern umkränzten, welken Lippen. Und sie rochen nicht gut, die Tanten, sie wirkten verschwitzt und ungewaschen. Die Großmutter hingegen muffelte nur ein wenig nach Kampfer und war trotz ihres Alters eine nicht unansehnliche, zierliche Frau. Ihr schneeweißes Haar, vom Mittelscheitel aus in sorgsame Wellen gelegt, umschloß eng den Kopf und endete in einem Nackenknötchen. Aber um diese Wellen nicht zu stören, trug sie ständig ein Haarnetz, das ihr bis tief in die Stirn reichte. Damit sah sie blöde aus, wie eine Idiotin, fand Anna.
»Warum läßt du deine Haare nicht frei, Großmutter?« fragte sie einmal, »warum müssen sie dauernd in diesem Käfig sein?« Sofort griff Mutter Hermine ein. »Frag nicht immer so dumme Sachen, Anni!« rief sie. Die Großmutter aber winkte ab. »Laß das Kind«, sagte sie und sah grübelnd vor sich hin.
»Weißt Anni – ich glaube, das hält mir den Kopf zusammen«, antwortete sie dann, »vielleicht würde er mir sonst zerspringen.« Und sie begann wieder leise zu weinen.
»Du bist ein schreckliches Kind«, schalt Hermine am Heimweg. »Was du für Ideen hast! ›Die Haare im Käfig‹ – wo die Mutter eh so traurig ist wegen dem Hans!«
*
Als die Zeiten sich besserten, dachte man in gutbürgerlichen Familien wieder vermehrt über eine möglichst gute Erziehung der Kinder nach. Im Hause Goetzer waren es vier Mädchen, die als junge Frauen eine seriöse weibliche Bildung in die wohl unausweichliche Ehe mitbringen sollten. Für Hermine galten da vor allem religiöse Hingabe und häusliche Fertigkeit, die geschult werden sollten, und oftmals ereiferte sie sich über das Desinteresse des Gatten an dieser Lebensvorbereitung. Dem aber lag, bei aller Zuneigung zu den anderen Mädchen, ausschließlich an Annas künstlerischer Fortbildung, und er dachte dabei keineswegs an einen künftigen Ehemann, sondern an die Zukunft seiner Glasmalerei. Er stellte mit Befriedigung fest, daß Anna in der Schule und oft auch aus Langeweile daheim ausnehmend gut zeichnete. Er unterzog ihre Blätter einer eingehenden Prüfung, und sogar viele der von ihr nur hingeworfenen Skizzen hob er auf und sammelte sie in einer Mappe, die unten in der Werkstatt auflag. Für Anna war diese Mappe der größte Stolz ihres jungen Lebens, und sie sorgte dafür, daß Zeichnungen und kleine Malereien immer häufiger und wie beiläufig in der Wohnung herumlagen, um dem Vater in die Hände zu fallen.
Jedoch gab es noch eine künstlerische Domäne, der sie sich mit wachsender Begeisterung hinzugeben begann. Eines Tages war von den Eltern beschlossen worden, daß ein junges Mädchen aus gutem Hause das Klavierspiel zu erlernen habe, und alle vier Mädchen wurden aufgefordert, bei Frau Maria Raum regelmäßig zum Klavierunterricht zu erscheinen. Während die Schwestern sich dieser Aufforderung, die letztlich einem Befehl gleichkam, nur lustlos fügten, begann für Anna ein neues Paradies aufzublühen. Das der Musik.
Maria Raum hatte als Pianistin nicht die Karriere erzielt, die ihr vielleicht in jungen Jahren vorgeschwebt hatte. Es war zu ihrer Zeit ein Hindernis gewesen, dafür als Frau geboren zu sein, und dann trat auch noch der Krieg erschwerend dazwischen. Jetzt war sie nicht mehr jung, alleinstehend und gefordert, sich mit Hilfe des Unterrichtens finanziell und auch seelisch über Wasser zu halten. Ihre Wohnung befand sich nur ein paar Straßen von der Schulgasse entfernt, die Fenster führten in einen baumbestandenen Innenhof hinaus. Das Klavier stand mitten im großen Zimmer, das kaum möbliert war und deshalb für Anna den Eindruck eines Tempels erweckte. Diese Klavierlehrerin liebte das Klavierspiel und die Musik, das wurde dem Mädchen schnell bewußt, nachdem es seine erste Stunde bei ihr genommen hatte. Junge Menschen zu unterrichten, schien für die erfolglose Solo-Pianistin nicht nur eine finanzielle Notwendigkeit geworden zu sein, sondern ihr auch Freude zu bereiten. Jedenfalls leuchtete Anna aus dem feinen Gesicht mit den leicht geröteten Wangen und glänzenden Augen etwas entgegen, das einer solchen Freude entsprach und schnell auf sie übergriff. Auch Anna widmete sich den anfänglichen Übungen und langsamen Fortschritten am Klavier mit Hingabe. Sie bemühte sich, keine Stunde bei Frau Raum zu versäumen, und übernahm sogar immer wieder welche, die ihre Schwestern gern einem leichten Schnupfen oder irgend einer anderen angeblichen Unpäßlichkeit opferten. »Sei so gut, geh doch du heute zur Raum, Anni«, wurde sie dann gebeten, »du magst es ja so, dieses langweilige Herumgeklimpere.«
Ja, sie mochte es. Nie wurde für sie das Erlernen des Klavierspiels zum langweiligen Herumgeklimpere, im Gegenteil, die Stunden bei Frau Raum schienen ihr viel zu schnell zu verfliegen. Und mehr noch, auch sie begann das Musizieren zu lieben.
»Du machst wirklich wunderschöne Fortschritte, Anna«, sagte die Lehrerin eines Tages zu ihr. Sie saßen nebeneinander vor dem Flügel und hatten gerade vierhändig gespielt. Frau Raum legte jetzt ihre Hände in den Schoß und betrachtete Anna mit einem gedankenvollen Blick. »Du bist sehr begabt dafür, weißt du das?«
»Ich weiß, daß ich es gern tu«, antwortete Anna schlicht.
»Eben«, sagte Frau Raum lächelnd.
Ein Sommernachmittag flüsterte in den Bäumen im Hof.
»Laß uns noch ein wenig zuwarten«, fuhr die Lehrerin fort, »aber ich möchte unbedingt, daß du eines Tages vor Publikum spielst.«
»Vor Publikum?« fragte Anna entgeistert.
»Ja. Weißt du es nicht?«
»Was?«
Annas Frage klang mißtrauisch und Frau Raum lächelte wieder.
»Tu nicht so, als hätte ich einen Überfall auf dich vor«, sagte sie dann. »Die Sache ist ganz harmlos. Ich gebe jedes Jahr ein kleines Konzert im Festsaal des Plachel-Wirtes und stelle dabei meine begabtesten Schüler einer Runde interessierter Menschen vor. Natürlich besteht das Publikum hauptsächlich aus den Familienangehörigen der Auftretenden, aber auch aus ein paar Leuten aus der Musikwelt, die mich noch von früher her kennen. Meist findet dieses Konzert vor den Ferien statt, ehe alle in die Sommerfrische verschwinden.«
»Ich mag kein Publikum«, sagte Anna.
»Warum denn nicht? Willst du nicht anderen Menschen zeigen, was du erlernt hast?«
»Nein«, antwortete Anna mit Bestimmtheit.
»Nein?«
»Ich mag andere Menschen nicht.«
Maria Raum lachte auf.
»Aber wir leben alle zwischen anderen Menschen und sollten sie deshalb auch ein wenig mögen, findest du nicht? Und ihnen auch zeigen, was wir können!«
»Ich finde, daß die meisten anderen Menschen fremde Menschen sind. Warum soll ich denen etwas zeigen?«
»Aber du willst doch Künstlerin sein«, sagte Frau Raum, ernst geworden, »deine Mutter hat mir erzählt, wie gut du zeichnest und malst und daß dein Vater dich auf die Kunstakademie schicken will.«
»Wenn ich zeichne, habe ich dabei kein Publikum«, antwortete Anna, »da bin ich ganz für mich.«
»Aber später – da willst du doch auch, daß Menschen, fremde Menschen, sich das anschauen, was du geschaffen hast.«
Anna schwieg.
»Und wenn ich dir zuhöre, weil du gut spielst, magst du das doch auch, oder?«
»Vor Ihnen hab ich keine Angst«, sagte Anna.
»Eben.« Frau Raum lächelte wieder. »Und nach einiger Zeit wirst du auch vor einem Publikum keine Angst mehr haben. Komm, laß uns weiter arbeiten.«
*
Anna liebte das Klavier so sehr, daß die Eltern ein Pianino für die Mädchen erstanden, auf dem meist einzig sie übte und spielte. Das aber nur, wenn sie sicher sein konnte, daß niemand allzu aufmerksam zuhörte. Sobald etwa die Mutter ihre Schürze abnahm, sich neben sie setzte und mit fordernden Augen eine Darbietung erwartete, fand sie rasch eine Ausrede und warf den Klavierdeckel zu. Sie lief davon, ehe Hermine protestieren konnte, sondern nur kopfschüttelnd aufstand und ratlos ihre Schürze wieder umband.
»Du bist mir Eine«, murmelte die Mutter meist, und es wurde dies eine stetig wiederkehrende Bemerkung zum Verhalten dieser Tochter, die sich ihrer Meinung nach immer ungebärdiger und seltsamer aufführte, je älter sie wurde.
»Laß die Anni in Ruh«, sagte der Vater nur, wenn sie sich bei ihm deshalb zu beklagen versuchte, »sie ist halt eigenwillig, eben eine Künstlernatur.«
»Ein frecher Besen ist sie«, brummte Hermine, die mit Künstlernaturen nur den sicheren Mangel an Frömmigkeit verband, »mehr in die Kirche sollt’ sie gehen!«
Darauf antwortete ihr Gatte mit einem Schweigen, an dem, wie sie wußte, nicht mehr zu rütteln war, und sie ging aufseufzend wieder ihren häuslichen Pflichten nach.
Die Gewißheit, vom Vater verteidigt zu werden, ließ Anna ihn noch tiefer lieben, er würde sie immer verstehen und beschützen, dachte sie. Für ihn wollte sie Künstlerin werden und seine Arbeit fortsetzen, das schien ihr Lebensauftrag zu sein, und sie bejahte ihn voll. Aber auch wenn jemand ihr beim Malen oder Zeichnen über die Schulter zu spähen versuchte, ließ Anna das nur ungern zu.
»Was hast du denn?« fragte Minnie kopfschüttelnd, als sie sich eines Tages beim Vorbeigehen neugierig über sie gebeugt und Anna wieder einmal beide Hände wie schützend über ihr Werk gelegt hatte, »ich schau’ dir schon nix weg!«
Vielleicht doch, dachte Anna.
Nur der Vater sollte begutachten, was sie skizziert, gezeichnet, gemalt hatte, der Rest der Familie würde ohnehin nicht verstehen, was ihre Blätter ausdrückten, davon war sie überzeugt. Es gab kaum jemanden in ihrem Umfeld, den Anna nicht als fremd einstufte. Nur wenige Mitmenschen gab es, die ihr Vertrauen gewannen.
War es der Ekel vor der Frömmigkeit der Mutter? Die übermäßige Liebe zum Vater? Die räumliche Enge zwischen den Schwestern, die bereitwillig einem Leben zusteuerten, mit dem sie nichts zu tun haben wollte? Einem Durchschnittsleben, gegen das sie im geheimen revoltierte? Anna wollte besonders sein. Und genau dieser Ehrgeiz trieb sie in die Isolation, in Scheu und Argwohn. Das Besondere, dachte sie, kann sich mit niemandem gemein machen. Also vermied sie Gemeinsamkeiten, sei es in der Schule oder in der Familie. Mehr und mehr stilisierte sie sich zur Einzelgängerin. Im Wiener Garten und im ländlichen Garsten suchte sie die Segnungen der Natur aufzufinden, jedoch stets als ihr einsamer Gast. Allein streifte sie umher, allein saß sie im Salettl, träumend oder zeichnend, nie bat sie um Gesellschaft oder Begleitung.
»Was ist denn mit dir los?« fragte die Mutter.
Sie fragte es mit Besorgnis in der Stimme, als Anna sich wieder einmal rüde ihrer Annäherung entzogen hatte. »Warum darf man bei dir nie wissen, was du so im Kopf hast? Ich hab’ dich doch nur gefragt, wie’s in der Schule war, und du rennst vor mir weg wie vor dem Teufel!«
Genau, dachte Anna, aber sie sagte: »Ich hab’ gar nicht so viel im Kopf.«
»Sei nicht frech!« wies die Mutter sie zurecht. Ihre Besorgnis hatte sich rasch wieder in Tadel verwandelt. »Jeder Mensch hat etwas im Kopf, nur bei dir kommt man nie dahinter. Was weiß ich, warum du so eine Geheimniskrämerin bist. Schau deine Schwestern an, die erzählen mir alles.«
»Das glaubst du nur«, sagte Anna, und der verwirrte Blick der Mutter tat ihr richtig wohl, »die haben auch ihre Geheimnisse.«
»Geh hör auf, die andern Mädeln sind nicht wie du, die wissen, was sich gehört, und lügen mich nie an.«
»Nicht lügen und nicht alles sagen ist nicht dasselbe.«
»Du mit deinen Weisheiten, Schluß jetzt.«
Hermine rauschte davon, und Anna fühlte sich erneut in ihrem Gefühl bestätigt, daß nur Dummheit und Unverständnis sie umgaben. Daß außer dem Vater und der Klavierlehrerin kaum Menschen zu existieren schienen, die ihrer Beachtung wert waren. Daß die Frömmigkeit eine teuflische Macht auf Menschen ausübe und daß Gott eine Lüge sei.
*
»Glaubst du an den lieben Gott?« fragte sie eines Tages den Vater. Sie stand in der Werkstatt neben seinem Arbeitstisch und sah zu, wie er die bunten Glasteile mit heißem Blei zueinanderfügte. Eine bläuliche Flamme loderte aus dem Gerät in seiner Hand, dieser Vorgang erzeugte ein ohrenbetäubendes Zischen und es roch beißend. Die Luft legte sich einem schwer auf die Brust.
»Was willst wissen?« schrie ihr der Vater zu.
»Ob du an den lieben Gott glaubst!«
Er lachte auf, so laut, daß es das Lärmen übertönte. »Grade jetzt willst das wissen?«
»Wenn es geht, ja, Papa.«
Da stellte er die wild sausende Flamme ab und Stille trat ein. Er legte das Gerät beiseite, schob sich die dunkle Brille von den Augen, setzte sich nieder und schaute Anna an.
»Du hörst von der Mama ein bissel zu viel vom lieben Gott, stimmt’s?«
»Ich kann einfach nicht an ihn glauben«, antwortete Anna, »alle sterben, und da soll dieser Herr Gott gut auf uns aufpassen?«
Der Vater lächelte, schwieg eine Weile und sah sie nochmals gedankenvoll an.
»Weißt«, sagte er dann, »›lieb‹ ist vielleicht genau das falsche Wort. In deinem Alter merkt man natürlich, daß es auf der Welt nicht lieb zugeht und daß man es als Mensch nicht grade leicht hat. Aber ich glaube schon daran, daß es da etwas über uns gibt oder um uns herum, ist ja egal wo, das – ja, das mehr ist als wir Menschen. Größer. Weiter. Schau, all die Heiligen, die ich auf Glas male, die waren doch nicht durch die Bank Dummköpfe. Die haben schon gewußt, warum sie für etwas leben, das sie halt Gott genannt haben, oder Vater oder Herr. Sagen wir so, Anna. Ich glaube nicht an den lieben Gott, aber ich glaube an Gott. An ein höheres Wesen.«
»Und an die Jungfrau Maria?«
»Mit der laß mich bitte in Ruh!« Der Vater stand auf, um weiterzuarbeiten. »Die halt’ ich nicht aus. Aber sag das bitte nie der Mama, sie betet besonders gern zur Jungfrau Maria. Also stillgeschwiegen, ja?«
Er schmunzelte ihr zu.
»Ja«, sagte Anna.
»Ehrenwort?«
»Ehrenwort!«
Sie war inbrünstig erfüllt von ihrem Einverständnis mit dem Vater und verließ seine Werkstatt hocherhobenen Hauptes. Diese unbefleckte Jungfrau Maria, die trotzdem ein Kind geboren hatte, die war ihr immer schon suspekt gewesen. Natürlich würde sie der Mutter kein Wort von dem sagen, was der Vater von der Muttergottes hielt, aber daran denken, wenn Rosenkranz gebetet werden mußte oder sie die Marienstatue mit frischen Blumen schmückten, das könnte sie jetzt jedesmal tun. Und dann wäre es so, als befände sie sich weitweg und hätte mit diesen törichten Beweihräucherungen nichts zu tun.
Die Kraft der eigenen Gedanken wurde Anna nicht nur im Hinblick auf religiöse Behauptungen mehr und mehr bewußt. Wie Gedanken ein anderes Leben schenken können, eines, das ermöglicht, dem öden Alltag zu entrinnen, wie sie eine innere Welt erschaffen, in die man sich zurückziehen kann, das erfuhr sie auch kraft der Bücher, die sie immer reichlicher zu lesen begann. Sie liebte Lyrik und Balladen. Wohl als einzige in der Schulklasse, denn die Mitschülerinnen fanden »dieses Geschwafel fad«. Sie nicht. Sie, die alles andere in der Schule fad fand, war für Dichtung zu begeistern.
Bald versuchte Anna sich in kleinen Gedichten, die sie aber meist wieder schamvoll verwarf. Sie zerriß die Zettelchen, auf die sie Verse notiert hatte, gleich wieder, damit nur ja keiner sie fände. Ich kann’s ja nicht, dachte sie, ich kann ja nicht dichten. Ich würde es nur gern können.
Ähnliches sagte sie, als die Klavierlehrerin sie eines schönen Tages aufforderte, doch im nächsten Schülerkonzert vor den Sommerferien mitzuwirken. Anna erschrak tödlich.
»Ich kann’s ja nicht!« rief sie aus.
Frau Raum lachte. »Natürlich kannst du’s. Sonst würde ich dir doch nicht zumuten, vor Publikum zu spielen. Du bist eine meiner besten Schülerinnen geworden.«
»Ich kann nur hier bei Ihnen gut spielen.«
»Was man kann, kann man.« Frau Raum sah sie, ernst geworden, an. »Auch woanders als hier bei mir. Du mußt deine Menschenscheu überwinden, Anna. Die Menschen fressen dich nicht. Sie hören gern zu, wenn jemand gut Klavier spielt.«
»Haben sie denn Ihnen immer gern zugehört?«
Anna wollte das Thema wechseln, aber auch bei Frau Raum ein klein wenig Unsicherheit aufdecken. Die aber durchschaute ihr Manöver und lachte wieder.
»O ja, meine Liebe! Die Menschen haben mir immer gern zugehört – wenn welche da waren! Ich hatte nur keinen geschickten Impresario, die wollten alle nur Männer am Klavier, und niemandem lag daran, für mich junge, unbekannte Pianistin einen Konzertsaal zu füllen. Ich konnte also immer nur in kleinem Rahmen spielen, und als dann der Krieg ausbrach, hörte auch das auf.«
»Hätten Sie keine Angst gehabt in einem Konzertsaal voller Leute? Vor so vielen Menschen?« fragte Anna.
Da wandte die Klavierlehrerin den Blick ab und sah in die Bäume hinaus. Kurz kam es Anna so vor, als stiegen Frau Raum Tränen in die Augen, aber das mußte wohl ein Irrtum sein, denn sie lächelte gleichzeitig, als hätte sie ein wunderschönes Bild vor sich.
»Nein«, sagte sie, »nein, ich hätte davor keine Angst gehabt. Im Gegenteil, ich hätte mich darüber sehr gefreut. Und mein Bestes gegeben.«
»Aber Sie haben doch immer noch so viel Bestes, um es zu geben!« rief Anna. »Warum suchen sie sich nicht jetzt so einen geschickten Impresario, jetzt mögen die Leute vielleicht auch Frauen am Klavier, und der Krieg ist schon lange vorbei!«
Da lachte Frau Raum wieder.
»Jetzt bin ich zu alt«, sagte sie.
»Aber sie spielen doch so schön! Egal, wie alt Sie sind!«
»Zu alt ist zu alt und zu spät ist zu spät«, sagte Frau Raum. »Aber nicht bei dir, bei dir ist noch gar nichts zu spät, Anna, und du wirst mir die Freude machen, bei dem heurigen Abschlußkonzert im Plachel-Saal mit der Schumann-Romanze aufzutreten, die du so magst und so schön spielst. Ja?«
»Ich mache Ihnen gern eine Freude, Frau Raum, aber…«
»Eben. Es ist also abgemacht.«
Anna wagte keinen Einwand mehr vorzubringen und nickte. Aber schweren Herzens verließ sie die Lehrerin. Und am Heimweg wurde ihr sogar leicht übel.
*
Anna ging bereits in die Hauptschule, die blonden Locken ihrer Kindertage waren leicht gewelltem, brünettem Haar gewichen, erste weibliche Formen begannen sich unter den immer noch üblichen Hängekleidern abzuzeichnen. Aber sie würde zu keiner großgewachsenen Frau werden, sondern klein und zierlich bleiben, das stellte sie bald vor dem Spiegel fest. Blöd ist das, dachte sie, wo ich doch nicht so fesch bin wie der Vater, da sollte ich später wenigstens groß und schlank sein!
Es war ein besonders warmer, üppiger Frühsommertag, als gegen Abend das Schülerkonzert stattfinden sollte. Anna hatte seit dem Morgen Schüttelfrost und mußte sogar einmal erbrechen, sie fühlte sich, als würde sie im Plachel-Saal zum Schafott gebracht werden, und nicht an ein Klavier. Mehrmals übte sie am heimischen Pianino die Schumann-Romanze, der Vater ging vorbei und brummte wohlgefällig, während sie sich vor Aufregung ständig verspielte. Sie erhielt von der Mutter ihr bestes, weißes Sonntagskleid frisch gebügelt überreicht, die ganze Familie war zum Konzert geladen und sah Annas Auftritt mit Neugier entgegen. Sie aber meinte vor Angst sterben zu müssen.
Als sich die für das Konzert ausgewählten Schüler und Schülerinnen im kleinen Nebenzimmer des Gasthauses versammelten, fiel Annas Verfassung sogar der Klavierlehrerin auf.
»Was ist denn los mit dir, Anna?« fragte sie, »du bist mir ein bißchen zu blaß.«
»Ich fürchte mich«, sagte Anna.
»Kein Grund! Spiel einfach so wie immer!«