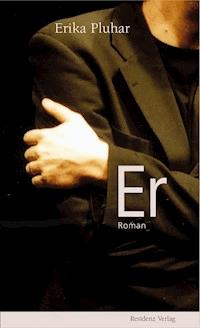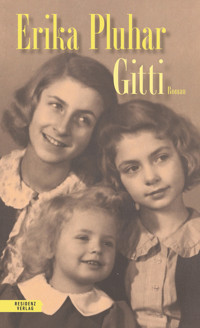Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erinnerungen einer Ausnahmekünstlerin.Ein Journalist bittet die prominente Künstlerin, ihm ihre Lebensgeschichte zu erzählen, da er eine Serie in seiner Zeitung publizieren will. Zuerst noch misstrauisch, fasst sie jedoch bei seinen täglichen Besuchen langsam Vertrauen und beginnt zu erzählen: von ihren zwei Ehen, von ihren Theatererfahrungen, von ihrem Weg zur Schriftstellerin und von den Menschen, die ihr Leben maßgeblich prägten. Über die Höhen und Tiefen eines Lebens in der Öffentlichkeit. Erika Pluhar hat mit "Die öffentliche Frau" eine andere Art der Autobiografie geschrieben: zwischen Fiktion und Realität. Persönlich, berührend und fesselnd.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Pluhar
Die öffentliche Frau
Eine Rückschau
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2013 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4359-9
ISBN mobi:978-3-7017-4405-3
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1618-0
Meiner Tochter
1
Der Redakteur hat das Aufnahmegerät so vorbereitet, daß die Frau gut verständlich sein würde, selbst wenn sie sich im Gespräch zurücklehnen oder nach vorn beugen sollte. Er erwartet sie.
Das Zimmer, in das man ihn gebeten hat, ist hell, Nachmittagssonne fällt herein. Vor den Fenstern breitet sich ein Garten aus. Laubbäume sind zu sehen.
Die Frau lebt nicht schlecht, denkt der Redakteur. Er sitzt auf einem weiß bezogenen Sofa und hätte große Lust zu rauchen. Geht aber nicht, klar, daß man im Haus dieser Frau genausowenig rauchen darf wie überall sonst in diesen Zeiten. Der Redakteur seufzt auf und wird ein wenig ungeduldig.
Sie läßt sich Zeit, denkt er, die Leute, die man interviewen muß, lassen sich immer Zeit. Sie sitzen am längeren Hebel. Sie lassen einen warten. Glauben wohl, zu fragen sei leichter als zu antworten, dabei ist nichts schwieriger, als auch nur eine richtige Frage zu stellen. Noch dazu bei dieser Frau, die schon so lange in der Öffentlichkeit sichtbar ist, daß jeder, der von ihr weiß, sie auch zu kennen meint. Oder zumindest ein Bild von ihr hat. Bis auf die ganz Jungen natürlich, die wissen nichts mehr von ihr. Was frage ich sie denn wirklich, denkt der Redakteur und seufzt nochmals auf. Es müsse ein ultimatives Interview werden, umfassend, forderte der Verlag. Er sei der einzige, der das könne, mit dieser Schmeichelei hatte die Chefetage ihn weich gemacht und losgeschickt. Wo bleibt sie denn nur, die Frau.
Als er Schritte hört, springt er auf. Das muß sie sein, denkt er und steht aufrecht da, unbeholfen wie ein Schüler in Erwartung seiner Lehrerin.
Die Tür öffnet sich mit Schwung.
Nicht bös’ sein, sagt die Frau, sie ist ein wenig atemlos und lächelt, ich mußte leider ein unumgängliches Telefonat zu Ende führen.
Nein, nein, natürlich, antwortet der Redakteur.
Er und die Frau reichen einander die Hände, dann nimmt sie Platz, wie er es für sie vorgesehen hat, genau im richtigen Abstand zum Aufnahmegerät. Das nenne ich Professionalität, denkt der Redakteur. Setzen Sie sich doch, sagt die Frau, hat man Ihnen schon etwas angeboten?
Nein, aber danke, ich möchte nichts.
Keinen Kaffee? Tee?
Nein danke.
Wollen Sie rauchen?
Wie bitte? fragt der Redakteur ungläubig.
Bei mir darf man gerne rauchen, sagt die Frau, solange man mir nicht das Zimmer vollqualmt und ich jederzeit die Fenster öffnen kann, habe ich gar nichts gegen eine Zigarette. Da drüben steht ein Aschenbecher.
Ja dann, gern, sagt der Redakteur.
Eine jüngere Frau tritt ins Zimmer, sie trägt Jeans und hat ein frisches, rotwangiges Gesicht. Soll ich etwas bringen? fragt sie.
Ja, bitte eine große Kanne Tee, für den Herrn auch eine Tasse, danke Sofia, sagt die Frau.
Sofia geht, die Frau lehnt sich zurück und sieht dem Redakteur dabei zu, wie er sich eine Zigarette ansteckt. Verzeihen Sie – wollen Sie vielleicht auch eine? fragt er. Später, sagt die Frau, aber lassen Sie uns zur Sache kommen. Worum soll es also in Ihrer Geschichte gehen? Natürlich um Sie, gnädige Frau!
Der Redakteur findet, daß er mit diesem Ausruf zu laut geworden ist, und versteht das leichte Stirnrunzeln der Frau. Was habe ich denn, denkt er, ich glaube, sie macht mich nervös.
Sie wissen ja, sagt er jetzt in normaler Lautstärke, es soll ein großes, biographisches Interview werden, natürlich von Ihnen autorisiert, wir wollen es Woche für Woche in unserer Zeitschrift fortsetzen, aber hat unser Chefredakteur das nicht mit Ihnen besprochen?
Die Frau nickt und schaut aus dem Fenster in die Bäume hinaus. Eine Weile herrscht Stille, und der Redakteur nimmt ratlos einen tiefen Zug aus seiner Zigarette.
Ja, ich weiß, sagt die Frau schließlich, eine Art Fortsetzungsroman.
Aber nein! Der Redakteur hat wieder die Stimme erhoben. Ein umfassendes, ultimatives Interview, eines, in dem Sie all das sagen können, was Sie schon ein Leben lang sagen wollten!
Die Frau wendet sich ihm zu und lächelt. Geben Sie mir auch eine Zigarette, sagt sie.
Der Redakteur hält der Frau die geöffnete Packung entgegen, sie nimmt eine Zigarette, und er gibt ihr Feuer.
Wissen Sie, sagt sie dann, ich habe ein Leben lang schon viel zuviel gesagt, mehr als ich sagen wollte, aber lassen wir’s gut sein. Ich habe Ihrem Chefredakteur versichert, mich auf dieses Befragtwerden einzulassen, also mache ich das jetzt auch. Nur kann ich Ihnen nicht versprechen, wie umfassend und ultimativ Ihr Interview geraten wird. Überhaupt: ultimativ, mein Lieber. Was für ein Wort. Kommt doch von Ultimatum, und das ist eine letzte Aufforderung, oder? Wird doch nicht Absicht Ihres Verlages sein, mich ein letztes Mal zum Interview aufzufordern, ehe ich das Zeitliche segne?
Ich bitte Sie, was für ein Gedanke! Der Redakteur versucht zu lachen. Das hat jämmerlich geklungen, denkt er und dämpft seine Zigarette aus.
Darf ich mein Aufnahmegerät anstellen?
Aber ja, sagt die Frau.
Der Redakteur drückt auf die winzige Taste und setzt sich. Er und die Frau sitzen einander gegenüber.
Also gut, sagt sie, nur weiß ich immer noch nicht, worum es Ihnen bei Ihrer Geschichte geht. Denn Sie sind es, der mit mir spricht, also ist es auch Ihre Geschichte. Es geht mir um Ihr Leben, sagt der Redakteur.
Ui, die Frau lacht, das klingt ja nach Leben und Tod. Nein, nur um Ihre Lebensgeschichte soll es gehen, neu und im Rückblick erzählt. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich jetzt gerne anfangen.
Ihnen fehlt es ein wenig an Humor, sagt die Frau, aber das hängt vielleicht mit Ihrem Beruf zusammen. Wenn man ständig im Leben anderer herumkramen muß, vergeht einem wohl das Lachen. Aber ich will Sie jetzt auch nicht mehr von Ihrer Arbeit ablenken. Obwohl ich nur noch anmerken möchte, daß meine Lebensgeschichte der Öffentlichkeit kaum noch neu zu erzählen sein wird, denn alles, was ich lebte, wurde bereits reichlich veröffentlicht.
Alles? fragt der Redakteur.
Alles, was nicht in meinem Geheimnis blieb, ja. Könnten wir im Gespräch nicht ausnahmsweise auch einmal in dieses Geheimnis vordringen? fragt der Redakteur und lächelt die Frau an.
Nein, sagt sie.
Das war ungeschickt von mir, denkt der Redakteur, und was mache ich jetzt gegen ihr Schweigen. Wie die Frau vor sich hinstarrt. Woran sie jetzt wohl denkt.
Da öffnet sich die Tür, und Sofia trägt ein schweres Tablett mit Teekanne, Tassen, Kuchen, Milch und Zucker ins Zimmer. Aufatmend stellt sie es auf dem Sofatisch ab.
Gut so? fragt sie.
Die Frau nickt. Danke, auch für den Guglhupf! Selbst gemacht, sagt Sofia und geht wieder.
Der Redakteur ist erleichtert, daß etwas geschah, um die Wortlosigkeit zu beenden, und als die Frau beginnt, den Tee in die Tassen zu gießen, will er das Aufnahmegerät eilfertig wieder abstellen.
Lassen Sie nur, sagt sie, Tee und Kuchen stören nicht, wir machen ja gleich weiter. Ich werde jetzt Ihre Fragen beantworten.
Nachdem beide an ihren Teetassen genippt haben, lehnt die Frau sich bequem zurück. Also, sagt sie.
Der Redakteur räuspert sich. Die Kindheit vielleicht? Fangen wir damit an?
Wäre logisch, sagt die Frau.
Was für ein Kind waren Sie also?
Der Frau hat die Frage des Redakteurs offensichtlich nicht gefallen, sie schüttelt abwehrend den Kopf, und er wird verlegen. Dann aber beginnt sie doch zu sprechen.
Ich war vor allem ein Kind. Ein erwartungsvolles, zufriedenes, mit allem kindlichen Reichtum ausgestattetes Kind. Vielleicht sogar war ich ein glückliches Kind. Ja, vielleicht kann man das so sagen. Auf frühen Fotos ist zu erkennen, daß ich vergnügt war, ja, ein vergnügtes kleines Mädchen. Ich hatte gütige Eltern. Wir lebten am Stadtrand, im Grünen, in einer schlichten Wohnung, die weder zu groß noch zu klein war. Und alles hatte für mich ein gesundes Maß, weder Überfluß noch Armut, nichts Besseres für ein Kind, denke ich. Und ich durfte immer spielen, auch das Ernsthafte war für mich immer Spiel. Seit ich denken kann, denke ich mich aus der Realität heraus –
Der Redakteur lächelt. Er merkt sich diesen Satz, das wäre doch eine Überschrift für die erste Ausgabe: Seit ich denken kann, denke ich mich aus der Realität heraus. Und die Frau spricht weiter.
Nicht, daß ich eine weltferne Träumerin gewesen wäre, ich wurde zu einer ausgezeichneten Schülerin, nur gute Noten, ich war pflichtbewußt und ordnungsliebend, ja, ich glaubte an die Welt und an eine in ihr waltende Ordnung. Aber ich wollte auch, daß die Welt meinen Vorstellungen entspräche. Und das bedeutete, daß sie schön zu sein hatte. Daß die Welt und das Leben schön zu sein hatten. Ein Leben ohne Schönheit konnte und wollte ich mir nicht vorstellen, und deshalb erspielte, erdachte und erwartete ich jegliches gemäß meinen eigenen Vorstellungen. Und das ging lange gut so.
Jetzt verstummt die Frau. Der Redakteur nimmt einen Schluck Tee und läßt sie nicht aus den Augen.
So oft schon das Wort: Vorstellung! sagt er dann. So früh bereits dieser Theaterbegriff?
Ich überlegte gerade, wie hoffnungsvoll kindliche Imagination sich Zukunft ausmalt und wie der Lebensweg diesem Entwurf dann nie entspricht. Aber schreiben Sie das nicht.
Nein, nein, natürlich nicht, sagt der Redakteur.
Die Frau sieht ihn an und schüttelt leicht den Kopf. Ich weiß, sagt sie dann, ich sollte vor einem Journalisten nie ein Wort verlieren, das ich lieber für mich behalten möchte. Natürlich werden Sie gerade die Sache mit dem Lebensweg schreiben.
Ich sagte doch nein! beharrt der Redakteur. Sie autorisieren, so ist es abgemacht. Aber eine Frage. War es nicht der Krieg, von dem Ihre frühe Kindheit überschattet wurde?
Lassen wir das, sagt die Frau, davon habe ich schon viel zu oft berichtet, immer wieder, lassen wir den Krieg Krieg sein.
Aber gern, sagt der Redakteur, gern lasse ich den Krieg Krieg sein.
Die Frau lächelt ihn an. Sie haben ja doch ein wenig Humor!
Ab und zu, sagt er.
Die Frau schmunzelt. Also weiter, sagt sie dann.
Ich verkroch mich gern. In der Nähe des Gymnasiums gab es einen stillgelegten Bahndamm, der zu verwilderten Gärten abfiel. Kein Mensch geriet je dorthin. Als ich eines Tages nach der Schule alleine am Nachhauseweg war, entdeckte ich einen Einstieg. In den dicht und undurchdringlich miteinander verwobenen Büschen und Brennesselstauden hatte vielleicht ein Tier, eine Katze vielleicht oder ein Hase, einen Weg gefunden, jedenfalls meinte ich plötzlich einen Zwischenraum zu erblicken, eine Öffnung. Ganz schmal machte ich mich, und es gelang mir hindurchzuschlüpfen. Hindurch und davon. In eine Wildnis, die nur mir zu gehören schien. Ich kauerte zwischen hohem Gras. Ich streichelte Efeublätter und Wurzelwerk. Ich legte mein Gesicht in die wilden Veilchen. Geruch von Erde und Laub umgab mich. Dieses kleine Geviert, dem ich mich mit allen Sinnen hingab, in dem jedes Blättchen, jeder Halm für mich Bedeutung gewann, machte mich zur Liebenden. Oder sagen wir so: es ließ mich eine erste Ahnung vom Wesen der Liebe erfahren.
Das war Ihnen zu viel Naturschilderung, stimmt’s? fragt da die Frau, als kindliche Erfahrung nicht brisant, nicht ultimativ genug, oder? Ich sehe Ihnen Ihre Langeweile an.
Warum diese Ironie, verteidigt sich der Redakteur, obwohl er ein wenig rot geworden ist, bleiben Sie bei Ihren Assoziationen, Sie sind es, die bestimmt.
Nein, das Interesse der Öffentlichkeit bestimmt, und nur deshalb sind Sie hier. Ich weiß das und lasse mich trotzdem darauf ein. Mein Leben ist so ausgiebig veröffentlicht worden, daß ich vollkommen offen sein kann. Das mag paradox klingen. Aber diese Art von Offenheit stellt sich ein, wenn man Öffentlichkeit eines Tages als Verantwortung wahrnimmt. Und nicht als Zirkus. Eben! sagt der Redakteur, so sehe ich das auch.
Ja? fragt die Frau.
Ja, sagt der Redakteur.
Also, machen wir weiter, sagt die Frau, Ihr Gerät läuft und läuft, Sie müssen ja später allzu vieles beiseitelassen. Wer weiß, sagt der Redakteur.
Aber es gab neben dieser Sehnsucht nach völligem Rückzug, nach einem Schlupfwinkel, einen ganz anderen Wesenszug, der mich lenkte. Und das seit eh und je und bis heute. Ich erfand. Ich erfand Leben. Schrieb, zeichnete, tanzte, spielte Phantasie-Figuren. Oder ließ Erfindungen auf mich einwirken. Also Bücher, Filme, Theaterabende. Das war als Kind schon so und hat mich wohl ein Leben lang begleitet. Dieser Drang, der eigenen Existenz zu entfliehen in etwas ihr Fernes, Größeres, Vielfältigeres. Also dem durch Geburt und Lebensweg festgelegten Dasein mit all seinen vertrauten Gegebenheiten eine neue, hinzuerfundene Dimension zu geben. Oder eine rettende andere, wenn Schicksal und Verlust einen erschlagen wollten.
Die Frau hält inne und blickt schweigend vor sich hin. Deshalb sind Sie ja auch Schauspielerin geworden! sagt der Redakteur. Er sagt es in munterem Ton. Ich nehme an, die Frau benötigt das jetzt, denkt er. Weiß man doch um einige Schicksalsschläge in ihrem Leben. Nein, sagt die Frau, ehe ich auf die Idee kam, man könne auf einer Bühne Geschichten erzählen, erzählte ich sie mir schreibend selbst. Ich schrieb, als ich schreiben gelernt hatte, sofort tat ich das, erzählte, illustrierte, erfand Märchen, später kleine Erzählungen. Ich könnte Ihnen eine Erzählung anbieten, die mit meiner Kindheit zu tun hat.
Gerne, sagt der Redakteur.
Warten Sie einen Moment, ich hole das Manuskript und lese Ihnen die Geschichte dann vor. Recht so?
Der Redakteur nickt, die Frau verläßt das Zimmer.
Er stellt das Aufnahmegerät ab und lehnt sich zurück. Angenehm still ist es hier, denkt er. Gesegnete Umstände sind das, in einer so ruhigen Gasse leben zu dürfen. Wenn ich an meine Wohnung denke, Tag und Nacht der Straßenlärm vor den Fenstern! Man gewöhnt sich zwar daran, aber diese Gewohnheit hat nichts Gutes an sich, man stumpft ab.
Die Tür öffnet sich, und die Frau kommt zurück. Sie legt einige Mappen neben sich auf das Sofa, als sie sich wieder setzt. Ich habe gleich anderes mitgebracht, sagt sie, diverse Aufzeichnungen, die wir verwenden könnten.
Prima, sagt der Redakteur nochmals, aber wenn Sie die per Computer –
Nein! unterbricht ihn die Frau. Es sind nicht alle Texte gespeichert, vor allem die frühen nicht, und ich lese es lieber als Teil meines Gespräches mit Ihnen. Auch wenn die Abschrift dadurch mehr Mühe macht, tut mir leid.
Nein, nein, macht nichts.
Diese Erzählung heißt: Die Apfelkammer
Bitte! sagt der Redakteur und drückt auf die Taste des Aufnahmegeräts.
Die Frau hat ein Blatt zur Hand genommen und beginnt zu lesen.
Es war kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ich war ein etwa sechsjähriges Mädchen, ging leidenschaftlich gern und im ersten Jahr zur Schule und hatte immer Hunger. Nicht, daß meine Mutter es uns Kindern an etwas mangeln ließ, aber die Nachkriegszeit hatte uns in ihren Fängen, es war eine alles andere überlagernde Aufgabe, Nahrung aufzutreiben, und da ich schnell wuchs, war mein Appetit unersättlich. In der Straßenbahn, auf der Fahrt zu meiner großen Oma – so nannten wir sie, die unbeugsame, energische, musische Frau – hätte ich ein Mädchen, das neben mir einen Apfel aß, vor Heißhunger liebend gern ermordet, um diesen Apfel an mich zu reißen und krachend in ihn hineinbeißen zu können. So aber starrte ich ihn nur gierig an.
Bald, nachdem ich ihr davon erzählt hatte, begleitete ich meine große Oma in ein kleines, abgelegenes Dörfchen, nicht allzuweit von der Stadt entfernt. Aber im Gegensatz zur heutigen Verkehrslage brachte uns eine mir endlos erscheinende Bahnfahrt dorthin.
Die Oma half hier in einem großen Bauernhof immer wieder aus, um dann, nach einigen arbeitsreichen Tagen, mit einem Rucksack voller Nahrungsmittel zurückfahren zu können. Speck, Eier, Brotlaibe, sogar Butter und Schmalz, all das brachte sie mit nach Hause. Dafür nähte und flickte sie dort, half auf dem Feld, paßte auf ein Kleinkind auf, tat alles, was von ihr verlangt wurde, wie eine Magd. Aber man war freundlich zu ihr, und ich liebte das Landleben sofort. Den Hof mit seinen vielen Tieren, die sanfte, friedliche Landschaft, und vor allem meine Gewißheit, daß der Krieg vorbei war. Alles, was man mir vorsetzte – und man setzte mir reichlich Essen vor – verschlang ich und fühlte mich dabei wie im Paradies.
Nicht lange nach unserer Ankunft führte die große Oma mich eine Treppe hoch, öffnete eine Holztür, und ich stand in einem großen, weißgekalkten Raum, den ein unbeschreiblicher Duft erfüllte. Berge der herrlichsten Äpfel lagen dort ausgebreitet.
»Das ist die Apfelkammer«, sagte die große Oma, »hier halten sie sich gut. Du kannst dir jederzeit Äpfel nehmen und mußt deswegen niemanden ermorden, die Bäuerin erlaubt es dir gern.« Sie ging, und ich setzte mich auf die Holzbohlen in dieser wundersamen Kammer, sog den Apfelduft ein und wählte genüßlich die Exemplare aus, die ich zu verspeisen gedachte. Jeder Apfel schmeckte ein wenig anders, aber alle Äpfel, die ich aß, schmeckten mir auf unbeschreibliche Weise gut.
Ich saß lange in der Apfelkammer.
Beim Abendbrot konnte ich mich nicht an den gemeinsamen Tisch setzen.
Da saß ich anderswo, und das die halbe Nacht lang. Am nächsten Morgen lachte die große Oma. »Siehst du«, sagte sie dann, »zu wenig ist nicht gut, aber zu viel ist um nichts besser. Merke dir das. Lerne Maß halten, das wird deinem Leben guttun.« Ich habe es mir gemerkt.
Der Redakteur lächelt. Schön für Sie, sagt er und greift nach einer Zigarette. Die Frau lacht auf.
Ich liebte diese Oma übrigens sehr, sagt sie dann, das sei hinzugefügt. Und sie liebte das Theater und hat mich mit dieser Liebe so beeinflußt, daß es mein Leben bestimmte.
Das Theater! Ja, wann wollen wir endlich über das Theater sprechen?
Irgendwann, sagt die Frau, aber sicher nicht ausführlich, ich habe in meinem Leben schon viel zuviel und viel zu ausführlich über Theater gesprochen, sogar dann, als ich mich ihm bereits entzogen hatte. Man redet und redet über Theater, und dabei gibt es dort doch nur Gegenwart und Augenblick. Auch ein filmisch festgehaltener Theaterabend ist nur Konserve, kann lebendiges Bühnengeschehen nicht wiedergeben, dieses atmende, Akteure und Zuschauer verbindende Jetzt.
Sehen Sie, wie Sie schwärmen, sagt der Redakteur.
Die Frau schüttelt den Kopf. Nein, ich stelle nur fest, denn dieses Jetzt am Theater kann auch grauenvoll ausfallen. Nichts kann mich trübsinniger stimmen als eine törichte oder ungekonnte Vorstellung, was für ein verschwendeter Abend, denke ich dann, wie hübsch hätte man den daheim verbringen können.
Gehen Sie häufig ins Theater? fragt der Redakteur. Kaum noch, sagt die Frau, aber eine gelungene Vorstellung kann mich immer noch begeistern. Die Sonne sinkt, und ich bin müde geworden, Herr Redakteur. Wollen wir für heute Schluß machen und morgen fortsetzen?
Natürlich, gern, sagt der Redakteur, um dieselbe Zeit? Ja, am Nachmittag, ist Ihnen das recht? Selbstverständlich.
Der Redakteur dämpft die Zigarette aus, packt sein Aufnahmegerät ein, und die Frau begleitet ihn an die Tür. Als sie sich verabschieden, hören sie am Hausdach gegenüber den Gesang einer Amsel.
Wie diese Vögel den Frühlingsabend preisen, sagt die Frau, warum können wir das nicht so.
2
Es ist nicht sonnig wie am Tag zuvor, ab und zu fällt sogar leichter Regen. Wieder hat Sofia Tee serviert. Rauchen Sie, bitte! sagt die Frau. Und schenken Sie mir auch eine.
Gern! Der Redakteur hält ihr die Packung entgegen, die Frau nimmt eine Zigarette, und er gibt ihr Feuer. Rauchend sitzen sie einander gegenüber, vorerst noch schweigend.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!