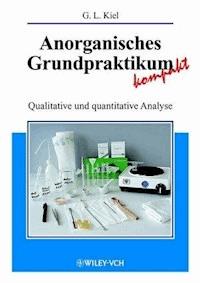
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Mit Erfolg durchs anorganische Grundpraktikum! Erstmals präsentiert Gertrud Kiel ihr neues, preisgekröntes und unter Fachleuten anerkanntes Konzept für das Grundpraktikum Chemie in Buchform. Komprimiert auf das Wesentliche und innovativ in der Gestaltung liegt der Schwerpunkt dieses Werkes auf der Minimierung des Chemikalienverbrauchs - denn umweltbewußtes Experimentieren im Labor will gelernt sein! Die Lernhilfen umfassen: · Einführungen vor jedem Versuch · Hinweise und Abbildungen für die Durchführung · Angaben der Gefahrstoffsymbole verbunden mit den R-und S-Sätzen, damit lästiges Nachschlagen entfällt · Hilfen für die rechnerische Überprüfung der Reaktionsbedingungen sowie begleitende Tabellen mit den benötigten Konstanten · ein Kapitel zu kristallchemischen Reaktionen mit einem einzigartigen Bildatlas · einen Anhang mit sämtlichen, fürs Praktikum benötigten Lösungen und Feststoffen Wenn das Grundpraktikum so eingängig, umweltfreundlich und anschaulich dargeboten wird, dann macht Experimentieren nicht nur Spaß, sondern ist auch erfolgreich! Vorlagen für die Versuchsprotokolle finden Sie unter http://www.wiley-vch.de/books/info/3-527-30584-X/.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Geleitwort
Worte vorweg
Danksagung
Sicherheit im Labor
1 Geräte und deren Anwendung
1. Arbeitsplatzausstattung und Geräte
1. Arbeitsplatzausstattung
2. Geräte und ihre Verwendung
2 Reagenzglasversuche
Einleitung zu Versuch 1
Versuch 1 Fällung von Hydroxiden
Einleitung zu Versuch 2
Versuch 2: Fällung von Sulfiden
Einleitung zu Versuch 3
Versuch 3: Fällung weiterer schwer löslicher Verbindungen Carbonate, Sulfate, Chromate, Phosphate, Oxalate, Halogenide
Einleitung zu den Versuchen 4
Versuch 4: Redox-Reaktionen
3 Quantitative Experimente
Einleitung zu den Versuchen 1 bis 7
Versuch 1: Quantitative Mikro-Bestimmung von Sulfat mit Bariumperchlorat-Lösung in 2-Propanol
Versuch 2: Quantitative Mikro-Bestimmung von Carbonat und Hydrogencarbonat nebeneinander
Versuch 3: Konzentrationsbestimmung der am Arbeitsplatz ausstehenden ca. 2 m Natronlauge
Versuch 4: Aufnahme von Titrationskurven
Versuch 5: Quantitative Bestimmung von Stickstoff nach Kjeldahl
Versuch 6: Titerbestimmung einer KMnO4-Lösung
Versuch 7: Quantitative Bestimmung von Eisen nach Reinhardt-Zimmermann
4 Stofftrennung durch Chromatographie
1. Dünnschicht-Chromatographie (DC) - Einleitung
Versuch 1: Trennung der Farbstoffkomponenten einiger Farbtinten
Versuch 2: Farbstofftrennung in Abhängigkeit von der Wahl des Fließmittels und der Trägerschicht
Versuch 3: Trennung und Nachweis der Anionen Chlorid (Cl−), Bromid (Br−) und lodid (I−)
Versuch 4: Trennung und Nachweis der Alkaliionen Li+, Na+ und K+
Versuch 5: Trennung und Nachweis der Erdalkaliionen Mg2+, Ca2+, Sr2+ und Ba2+
2. Ionenaustauscher - Ionenaustausch-Chromatographie - Einleitung
Versuch 6: Anionenaustausch
5 Anionen- und Kationenanalyse
Vorproben, Sodaauszug und Kationentrennungsgang Einleitung
5.1. Ausgewählte kristallchemische Reaktionen
5.2. Einige Vorproben und Nachweise zum systematischen Kationentrennungsgang
Versuch 1: Arbeitsgang für den Nachweis von Kupfer- und Cadmiumionen nebeneinander
Versuch 2: Nachweis von Carbonationen
Versuch 3: Nachweis von Ammoniumionen
Versuch 4: Perlenprobe zum schnellen Hinweis auf einige Kationen
Versuch 5: Oxidationsschmelze zum Nachweis von Mangan- und Chromverbindungen
Versuch 6: Flammenfärbung zum schnellen Hinweis auf einige Kationen
Versuch 7: Systematischer Nachweis der Anionen im Sodaauszug
5.3 Rückstandsanalyse
Versuch 1: Aufschluss von Zinn- und Antimonoxid (SnO2 bzw. Sb2O3) - Freiberger Aufschluss
Versuch 2: Abrauchen von Nitratverbindungen
Vor Beginn der Analyse
5.4 Kationen-Trennungsgang
Vorbemerkungen zu den Versuchen 1 bis 6
Versuch 1: Trennung und Nachweis der Kationen der HCl-Gruppe (Pb2+, Hg22+, Ag+)
Versuch 2: Trennung und Nachweis der Kationen der H2S-Gruppe (As(III/V), Sb(III/V), Sn(II/IV), Bi(III/V), Cu2+, Cd2+, Pb2+, Hg2+
Versuch 3: Trennung und Nachweis der Kationen der (NH4)2S-Gruppe (Co2+, Ni2+, Fe3+, Mn2+, Al3+, Cr3+, Zn2+)
Versuch 4: Trennung und Nachweis der Kationen der (NH4)2CO3-Gruppe (Ca2+, Sr2+, Ba2+)
Versuch 5: Trennung und Nachweis der Kationen der löslichen Gruppe (Li+, Na+, K+, Mg2+)
Versuch 6: Durchführen von Vollanalysen
6 Kristallbildatlas
Einleitung
1. Feststoffe und Lösungen für die kristallchemischen Reaktionen
2. Kristallchemische Reaktionen
Anhang: Gesamtliste der benötigten Chemikalien
Register
Advertisement Page
Bücher von Wiley-VCH für das Grundstudium der Chemie
U. R. Kunze und G. Schwedt
Grundlagen der qualitativen und quantitativen Analyse
5., geänderte Auflage
2002. ISBN 3-527-30858-X
Th. Eicher, L. F. Tietze
Organisch-chemisches Grundpraktikum unter der Berücksichtigung der Gefahrstoffverordnung
70 Präparate mit Arbeitsvorschriften und Operationsschemata
1995. ISBN 3-527-30849-0
P. Sykes
Wie funktionieren organische Reaktionen?
Reaktionsmechanismen für Einsteiger
Zweite, korrigierte Auflage
2001. ISBN 3-527-30305-7
P. W. Atkins
Kurzlehrbuch Physikalische Chemie
2001. ISBN 3-527-30433-9
Dr. Gertrud Kiel
Institut für Anorganische Chemie und Analytische Chemie
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Duesbergweg 10–14
55099 Mainz
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme
Ein Titeldatensatz für diese Publikation ist bei
Der Deutschen Bibliothek erhältlich
© Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim, 2002
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527305841
Epdf ISBN 978-3-527-66379-8
Epub ISBN 978-3-527-66378-1
Mobi ISBN 978-3-527-66377-4
Geleitwort
Eigene experimentelle Erfahrung und die damit gewonnene Stoffkenntnis sind für Chemiker auch in Zeiten, in denen theoretische Methoden zunehmend wichtiger werden, wesentliche Voraussetzung für eine verantwortungsbewußte und erfolgreiche Tätigkeit in Forschung und Produktion. Diese Erfahrung kann besonders gut und umfassend in den Praktika erworben werden, die traditionell in die Chemikerausbildung als wesentliche Komponente integriert sind. Diejenigen, die mit der Durchführung dieser Praktika betraut sind, stehen jedoch häufig vor dem Problem, dass gerade für die Anfängerpraktika keine geeigneten Anleitungsbücher existieren. In vielen Hochschulen wird daher häufig nach mehr oder weniger gut gelungenen Skripten oder mit einer Zusammenstellung ausgewählter Versuche aus umfangreichen Anleitungsbüchern gearbeitet. Dies führt leicht zu einem inkohärenten Eindruck bei den Studierenden, denen so der Blick für die Zusammenhänge und das Ziel des Praktikums verloren geht. Die Arbeit im Einführungspraktikum, die unter anderem die Freude am Experimentieren wecken und die Studierenden in sinnlich erfahrbarer Weise an die Chemie heranführen sollte, wird so oft eher als sinnlos und in Hinblick auf den Lerneffekt als vergeudete Zeit angesehen.
Das vorliegende Buch von G. Kiel will diesem Defizit abhelfen. G. Kiel ist eine erfahrene akademische Lehrerin mit langjähriger eigener Erfahrung in den verschiedensten Praktika, die sich in diesem Band niedergeschlagen hat. An zahlreichen Details, wie zum Beispiel an den vorbereiteten Bögen für die Protokollierung, den Abfallkonten und den Erklärungen zum Hintergrund der Versuche wird deutlich, dass die Autorin mit den typischen im Praktikum auftretenden Problemen bestens vertraut ist. Das vorliegende Buch ist in einigen „Probeläufen“ mit Studierenden erprobt und verfeinert worden, so dass es eine wirklich praxistaugliche Anleitung zum Experimentieren im ersten Semestern bietet.
Wie soll ein modernes Praktikumsbuch für Anfänger aussehen? Wenn man vor der Aufgabe steht, eine Praktikumsanleitung für ein Einführungspraktikum in die Anorganische Chemie zu verfassen, ist man unmittelbar mit der Tradition des klassischen Trennungsganges konfrontiert, der immer noch in vielen Ausbildungsgängen die Basis des Anfängerpraktikums bildet. Uber Sinn und Unsinn dieses Ansatzes ist schon trefflich gestritten worden, zweifellos jedoch vermittelt die Beschäftigung mit den Reaktionen des Trennungsganges wesentliche Grundlagen der anorganischen Stoffkenntnis. Bei Lehrenden und Lernenden ist er wohl teilweise aufgrund der Fixierung auf die qualitative Analyse in Verruf geraten. Wird er ein wenig losgelöst von diesem Ziel gesehen – hierfür ist in Zeiten der modernen instrumentellen Analytik tatsächlich nur noch wenig Anlaß – kann die Beschäftigung mit der Analyse aber Experimentierfreude, experimentelles Geschick und gleichzeitig Stoffkenntnis vermitteln. Aufgrund seiner pädagogischen Bedeutung kommt der Trennung von Ionen und deren Analyse somit auch in diesem Praktikumsbuch eine wesentliche Rolle zu (Kapitel 5). Dieses Kapitel ist aber in ein Umfeld eingebettet, das es den Studierenden ermöglicht, die größeren Zusammenhänge zu erkennen. So beginnt das Buch mit einem Kapitel über die Fällung von Hydroxiden und Sulfiden sowie Redoxreaktionen, in dem den Studierenden experimentell die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der Chemie in wässeriger Lösung vermittelt werden. In Kapitel 3 werden einige der in Kapitel 2 qualitativ experimentierten Reaktionen zur quantitativen Stoffbestimmung verwendet und damit vertieft. Daran schließt sich ein Kapitel über chromatographische Methoden als wesentliches analytisches Instrument, bevor der Trennungsgang behandelt wird. Das letzte Kapitel im Anschluß an die Experimente des Trennungsganges schließlich behandelt kristallchemische Mikroreaktionen, durch die nicht nur chemische Inhalte vermittelt werden, sondern bei denen auch ästhetisch äußerst ansprechende Produkte entstehen. Völlig losgelöst vom Rest des Buches hat allein schon dieses Kapitel einen großen Wert für den Nutzer.
Wodurch zeichnet sich dieser Band besonders aus? Er hat einige Charakteristika, die hier kurz angesprochen werden sollen. Zum ersten sind die Experimente so ausgewählt und beschrieben, dass sie mit geringem Aufwand und hoher Erfolgsaussicht durchgeführt werden können. Wenn Experimente misslingen können, werden Handreichungen gegeben, die Fehlerquellen zu analysieren. Aus solchen misslungenen Experimenten resultiert häufig ein größerer Lerneffekt als aus dem auf Anhieb erfolgreichen Versuch.
Zudem wird konsequent mit geringen Stoffmengen gearbeitet. Dies erzeugt schon im ersten Semester das Bewusstsein bei den späteren Chemikern, dass zum einen Reagenzien wertvolle Ressourcen sind, mit denen schonend umgegangen werden sollte, zum anderen Abfälle weitgehend vermieden werden müssen. Das Abfallkonto, das in Kapitel 1 parallel zu den Versuchen geführt wird, hat unter diesem Blickwinkel einen hohen Wert.
Von besonderer Bedeutung für den Lerneffekt, den Studierende mit diesem Buch erzielen können, sind aber die detaillierten und leicht verständlichen Erklärungen zu den Hintergründen der Versuche. Man wird hier keinen Satz im Stile von „Wie man leicht zeigen kann“ finden, sondern alle Berechnungen sind ausführlich erklärt. Ein Praktikumsbuch kann und will ein Lehrbuch der Anorganischen Chemie nicht ersetzen, und man könnte sich auf den puristischen Standpunkt stellen, Erklärungen zu den Versuchen seien in einem Praktikumsbuch nicht notwendig. Jedoch kann auch ein noch so gutes Lehrbuch kaum angemessen auf den Stoff eines Praktikums abgestimmt sein, so dass die Erläuterungen zu den Versuchen wichtige Hilfestellung zum Verständnis der Experimente geben und auch als Unterstützung für die üblichen praktikumsbegleitenden Seminare dienen können.
Der vorliegende Band wird den Lehrenden eine große Hilfe bei der Planung eines Anfängerpraktikums sein, den Studierenden ein ständiger Begleiter bei der täglichen Laborarbeit. Schließlich aber, und das ist vielleicht das wichtigste für ein Praktikumsbuch: Es soll Freude an und Begeisterung für experimentelles Arbeiten vermitteln, die ich jedem Nutzer dieses Buches wünsche.
Professor Dr. Ferdi Schüth
Mühlheim im Oktober 2001
Worte vorweg
Warum in Zeiten des steigenden virtuellen Lehrangebotes ein neues chemisches Arbeitsbuch im klassischen Printmedium?
Gerade in einer Zeit, die suggeriert, dass Bücher in Konkurrenz mit Computerprogrammen im Lehrbetrieb unterliegen, ist es wichtig die Bedeutung der eigenen Erfahrung, des eigenen Ansehens und Erlebens zu betonen. Was ich selber angefasst, gesehen und auch gerochen habe, das gräbt sich fester in das Gedächtnis ein als Berichte aus zweiter Hand. Dabei können die multimedialen Möglichkeiten durchaus hilfreiche Ergänzungen liefern. Ja als Trainings- und Lernmedium sind sie in vielen Fällen ideal einzusetzen.
Dieses Praktikumsbuch will außer der Freude am Experiment, auch die Verantwortlichkeit für die Umwelt und für die knapper werdenden Ressourcen wecken. Eine hochzivilisierte Gesellschaft ist auf Technik und Wissenschaft angewiesen. Deshalb muss der Umgang mit schwierigen Stoffen, wie es Chemikalien nun einmal sein können, von jeder Generation immer wieder neu eingeübt werden.
Dieses Buch legt Wert darauf, die Experimente mit der gerade ausreichenden Menge an Substanzen auszuführen, es wird ‘tropfenweise’ gearbeitet. Uber die verbrauchten Chemikalienmengen wird in Kapitel 2 überschlägig Buch geführt, damit der Anspruch des sparsamen Stoffverbrauches ins Blickfeld kommt. Die durchgängig mitgeführten Gefahrstoffsymbole sollen lästiges Nachschlagen überflüssig machen und dabei stets daran erinnern, dass Chemikalien in aller Regel Gefahrstoffe sind, die allerdings bei überlegter, bewusster Handhabung sicher hantiert werden können.
Das Buch möchte vermitteln, dass Experimentieren Spaß macht. Das genaue Hinsehen und Erleben regt die kreative Phantasie an, wobei den scheinbaren Misserfolgen eine ganz besondere Bedeutung zukommt. Sie geben die notwendigen Denkanstöße, wenn zu klären ist, warum etwas nicht so abgelaufen ist wie beschrieben, wenn doch ‘alles genau nach Vorschrift’ durchgeführt wurde.
Dazu fällt mir ein persönliches Erlebnis ein: Ein junger Doktorand hatte Schwefelbestimmungen durchzuführen und schlug sich mit einem Wurtzschmitt-Ofen und den zugehörigen Bömbchen herum. Sie waren ihm schon öfters explodiert, was lästig ist, da alles gereinigt und wieder von vorn begonnen werden muss. Ich fragte ihn, warum er nicht das Verfahren nach Schöniger nähme, höchst elegant und genau. Er kannte es nicht. So bekam er die Vorschrift und die notwendigen Chemikalien und Gerätschaften. Nach einiger Zeit sah ich ihn wieder mit den Bömbchen hantieren. ‘Haben Sie das Verfahren noch nicht ausprobiert?’ ‘Doch schon, aber das funktioniert überhaupt nicht.’ Wir machten das Experiment dann zusammen. Und was war passiert? Er hatte den pH-Wert einer organischen Lösungsmittelphase zu bestimmen gehabt und vergessen, das pH-Papier anzufeuchten. Folglich war seine Lösung völlig falsch zusammengesetzt und das Verfahren konnte nicht funktionieren. Danach hat er dann die Bömbchen wirklich in die Ecke gestellt.
Solche Erlebnisse sind ganz besonders wichtig, sie sollten stets als Chance zum tieferen Verständnis und nicht als persönliches Defizit erlebt werden. Das ist gelegentlich nicht einfach, ist aber die Grundlage erfolgreicher wissenschaftlicher Arbeit.
Bei der hier vorgeschlagenen Arbeitsweise ist es bei fast allen Experimenten möglich, die Reaktionsbedingungen durch Rechnungen zu überprüfung und daraus Hinweise zu gewinnen, warum etwas nicht so abläuft wie erwartet. Es lässt sich für die hier gestellten Aufgaben damit fast immer eine Ursache finden.
Bleibt z. B. ein erwarteter Niederschlag aus, wird eine grobe Berechnung der vorliegenden Konzentrationen schnell zeigen, ob überhaupt genügend Reaktionpartner vorhanden sind, um die Erwartungen zu erfüllen.
Bei diesen Berechnungen sollen die in den begleitenden Tabellen aufgelisteten Konstanten helfen. Diese Tabellen sind oft der Dreh- und Angelpunkt zum Verständnis und zeigen den Weg zur Auswertung der Experimente.
Um die beschriebenen Experimente mit genügend Spaß und Gewinn durchführen zu können, muss schon ein wenig Grundlagenwissen vorhanden sein. Die Namen und Bezeichnungen der Elemente, die Regeln der Formelsprache und des Aufstellens von Gleichungen gehören unbedingt dazu. Und das Periodensystem muss immer präsent sein, es stellt die Vielzahl der Einzelinformationen in einen systematischen Zusammenhang und ist für Lernende deshalb unentbehrlich.
Gertrud Kiel
Mainz im Oktober 2001
Danksagung
Ein solches Buch lässt sich nicht ohne Rückkopplung mit Kollegen und künftigen Nutzern erarbeiten. So habe ich vielen Personen zu danken. Ich kann hier nur stellvertretend einige nennen, die anderen mögen mir nicht böse sein, wenn sie finden, sie seien hier vergessen worden. Aber ich habe während der Entstehung sehr vielen Leuten von dem Projekt erzählt und Diskussionen herausgefordert, so dass ich nicht mehr jeden genau erinnere, aber die häufiger betroffenen möchte ich doch hier nennen:
Als erster hat Herr Professor H. Singer das noch sehr rohe Manuskript gelesen und viele Anregungen und Korrekturen und vor allem Ermutigung gegeben. Als erste ausprobiert und kritisiert haben das Manuskript die Studentinnen Carmen Teutsch und Nadine Metz.
Bei meinen Vorversuchen waren die Laboranten Jörg Reinhart und Günter Kutsch ständig hilfsbereite Säulen meiner praktischen Arbeit. Sie haben die Lösungen hergestellt, Chemikalien besorgt und abgefüllt und haben sich um die immer notwendigen allgemeinen Laborarbeiten gekümmert. Insbesondere hat Herr Kutsch als erster die auf Mikromaßstab neu berechneten quantitativen Experimente ausprobiert und meine Arbeitsvorschriften sehr kritisch gelesen und korrigiert. Viele praktische Anregungen und Vorschläge zur Gesamtorganisation gehen auf ihn zurück, da er in den langen Jahren seiner Tätigkeit das ‘typische’ Verhalten von Studierenden sehr realistisch und verlässlich einschätzte.
Ich kann wie gesagt nicht alle und alles aufzählen, möchte aber die Assistentinnen und Assistenten und die Studierenden des Wintersemesters 2000/2001 besonders, wenn auch nicht namentlich, erwähnen. Sie haben mich durch ihre Begeisterung bei der Arbeit endgültig davon überzeugt, dass der hier eingeschlagene Weg richtig ist.
Gertrud Kiel
Mainz im Oktober 2001
Sicherheit im Labor
Jedes gut geführte chemische Praktikum beginnt mit einer Sicherheitsunterweisung, denn der sichere Aufenthalt in Laboratorien verlangt bestimmte Verhaltensregeln.
Chemikalien sind Gefahrstoffe, die bei unsachgemäßer Handhabung ihre unangenehme Seite zeigen. Werden bestimmte Regeln beachtet kann mit der freundlichen Seite der Chemikalien ohne Schaden experimentiert werden.
Als erstes werden die örtlichen Gegebenheiten inspiziert:
Wo sind die Verbandskästen,
wo ist der Feuerlöscher,
wie funktionieren die Augenduschen,
sind Telefonnummern ausgehängt für Notfalldienste,
wie verlaufen die Fluchtwege?
Wohlgemerkt, die Kunst der Praktikumsarbeit besteht darin, all diese Dinge nicht benötigen zu müssen, aber für den Fall der Fälle müssen sie bekannt sein.
Der beste eigene Beitrag zur Sicherheit ist die bestmögliche stoffliche Vorbereitung der anstehenden Experimente. Damit sind Gefahrenpotentiale bekannt und schädliche Hektik wird vermieden.
Der Arbeitsplatz muss peinlich sauber gehalten werden. Es wird stets mit der geringst möglichen Substanzmenge gearbeitet und vor allem ist klar, welches Gefahrenpotential in den verwendeten Chemikalien stecken kann. Das heißt natürlich, dass die Gefahrstoff-Symbole auf den Flaschen für mich verständlich sind. Deshalb sind sie hier auch nochmals abgebildet und erklärt. Die an jedem Symbol angebrachten Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge, die R- und S-Sätze, sind in jedem Labor-Chemikalien-Katalog in den Einführungsseiten abgedruckt und liegen außerdem in jedem Labor aus.
Es ist zu empfehlen, sich zu Beginn eines Praktikums so einen kostenlosen Firmen-Katalog zu sichern. Er enthält sehr viele interessante Informationen und kann deshalb auch gut als Nachschlagewerk genutzt werden.
Im Labor werden keine Nahrungmittel aufbewahrt. Handtuch und Seife, Putztuch und Schutzhandschuhe sind immer griffbereit. Ohne Arbeitskittel aus Baumwolle und ohne Schutzbrille geht niemand in das Labor, auch Assistenten nicht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























