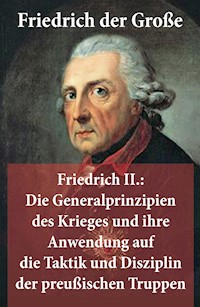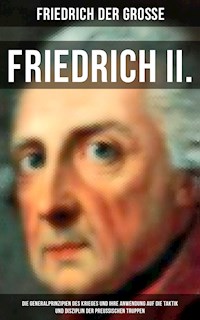Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Friedrich der Große schuf mit seinem "Antimachiavell" den Gegenentwurf zu Niccolo Machivellis "Fürsten". Der berühmte preußische König legt in seiner Schrift, Punkt für Punkt dar, was den Landesfürsten zu einem verantwortungsvollen, wahrhaften "Landesvater" macht im Gegensatz zum vollendeten Despoten wie ihn Machiavelli zeichnet: "Der Fürst von Machiavelli ist bezüglich der Moral das, was das Buch des Spinoza bezüglich des Glaubens ist. Spinoza untergrub den Grund des Glaubens und suchte das Religionsgebäude umzustürzen: Machiavelli verdarb die Staatskunst und unternahm, die Lehren der gesunden Moral zu vernichten. Die Irrtümer des einen waren nur Irrtümer der Spekulation, die des anderen betrafen die Ausübung. Indessen haben doch die Gottesgelehrten Sturm geläutet und Lärm geblasen, wider Spinoza die Waffen ergriffen, sein Werk in bester Form widerlegt und die Lehre von der Gottheit gegen seine Angriffe behauptet; wohingegen Machiavelli von einigen Sittenlehrern nur ein wenig gezaust worden ist, und sich, ihrer und seiner schädlichen Moral ungeachtet, auf dem Lehrstuhl der Politik bis auf unsere Zeiten erhalten hat. Ich übernehme die Verteidigung der Menschlichkeit wider diesen Unmenschen, der dieselbe vernichten will; ich setze die Vernunft und die Gerechtigkeit dem Sophismus und dem Laster entgegen, und ich habe es gewagt, meine Betrachtungen über Machiavellis Buch von Kapitel zu Kapitel anzustellen, damit das Gegengift unmittelbar auf die Vergiftung folge. Ich habe allezeit Machiavellis Buch von der Regierungskunst eines Fürsten als eines der allergefährlichsten Bücher angesehen, die jemals in der Welt verbreitet worden. Es ist ein Buch, welches natürlicherweise den Fürsten und denjenigen, welche Geschmack an der Staatskunst finden, in die Hände fallen muß. Es ist dabei nichts leichter, als wenn ein junger, ehrgeiziger Mensch, dessen Gemüt und Verstand noch nicht hinlänglich geschickt sind, das Gute von dem Bösen richtig zu unterscheiden, durch Regeln, welche seinen Leidenschaften schmeicheln, verdorben werde.(...)" Friedrich der Große.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu dieser Ausgabe.
Der Text dieses Buches folgt der Ausgabe:
Friedrich der Große: Antimachiavell. Unter Zugrundelegung einer
zeitgenössischen Übersetzung nach der Originalausgabe bearbeitet
von Hanns Floerke. Berlin 1913.,
und wurde schonend überarbeitet.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorrede
Das 1. Kapitel
Das 2. Kapitel
Das 3. Kapitel
Das 4. Kapitel
Das 5. Kapitel
Das 6. Kapitel
Das 7. Kapitel
Das 8. Kapitel
Das 9. Kapitel
Das 10. Kapitel
Das 11. Kapitel
Das 12. Kapitel
Das 13. Kapitel
Das 14. Kapitel
Das 15. Kapitel
Das 16. Kapitel
Das 17. Kapitel
Das 18. Kapitel
Das 19. Kapitel
Das 20. Kapitel
Das 21. Kapitel
Das 22. Kapitel
Das 23. Kapitel
Das 24. Kapitel
Das 25. Kapitel
Das 26. Kapitel
Einleitung.
DIE erste Veranlassung zur Abfassung des Antimachiavell gab ein Abschnitt in Voltaires Geschichte des Zeitalters Ludwigs XIV., in dem Machiavelli unter die großen Männer gerechnet wurde. Friedrich nahm daran Anstoß, und Voltaire verschloß sich den Einwänden des Königs so wenig, daß dieser ihm im Juni 1737 schreiben konnte: „Machiavelli ist also von der Liste der großen Menschen gestrichen, und Ihre Feder bedauert, sich mit seinem Namen befleckt zu haben.“ Seitdem ließ das Problem Machiavelli dem Kronprinzen keine Ruhe mehr. Am 22. März 1739 schreibt er an Voltaire, er wolle selbst an eine Widerlegung des Fürsten gehen, und am 4. Dezember teilt er ihm mit, er habe es getan. Am 26. April 1740 erhält Voltaire eine Kopie des Manuskripts mit dem Auftrag, die Drucklegung zu veranlassen. Am 1. Juni wendet er sich von Brüssel aus an den Buchhändler Johann van Duren im Haag, der das Werk verlegen will. Am 13. Juni erhält van Duren die Abschrift der ersten Kapitel, die Voltaire hat herstellen lassen, und am 27. den Rest. Am 31. Mai 1740, also noch vor dem Beginn des Druckes, war Friedrich König geworden und hatte nun den Wunsch, an dem Manuskript verschiedene Änderungen vorzunehmen. Der Verleger gab aber die erhaltene Abschrift nicht heraus, ignorierte auch das ihm von Voltaire am 20. August gesandte Verzeichnis der vorzunehmenden Änderungen und druckte das Manuskript wörtlich ab. Ende September 1740 erschien dann der Antimachiavell unter dem Titel: Anti-Machiavel, ou Examen du Prince de Machiavel, avec des notes historiques et critiques, à la Haye, chez Jean van Duren 1740, vereinigt mit der Übersetzung des Principe von Amelot de la Houßaye. Gleichzeitig erschien eine damit genau übereinstimmende Ausgabe in London bei Guillaume Mayer. Im gleichen Jahre noch kam im Haag die Voltairesche Ausgabe: Anti-Machiavel, ou Essai de Critique sur le Prince de Machiavel mit oft sehr abweichenden Lesarten Voltairescher Provenienz heraus. Die folgenden Jahre brachten weitere französische Ausgaben, und 1743 waren deren schon zehn vorhanden.
Die erste deutsche Ausgabe kam 1741 in Göttingen heraus, wo sie auch im folgenden Jahre in zweiter Auflage erschien. Der vorliegenden Ausgabe des Antimachiavell liegt die 1756 in Hannover und Leipzig erschienene deutsche Übersetzung zugrunde.
Das Originalmanuskript Friedrichs wurde mit allen späteren Zusätzen und Änderungen in der Preuß’schen Gesamtausgabe der Werke Friedrichs des Großen, Band VIII, in unmittelbarem Anschluß an den Abdruck der van Durenschen Ausgabe veröffentlicht und 1870 von L. B. Förster übersetzt.
Wir geben das Werk hier wieder, wie es, mit allen Vorzügen der Frische und Unmittelbarkeit, zum erstenmal vor den Augen der erstaunten Mitwelt erschien.
H. F.
Vorrede.
DER Fürst von Machiavelli ist bezüglich der Moral das, was das Buch des Spinoza bezüglich des Glaubens ist. Spinoza untergrub den Grund des Glaubens und suchte das Religionsgebäude umzustürzen: Machiavelli verdarb die Staatskunst und unternahm, die Lehren der gesunden Moral zu vernichten. Die Irrtümer des einen waren nur Irrtümer der Spekulation, die des anderen betrafen die Ausübung. Indessen haben doch die Gottesgelehrten Sturm geläutet und Lärm geblasen, wider Spinoza die Waffen ergriffen, sein Werk in bester Form widerlegt und die Lehre von der Gottheit gegen seine Angriffe behauptet; wohingegen Machiavelli von einigen Sittenlehrern nur ein wenig gezaust worden ist, und sich, ihrer und seiner schädlichen Moral ungeachtet, auf dem Lehrstuhl der Politik bis auf unsere Zeiten erhalten hat.
Ich übernehme die Verteidigung der Menschlichkeit wider diesen Unmenschen, der dieselbe vernichten will; ich setze die Vernunft und die Gerechtigkeit dem Sophismus und dem Laster entgegen, und ich habe es gewagt, meine Betrachtungen über Machiavellis Buch von Kapitel zu Kapitel anzustellen, damit das Gegengift unmittelbar auf die Vergiftung folge.
Ich habe allezeit Machiavellis Buch von der Regierungskunst eines Fürsten als eines der allergefährlichsten Bücher angesehen, die jemals in der Welt verbreitet worden. Es ist ein Buch, welches natürlicherweise den Fürsten und denjenigen, welche Geschmack an der Staatskunst finden, in die Hände fallen muß. Es ist dabei nichts leichter, als wenn ein junger, ehrgeiziger Mensch, dessen Gemüt und Verstand noch nicht hinlänglich geschickt sind, das Gute von dem Bösen richtig zu unterscheiden, durch Regeln, welche seinen Leidenschaften schmeicheln, verdorben werde.
Aber wenn es verwerflich ist, die Unschuld einer Privatperson, die nur geringen Einfluß auf die Welthändel hat, zu verführen; so ist es noch weit schädlicher, wenn man Fürsten verführt, welche Völker regieren, die Gerechtigkeit verwalten, davon ihren Untertanen ein Beispiel geben, und durch ihre Güte, Großmut und Barmherzigkeit lebende Ebenbilder der Gottheit sein sollen.
Die Überschwemmungen, die Länder verwüsten, der Blitz, der Städte einäschert, die Pest, die Provinzen entvölkert, sind auf der Welt nicht so schädlich als die gefährliche Moral und die unbändigen Leidenschaften der Könige. Die Plagen des Himmels dauern nur eine gewisse Zeit, sie verwüsten nur einige Gegenden, und ein solcher Verlust, obschon schmerzlich, ist wieder gutzumachen; aber die Laster der Könige schaden viel länger und ganzen Völkerschaften.
So wie die Könige die Macht haben, Gutes zu tun, wenn sie wollen, ebenso haben sie auch die Gewalt Böses zu tun, wenn sie es beschlossen haben; und wie bejammernswürdig ist nicht der Zustand der Untertanen, wenn sie alles von dem Mißbrauch der höchsten Gewalt zu befürchten haben; wenn ihr Vermögen der Habgier des Fürsten, ihre Freiheit seinen Launen, ihre Ruhe seiner Ehrsucht, ihre Sicherheit seiner Treulosigkeit und ihr Leben seiner Grausamkeit ausgesetzt ist? Dieses ist das traurige Bild eines Staats, in welchem ein Fürst nach dem von Machiavelli gegebenen Muster herrschen würde.
Ich darf diesen Vorbericht nicht schließen, ohne denjenigen ein Wort zu sagen, welche glauben, Machiavelli schreibe vielmehr dasjenige, was Fürsten wirklich tun, nicht aber, was sie tun sollten. Dieser Gedanke hat vielen gefallen, weil er satirisch ist.
Diejenigen, die ein solches Urteil gegen die Herrscher gefällt haben, sind ohne Zweifel durch das Beispiel einiger böser Fürsten, welche mit Machiavelli zu gleicher Zeit gelebt haben, und die er angeführt hat, oder durch das Leben einiger Tyrannen, welche ein Schandfleck der Menschheit gewesen, verführt worden. Ich bitte diese Richter, zu erwägen, daß, da die Verführung des Thrones sehr mächtig ist, es einer mehr als gewöhnlichen Tugend bedürfe, um ihr zu widerstehen, und daß es demnach kein Wunder sei, wenn bei einer so großen Anzahl Fürsten einige böse unter den guten anzutreffen sind. Unter den römischen Kaisern, wo man einen Nero, einen Caligula, einen Tiberius zählt, erinnert sich die Welt mit Freude der durch die Tugend geheiligten Namen eines Titus, eines Trajan und eines Antonin.
Es ist also eine große Ungerechtigkeit, einem ganzen Stande dasjenige zur Last zu legen, was nur einigen Gliedern desselben eigen ist.
Man sollte in der Geschichte nur die Namen der guten Fürsten aufbewahren, hingegen die Namen der anderen mit ihrer Trägheit, ihren Ungerechtigkeiten und Lastern auf ewig erlöschen lassen. Die Geschichtsbücher würden zwar dadurch sehr geschmälert werden, aber die Menschheit würde dabei gewinnen, und die Ehre, in der Historie zu leben, seinen Namen bis auf die künftigen Zeiten, ja bis zur Ewigkeit zu bringen, würde nur eine Vergeltung der Tugend sein: Machiavellis Buch würde nicht mehr die Schulen anstecken; man würde die Widersprüche der Politik, in welche er beständig mit sich selbst verfällt, verachten; und die Welt würde sich überzeugen, daß die wahre, einzig auf die Gerechtigkeit, Klugheit und Gütigkeit gegründete Staatskunst der Könige in jeder Hinsicht dem unrichtigen und abscheulichen Lehrgebäude vorzuziehen sei, welches Machiavelli der Welt darzubieten die Frechheit gehabt hat.
Das 1. Kapitel.
WENN man über eine Sache gründlich urteilen will, muß man vor allem ihre Natur ergründen und so weit als möglich zurückgehen: Es ist sodann leicht, die Entwicklungen und die möglichen Folgen daraus abzuleiten.
Ehe Machiavelli den Unterschied der Regierungsformen feststellte, hätte er also meiner Meinung nach vorher ihren Ursprung untersuchen und die Gründe erörtern sollen, welche freie Menschen bewegen könnten, sich selbst Herren zu geben.
Vielleicht würde es sich nicht geschickt haben, in einem Buch, in welchem man die Laster und die Tyrannei zu predigen sich vorgesetzt hatte, das hervorzuheben, was die Tyrannei ausrotten muß. Es würde Machiavelli übel angestanden haben, zu sagen: die Völker haben zu ihrer Ruhe und Erhaltung nötig befunden, Richter zu haben, um ihre Streitigkeiten zu schlichten; Beschützer, um sie in dem Besitz ihrer Güter wider ihre Feinde zu erhalten; Oberherren, um eines jeden besonderes Bestes in dem allgemeinen Besten zu vereinigen: daß sie gleich anfangs unter ihnen diejenigen erwählt, welche sie für die Klügsten, die Billigsten, die Uneigennützigsten, die Menschlichsten und die Tapfersten gehalten, um sie zu regieren.
Die Gerechtigkeit also, würde man sagen, muß das vornehmste Augenmerk eines Fürsten sein; die Wohlfahrt seines Volks leitet er und muß sie jedem anderen Nutzen vorziehen. Wo bleiben alsdann die Vorstellungen von Privatnutzen, Hoheit, Ehrgeiz und unumschränkter Gewalt? Es ergibt sich: Der Fürst ist keineswegs ein unumschränkter Herr der Völker, die unter seiner Botmäßigkeit stehen: Er ist unter ihnen vielmehr nichts anderes als der oberste Beamte.
Da ich mir vorgesetzt habe, die schädlichen Lehren Stück für Stück zu widerlegen, so behalte ich mir vor, davon zu reden, sowie die Materie eines jeden Kapitels mir Gelegenheit an die Hand geben wird.
Dieser Ursprung der Regenten macht das Verfahren derjenigen, die Länder an sich reißen, viel grausamer, als es sein würde, wenn man nur ihre Gewalttätigkeit in Erwägung zöge. Sie treten dieses erste Gesetz der Menschen, das sie unter eine Herrschaft vereinigt, damit sie von ihr beschützt werden, mit Füßen, und die Usurpatoren sind es, gegen die dieses Gesetz gegeben worden ist. Denn sie handeln schnurstracks wider die Absicht der Völker, die sich um der Beschützung willen Herren gegeben, und nur auf diese Bedingung sich unterworfen haben, wohingegen sie, wenn sie unter einem Herrn stehen, der sie mit Gewalt unter seine Botmäßigkeit gebracht, sich selbst und alle ihre Güter opfern, um die Habgier und alle Launen eines Tyrannen zu stillen.
Es gibt also nur drei rechtmäßige Arten, Herr eines Landes zu werden, entweder durch die Erbfolge, oder durch die Wahl eines Volkes, welches dazu in der Lage ist; oder, wenn man durch einen mit Gerechtigkeit unternommenen Krieg einige feindliche Provinzen erobert. Dieses ist die Angel, um welche meine folgenden Untersuchungen sich drehen werden.
Das 2. Kapitel.
DIE Menschen haben für alles, was alt ist, eine gewisse Hochachtung, die bis zum Aberglauben geht; und wenn das Erbrecht zu der Macht hinzukommt, welche das Altertum über die Menschen hat, so gibt es kein stärkeres Joch und keines, welches man williger trägt, als dieses. Ich bin demnach weit entfernt, Machiavelli in demjenigen zu widersprechen, was ihm jedermann zugestehen wird, daß nämlich die Erbkönigreiche am leichtesten zu regieren sind.
Ich will nur hinzufügen, daß die Erbfürsten in ihrem Besitz nicht wenig befestigt werden durch die nahe Verbindung, die zwischen ihnen und den mächtigsten Familien ihres Landes besteht, von denen der größte Teil seine Güter und seine Größe dem landesfürstlichen Hause zu danken hat. Das Glück dieser Familien ist von dem Glück des Fürsten so unzertrennlich, daß sie dieses nicht fallen lassen können, ohne wahrzunehmen, daß ihr eigener Fall die gewisse und notwendige Folge davon sein würde.
Zu unseren Zeiten tragen ferner die zahlreichen und mächtigen Kriegsheere, welche die Fürsten in Friedens- wie in Kriegszeiten auf den Beinen halten, zur Sicherheit des Staates bei. Sie halten die Ehrfurcht der benachbarten Fürsten in Schranken: Sie sind entblößte Schwerter, welche die anderen in der Scheide halten.
Aber es ist nicht genug, daß der Fürst, wie Machiavelli sagt, di ordinaria industria sei; ich wollte noch, daß er darauf bedacht wäre, sein Volk glücklich zu machen. Ein zufriedenes Volk wird an keine Empörung denken; ein glückliches fürchtet mehr seinen Fürsten, der zugleich sein Wohltäter ist, zu verlieren, als der Fürst selbst die Verminderung seiner Macht befürchten kann. Nimmermehr würden die Holländer sich wider die Spanier empört haben, wenn die Tyrannei der Spanier nicht so über alles Maß hinausgegangen wäre, daß die Holländer nicht unglücklicher werden konnten, als sie es waren.
Die Königreiche Neapel und Sizilien sind mehr als einmal von den Spaniern an den Kaiser und von dem Kaiser an die Spanier gekommen. Die Eroberung ist allezeit sehr leicht gewesen, weil sowohl die eine als die andere Herrschaft ihnen sehr streng schien, und weil diese Völker jedesmal hofften, an ihrem neuen Herrn einen Befreier zu finden.
Welcher Unterschied zwischen diesen Neapolitanern und den Lothringern! Als diese gezwungen worden waren, eine andere Herrschaft anzuerkennen, schwamm ganz Lothringen in Tränen. Sie bedauerten, die Abkömmlinge jener Herzöge zu verlieren, welche seit so vielen Jahrhunderten in dem Besitz dieses blühenden Landes gewesen sind, und unter welchen man Männer zählt, die sich durch ihre Güte so liebenswürdig gemacht haben, daß sie verdienten, Königen zum Muster zu dienen. Das Andenken des Herzogs Leopold war den Lothringern noch so teuer, daß, als seine Witwe genötigt wurde, Lunéville zu verlassen, sich alles Volk vor ihrem Wagen auf die Knie warf und die Pferde mehr als einmal aufhielt. Man hörte nichts als Klagen und sah nichts als Tränen.
Das 3. Kapitel.
DAS 15. Jahrhundert, in welchem Machiavelli lebte, hing noch an der Barbarei. Damals wurde der traurige Ruhm der Eroberer und jener außerordentlichen Taten, welche durch ihre Größe eine gewisse Ehrfurcht erwecken, der Sanftmut, der Billigkeit, der Milde und allen Tugenden vorgezogen. Jetzt sehe ich, daß man die Menschlichkeit allen Eigenschaften eines Überwinders vorzieht. Man ist nicht mehr so töricht, grausame Leidenschaften, welche die Zerrüttung der Welt verursachen, durch Lobeserhebungen anzufeuern.
Ich möchte gern wissen, was einen Menschen bewegen könnte, sich groß zu machen? Und aus was für einem Grund er den Vorsatz fassen könnte, seine Macht auf das Elend und den Untergang anderer Menschen zu bauen? Und wie er glauben könnte, sich berühmt zu machen, indem er nur Unglückliche macht? Die neuen Eroberungen eines Fürsten machen die Staaten, die er vorher besessen hat, nicht reicher. Seine Untertanen ziehen davon keinen Vorteil, und er irrt sich, wenn er sich einbildet, dadurch glücklicher zu werden. Wie viele Fürsten haben nicht durch ihre Feldherren Provinzen erobern lassen, die sie niemals sehen? Dieses sind dann gewissermaßen nur eingebildete Eroberungen, die nur wenig Wirklichkeit für die Fürsten haben, die sie vollziehen lassen. Dies heißt, viele Leute unglücklich machen, um die Laune eines einzigen Menschen zu befriedigen, der oftmals nicht bekannt zu sein verdiente.
Aber setzen wir den Fall, daß dieser Eroberer die ganze Welt unter seine Herrschaft bringe; kann er diese überwundene Welt auch regieren? Ein so großer Fürst er auch sei, so ist er doch nur ein sehr beschränktes Wesen. Kaum würde er die Namen seiner Länder behalten können, und seine Größe würde nur dazu dienen, daß es offenbar werde, wie klein er wirklich sei.
Nicht die Größe eines Landes, das ein Fürst beherrscht, bringt ihm Ehre; einige Meilen Erdreich mehr machen ihn nicht berühmt; sonst würden diejenigen, die die meisten Morgen Landes besitzen, die berühmtesten sein.
Der Irrtum Machiavellis, hinsichtlich des Ruhms der Eroberer, konnte zu seiner Zeit allgemein sein; aber seine Bosheit war es gewiß nicht. Es ist nichts so abscheulich, als einige Mittel, die er vorschlägt, die eroberten Länder zu erhalten.
Wenn man sie recht untersucht, wird man nicht ein einziges darunter finden, das vernünftig oder billig wäre. Man muß, sagt dieser boshafte Mann, das Geschlecht der Fürsten, die vor eurer Eroberung regiert haben, ausrotten. Kann man dergleichen Regeln wohl lesen, ohne daß einem vor Abscheu und Unwillen schaudert? Das heißt, alles, was in der Welt heilig ist, unter die Füße treten und dem Eigennutz die Tür zu allen Lastern öffnen. Wie? wenn ein Ehrgeiziger die Länder eines Fürsten mit Gewalt an sich gerissen hat, sollte er das Recht haben, ihn durch Meuchelmord oder Gift beseitigen zu lassen? Aber eben dieser Eroberer, da er also verfährt, führt in der Welt einen Gebrauch ein, der nicht anders als zu seinem Untergang ausschlagen kann. Ein anderer, der ehrgeiziger und geschickter als er, wird ihn mit dem Vergeltungsrecht strafen, seine Länder überfallen und ihn mit derselben Grausamkeit umkommen lassen, mit welcher er seinen Vorgänger hat umkommen lassen. Die Zeiten Machiavellis liefern uns davon nur zu viel Beispiele; sieht man nicht den Papst Alexander VI. in Gefahr, seiner Laster wegen abgesetzt zu werden; seinen abscheulichen Bastard Cesare Borgia aller eroberten Länder beraubt und elendiglich sterben; den Galeazzo Sforza mitten in der Kirche zu Mailand ermordet; Ludovico Sforza, den Usurpator, in Frankreich in einem eisernen Käfig sterben; die Prinzen von York und Lancaster, wie sie einer den anderen vernichten; die griechischen Kaiser einer von dem anderen ermordet, bis endlich die Türken sich ihr Verbrechen zunutze machten und ihrer geschwächten Macht ein Ende bereiteten? Wenn heutigen Tages unter den Christen Empörungen seltener sind, so kommt es daher, weil die Grundsätze der gesunden Moral anfangen, Verbreitung zu gewinnen. Die Menschen haben ihren Verstand besser kultiviert; sie sind daher weniger wild; und vielleicht hat man dieses den Gelehrten zu verdanken, die Europa verfeinert haben.
Die zweite Regel Machiavellis ist diese: Ein Eroberer soll in den neuen Staaten seine Residenz anlegen. Dieses ist keineswegs grausam und scheint selbst in einigen Stücken ziemlich gut zu sein; aber man muß erwägen, daß die meisten Länder großer Fürsten so gelegen sind, daß sie nicht allzu wohl deren Mittelpunkt verlassen können, ohne daß es der ganze Staat empfinde. Sie sind der Ausgangspunkt der Tätigkeit in diesem Körper; daher können sie seinen Mittelpunkt nicht verlassen, ohne daß die äußersten Teile geschwächt werden.