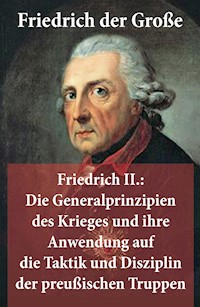Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Friedrich II., auch Friedrich der Große oder der Alte Fritz genannt war ab 1740 König in und ab 1772 König von Preußen sowie Kurfürst von Brandenburg und entstammte dem Adelshaus Hohenzollern. Die von ihm gegen Österreich geführten drei Schlesischen Kriege um den Besitz Schlesiens führten zum Deutschen Dualismus. Nach dem letzten dieser Kriege, dem Siebenjährigen von 1756 bis 1763, war Preußen als fünfte Großmacht neben Frankreich, Großbritannien, Österreich und Russland in der europäischen Pentarchie anerkannt. Dieser Band beinhaltet folgende Schriften: Inhalt: Betrachtungen über die Taktik und einige Fragen des Krieges Betrachtungen über die militärischen Talente und den Charakter Karls XII. Die Generalprinzipien des Krieges und ihre Anwendung auf die Taktik und Disziplin der preußischen Truppen Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg Der Antimachiavell Gedächtnisrede auf Knobelsdorff Gedächtnisrede auf Prinz Heinrich den Jüngeren Gedächtnisrede auf Stille Kritik der Abhandlung "Über die Vorurteile" Regierungsformen und Herrscherpflichten Schriften über Religion Über die deutsche Literatur Die Mängel, die man ihr vorwerfen kann, ihre Ursachen und die Mittel zu ihrer Verbesserung Über die Erziehung Über die Schmähschriften Der Siebenjährige Krieg Geschichte meiner Zeit Mein politisches Vermächtnis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 733
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schriften und Traktate
Friedrich der Große
Inhalt:
Friedrich der Große – Biografie und Bibliografie
Schriften.
Betrachtungen über die Taktik und einige Fragen des Krieges
Betrachtungen über die militärischen Talente und den Charakter Karls XII.
Die Generalprinzipien des Krieges und ihre Anwendung auf die Taktik und Disziplin der preußischen Truppen
Vorzüge und Mängel der preußischen Truppen
Feldzugspläne
1. Offensivpläne
2. Defensivpläne
Das Augenmaß
Die Talente des Heerführers
Wie man den Feind bei ungleichen Kräften schlagen kann
Warum und wie man Schlachten liefern soll
Zufälle und unvermutete Ereignisse im Kriege
Soll ein Heerführer Kriegsrat halten?
Die neue Taktik der Armee
Schlußwort
Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg
Vorwort
Kurfürst Friedrich I. (1415-1440)
Entstehung des brandenburgisch-preußischen Staates (1415-1740)
Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst (1640-1688)
Fehrbellin
Charakterbild
Friedrich I., König von Preußen (1688-1713)
Charakterbild
Friedrich Wilhelm I., König von Preußen (1713-1740)
Regierungsantritt und innerer Ausbau des Staates
Charakterbild
Der Antimachiavell
Vorwort
Ursprung der Herrschergewalt
Der Fürst als oberster Kriegsherr
Wege zum Nachruhm
Ratgeber der Fürsten
Diplomatische Verhandlungen und gerechte Ursachen zum Kriege
Gedächtnisrede auf Knobelsdorff
Gedächtnisrede auf Prinz Heinrich den Jüngeren
Gedächtnisrede auf Stille
Kritik der Abhandlung "Über die Vorurteile"
Regierungsformen und Herrscherpflichten
Schriften über Religion
Vorrede zum Auszug aus Fleurys Kirchengeschichte
Das himmlische Jerusalem. Ein Schwank für Voltaire
Schreiben Nicolinis an Franculoni, Prokurator von San Marco
Breve des Papstes Klemens XIV. an den Mufti Osman Molla
Vorrede zum Auszug aus dem historisch-kritischen Wörterbuch von Bayle
Die preußische Kirchenpolitik
Über die deutsche Literatur
Die Mängel, die man ihr vorwerfen kann, ihre Ursachen und die Mittel zu ihrer Verbesserung
Über die Erziehung
Über die Schmähschriften
Der Siebenjährige Krieg
Die drei Anfragen in Wien
I - Die erste Anfrage
II - Die zweite Anfrage
III - Die dritte Anfrage
Manifest gegen Österreich
Der Vormarsch auf Prag
Schlacht bei Prag
Einschließung von Prag
Kolin
Rückmarsch aus Böhmen
Wider die Reichsarmee und die Franzosen
Roßbach
Marsch nach Schlesien
Leuthen
Rechtfertigung meiner Heerführung
Rede des Königs in Parchwitz (3. Dezember 1757)
Tod des Thronfolgers August Wilhelm und der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth
Schreiben der Marquise von Pompadour an die Königin von Ungarn (Anfang 1759)
Breve des Papstes an Feldmarschall Daun (Mai 1759)
Rückblick
Geschichte meiner Zeit
Vorwort
Europa im Jahre 1740
Fürsten und Völker
Geistesleben
Kriegskunst
Das politische System Europas
Der Erste Schlesische Krieg
Ursprung des Krieges und Einmarsch in Schlesien
Manifest gegen Österreich (Dezember 1740)
Mollwitz
Rückblick
Der Zweite Schlesische Krieg
Manifest gegen Österreich (August 1744)
Hohenfriedberg
Rückblick
Mein politisches Vermächtnis
Einleitung
Rechtspflege
Finanzwirtschaft
Wirtschaftspolitik
Politik
Innere Politik
Regierungssystem
Äußere Politik
Das politische System von 1768
Unser System
Das politische System von 1776
Schlußbetrachtungen
Selbstregierung des Herrschers
Die Einheit der Regierung
Testament des Königs vor der Schlacht bei Leuthen
Das Testament vom 8. Januar 1769
Schriften und Traktate, Friedrich der Große
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849615000
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich der Große – Biografie und Bibliografie
König von Preußen, geb. 24. Jan. 1712 in Berlin, gest. 17. Aug. 1786 in Sanssouci, ältester Sohn des vorigen und der Königin Sophie Dorothea, sollte nach dem Willen des Vaters so erzogen werden, dass er ihm gleiche, und deshalb wurde die geistige Bildung sehr beschränkt, vor allem die Beschäftigung mit der Literatur ausgeschlossen. Der Prinz fügte sich nicht, trieb heimlich verbotene Studien und missachtete auch in andern Dingen den Willen des Vaters, zeigte wenig Interesse für die militärischen Exerzitien, neigte zu Luxus und machte erhebliche Schulden. Der Streit wegen der englischen Heiraten, in dem der Kronprinz zu seiner Mutter hielt, weil sich ihm durch die Vermählung mit der Prinzessin Amalie eine Aussicht auf eine unabhängige Stellung als Statthalter Georgs II. in Hannover eröffnete, gestaltete das Verhältnis zwischen Vater und Sohn noch schwieriger, der König verlangte von F. den Verzicht auf die Thronfolge, die Weigerung des Kronprinzen reizte ihn aufs äußerste, und er ließ sich im Zorn zu Misshandlungen auch in Gegenwart Fremder fortreißen. Dies brachte den Kronprinzen zum Entschluss, nach England zu fliehen, indes der 1730 auf einer Reise in das Reich unternommene Versuch misslang, und ein aufgefangener Brief Friedrichs an Katte enthüllte den Plan. Der König, durch die erneute Verweigerung des Verzichts auf sein Erbrecht gegen F. erbittert, misshandelte ihn in Wesel aufs empörendste, ließ ihn als Gefangenen vom Rhein nach der Mark bringen und setzte ein Kriegsgericht ein, um ihn als Deserteur zum Tode verurteilen zu lassen. Indes das Kriegsgericht weigerte sich, ein Urteil zu fallen, die fremden Höfe verwendeten sich für das Leven Friedrichs, und so begnügte sich der König damit, ihn in Küstrin in strenger Hast zu halten. Dieser Vorfall wirkte auf F., der auf den Tod gefasst gewesen war, tief ein. Er wollte nun durch die Tat beweisen, dass der preußische Staat in seinen Händen wohl aufgehoben sein werde, und widmete sich in Küstrin mit Ernst und Eifer der Arbeit. Diese Umkehr verschaffte ihm einige Erleichterungen seiner Hast; er war schließlich bloß in Küstrin konsigniert, lernte an der dortigen Domänenkammer die preußische Staatsverwaltung kennen und übte praktische Verwaltungstätigkeit. Seine Unterwerfung unter den Willen des Vaters betreffs seiner Heirat mit der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig versöhnte ihn 1732 völlig mit ihm, F. erhielt ein Regiment in Neuruppin und später die Herrschaft Rheinsberg. Hier verlebte der Kronprinz glückliche Jahre im Verkehr mit geistreichen Freunden, mit dem Studium der Philosophie und Literatur beschäftigt. Bereits selbst schriftstellerisch tätig, wechselte (vgl. »F. d. Gr. als Kronprinz im Briefwechsel mit Voltaire«, deutsch, Halle 1902) er mit Voltaire Briefe, versah aber zugleich seinen Dienst als Regimentskommandeur vortrefflich und bewies für alle Verwaltungsangelegenheiten ein lebhaftes Interesse und Verständnis, so dass sein Vater ihn als einen durchaus würdigen Nachfolger anerkannte und sein Werk vertrauensvoll in seine Hände legte.
Als F. 31. Mai 1740 den Thron bestieg, stand er in der Blüte seiner Jahre, ergriff im vollen Bewusstsein seiner königlichen Macht die Zügel der Regierung, milderte durch Maßregeln, wie die Abschaffung der Tortur, der Jagdplage, die Auflösung der Potsdamer Riesengarde, die Zurückberufung des Philosophen Wolff nach Halle u. a., manche Härten und Fehler seines Vaters und machte vor allem der Vernachlässigung der geistigen Interessen ein Ende. In der Verwaltung seines Staates den Grundsätzen seines Vaters folgend, betrachtete er sich als den für alles verantwortlichen ersten Diener des Staates; deshalb regierte er vor allem selbst, bekümmerte sich um das Geringste, nahm Bitten und Beschwerden an, verlangte aber unbedingten Gehorsam. In der Verwaltung sah er auf Sparsamkeit und Pünktlichkeit, in der Rechtspflege auf Schnelligkeit und Unparteilichkeit; die Beamten mussten arbeitsam und uneigennützig sein. Die stärkste Säule des Staates, das Heer, verstärkte er sofort um 16,000 Mann. Nach außen hin wollte er Preußen als selbständige unabhängige Macht sehen und betrachtete eine Vergrößerung des Staatsgebiets als das Notwendigste, und ein starkes Heer und gute Finanzen erschienen ihm als die unerlässliche Voraussetzung dazu. Zuerst mit der jülichschen Erbfolgefrage beschäftigt, fand er nach dem Tode Karls VI. (20. Okt. 1740) ein ersprießlicheres Feld für seine Tätigkeit in Schlesien. Da Österreich selbst den Vertrag von Berlin gebrochen hatte, war F. zur Garantie der Pragmatischen Sanktion nicht verpflichtet, wollte aber der jungen Königin Maria Theresia gegen alle Mächte, die ihr etwa die Erbschaft streitig machen würden, beistehen, wenn diese ihm einen Teil Schlesiens, auf das Preußen überdies noch nicht erloschene Erbansprüche habe, abtreten werde. Als der Wiener Hof dies Verlangen mit Entrüstung zurückwies und von F. die Garantie der Pragmatischen Sanktion ohne jede Gegenleistung forderte, rückte F. Mitte Dezember 1740 in Schlesien ein (erster Schlesischer Krieg), eroberte und behauptete es durch die Siege bei Mollwitz (10. April 1741) und Chotusitz (17. Mai 1742), und im Frieden zu Berlin (28. Juli 1742) willigte Maria Theresia in die Abtretung Schlesiens. Da indes Österreich jetzt über seine übrigen Feinde entscheidende Siege (Österreichischer Erbfolgekrieg) erfocht, schloss F. 1744 ein neues Bündnis mit Frankreich und nahm den Schutz des Kaisers, des Wittelsbachers Karl VII., zum Vorwand, um Ende August in Böhmen einzufallen (zweiter Schlesischer Krieg). Er eroberte Prag, musste aber vor der überlegenen österreichischen Armee im Winter Böhmen wieder räumen. Die Untätigkeit der Franzosen und der Tod Karls VII., der die übrigen deutschen Fürsten zum Ausgleich mit Österreich veranlasste, brachten F. 1745 in große Gefahr, aber nach den preußischen Siegen bei Hohenfriedeberg (4. Juni) und bei Soor (30. Sept.), die F., und den bei Kesselsdorf (15. Dez.), den Leopold von Dessau erfocht, trat Österreich im Frieden zu Dresden (25. Dez. 1745) zum zweiten mal Schlesien und Glatz ab. Nachdem indes durch den Aachener Frieden 1748 die Pragmatische Sanktion von allen Mächten anerkannt war, dachten Maria Theresia und ihr Minister Kaunitz an eine Wiedergewinnung Schlesiens und suchten Frankreichs und Russlands Freundschaft für einen neuen Krieg. F. erfuhr da von, wollte Österreich zuvorkommen und fiel Ende August 1756 in Sachsen ein (dritter Schlesischer oder Siebenjähriger Krieg), um, durch Böhmen hindurch ziehend, womöglich in Wien den Frieden zu diktieren. Doch die Konzentration der sächsischen Armee bei Pirna hielt ihn auf; er schlug zwar ein österreichisches Heer unter Browne, das den Sachsen zu Hilfe eilte, 1. Okt. bei Lobositz und zwang diese 16. Okt. zur Kapitulation von Pirna, aber der böhmische Feldzug musste aufs nächste Frühjahr verschoben werden. Nun trat die gefürchtete Koalition zwischen Österreich, Russland, Schweden, Frankreich und den bedeutendsten Reichsfürsten zur Vernichtung Preußens ins Leben, und als der Einfall in Böhmen nach dem Sieg bei Prag (6. Mai 1757) mit der Niederlage von Kolin (18. Juni) und einem verlustreichen Rückzug endete, fielen alle Feinde über F. her, der nur England-Hannover, Hessen-Kassel und Braunschweig zu Verbündeten hatte. Zwar schlug er bei Roßbach (5. Nov.) und bei Leuthen (5. Dez.) die gefährlichsten Feinde zurück und versuchte 1758 noch einmal die Offensive. Als diese vor Olmütz scheiterte, beschränkte sich F. auf die Verteidigung, und mehrere empfindliche Niederlagen, bei Hochkirch (14. Okt. 1758), bei Kay und Kunersdorf (12. Aug. 1759), schienen ihn verderben zu wollen. Wenn er sich auch durch geschickte Operationen und glückliche Schlachten, wie bei Liegnitz (15. Aug.) und bei Torgau (3. Nov. 1760), zu behaupten wusste, so waren doch Ende 1761 seine Kräfte an Geld und Menschen erschöpft und die Mehrzahl seiner Staaten in Feindeshand; auch England hatte sich nach Georgs II. Tode und Pitts Sturz von ihm zurückgezogen. Da bestieg in Russland nach Elisabeths Tod im Januar 1762 Peter III. den Thron, schloss Frieden, räumte Preußen und schickte F. ein Hilfskorps. Nun fiel Schweden von der Koalition ab, Ende 1762 auch Frankreich, so dass F. es nur mit Österreich und dem Reich zu tun hatte. Da Maria Theresia ebenfalls ihre Hilfsmittel erschöpft sah und F. als Friedensbedingung nur Herstellung des Standes der Dinge vor dem Kriege forderte, so kam der Friede auf dieser Grundlage 15. Febr. 1763 in Hubertusburg schnell zum Abschluss. Preußen blutete jetzt aus tausend Wunden; der König fand politisch einen Rückhalt an dem jetzt von Katharina II. beherrschten Russland und gewann dadurch für sich neuen Landzuwachs durch die erste Teilung Polens (1772), das, nach außen ohnmächtig, im Innern zerrüttet, seit der Erhebung eines Günstlings der Katharina, Stanislaus Poniatowski, auf den Königsthron ganz unter russischem Einfluss stand: F. erwarb Westpreußen ohne Danzig und Thorn sowie den Netzedistrikt, der eine direkte Verbindung zwischen Ostpreußen und den Marken abgab. Auch sonst war F. bemüht, die Eroberungsgier der Nachbarn zu beschränken. Zu diesem Zweck begann er 1778 den Bayrischen Erbfolgekrieg gegen Österreich, das, um seine Macht in Süddeutschland zu vergrößern, Bayern dem Kurfürsten Karl Theodor abkaufen wollte. Im Frieden von Teschen verzichtete Kaiser Joseph II. auf den Plan. Als er ihn ein paar Jahre später wieder aufnahm, nur dass der Kurfürst für Bayern jetzt Belgien erhalten sollte, stiftete F. 1785 den Fürstenbund. So vergrößerte F. seinen Staat um zwei Provinzen, zu denen seit 1744 auch Ostfriesland kam, so dass er nun 190,000 qkm und 6 Mill. Einwohner zählte (vgl. die Geschichtskarte beim Art. »Preußen«), und errang sich die politische Führung in Europa.
Nicht weniger ersprießlich war seine Verwaltung des Staates, wenn auch durch den Siebenjährigen Krieg seine Bemühungen unterbrachen und die Erfolge teilweise verkümmert wurden. Seine Haupttätigkeit wendete er, wie sein Vater, auf das am Ende seiner Regierung 200,000 Mann zählende Heer, verbesserte die Reiterei und die Artillerie, besichtigte jährlich auf seinen Reisen einen Teil der Truppen und schritt hierbei wie bei den Manövern mit rücksichtsloser Strenge gegen unfähige Befehlshaber ein. Überhaupt stellte er an das Offizierskorps hohe Anforderungen, bevorzugte es aber auch vor den übrigen Beamten und ernannte vorzugsweise Adlige zu Offizieren. Der Dienst und die Disziplin im Heere waren hart, aber diese Härte notwendig, da ein großer Teil der Soldaten aus Angeworbenen bestand. Die Unterhaltung der Truppen verschlang trotz aller Sparsamkeit bei weitem den größten Teil der schon 1750 auf 12 Mill. Taler gestiegenen Einnahmen. F. suchte deshalb auf alle Weise den Wohlstand des Landes zu heben. Zunächst den Ackerbau: er legte Kolonien an, die er mit Einwanderern besetzte, machte das sumpfige Oderbruch zu fruchtbarem Ackerland, ordnete die Anpflanzung von Obstbäumen, den Bau von Kartoffeln etc. an, ermäßigte die Fronlasten der Bauern und schützte sie vor Gewalttätigkeiten ihrer Herren; aber ihre Erbuntertänigkeit hob er nicht auf, da er eine strenge Scheidung und Unterordnung der Stände für notwendig hielt. Nach Kräften bemüht, neue Gewerbe in seinem Staat heimisch zu machen, förderte er die Zuckersiederei, die Baumwollspinnerei und Weberei, die Porzellanfabrikation, die Seidenmanufaktur und errichtete zum Besten des Handels in Berlin die Bank und die Seehandlung. In 20 Jahren, von 1763–1783, hat F. 40 Mill. Tlr. für Beförderung des Handels, der Gewerbe und des Ackerbaues ausgegeben. Zur Mehrung der Staatseinkünfte wurden alle fremden Waren 1766 mit hohen Eingangszöllen belegt, ja Kaffee und Tabak monopolisiert, französische Beamte mussten die Erhebung der Zölle einrichten und kontrollieren, und diese machten die Regie durch ihre Schikanen und Betrügereien aufs äußerste verhasst. In die kirchlichen Angelegenheiten mischte sich F. sowenig wie möglich ein, bekümmerte sich jedoch lebhaft um die Rechtspflege, betrachtete sich als Anwalt der Armen und Gedrückten, ging aber in seinem Misstrauen gegen die Vornehmen und die Richter mitunter zu weit, ja bis zu den ungerechtesten Gewalttaten, wie namentlich in dem Fall des Müllers Arnold. 1747 erschien eine neue Gerichtsordnung, der Codex Fridericianus, der den preußischen Richterstand begründet hat; ein dauerndes Denkmal seiner Fürsorge für die Rechtspflege ist das »Allgemeine preußische Landrecht«, das, vom Großkanzler Carmer ausgearbeitet, indes erst nach Friedrichs Tode zum Abschluss kam und 1794 in Kraft trat. Es ist das erste deutsche Gesetzbuch, welches die beiden Rechtssysteme, das deutsche und das römische, verschmolz und aus dem Naturrecht ergänzte.
Von dem Zeitpunkt seiner geistigen Selbständigkeit ab hat F. unablässig danach gestrebt, in religiösen und politischen Fragen persönlich Klarheit zu gewinnen, und hat sich in beiden mit einer für seine Zeit bemerkenswerten Kühnheit von Vorurteilen befreit und im Sinne der Aufklärung seine Ansichten durch das natürliche Recht und die Vernunft zu begründen gesucht. Die Ideen der Aufklärungsphilosophie, die in England und Frankreich ausgebildet und in Deutschland durch Thomasius, Leibniz und Wolff vertreten, hat er namentlich unter den Beamten heimisch werden lassen. Wolffs Schriften führten ihn selbst in die Philosophie ein, später schloss er sich mehr an Locke und Voltaire an. Wie diese, war er Deïst, leugnete die Unsterblichkeit der Seele, und die »Epître an maréchal Keith« setzt den Hauptwert der Tugend darein, dass sie um ihrer selbst, nicht um künftiger Belohnung willen geübt werde. Die Glaubenslehre der bestehenden christlichen Kirchen war ihm Entstellung der ursprünglichen Reinheit des Christentums, dessen Sittenlehre ihm als ewig gültig und unangreifbar galt. So hoch und rein F. von den sittlichen Pflichten des Menschen dachte, so erhaben erschien ihm auch das Wesen des fürstlichen Berufs.
Schriften.
Friedrichs erste politische Schrift, die »Considérations sur l'état du corps politique de l'Europe«, mahnt die Fürsten energisch an ihre Pflicht, für das Glück ihrer Völker zu sorgen, denen sie ihre Erhebung verdanken. Der 1739 geschriebene »Antimachiavel, ou Examen du prince de Machiavel« (übersetzt von Förster, Leipz. 1870) geht allerdings von der irrtümlichen Voraussetzung aus, dass Machiavelli ein »moralisches Ungeheuer« gewesen, geißelte aber mit Recht das Unwesen des damaligen Fürstentums und enthält den berühmten Satz, der Friedrichs Leitstern während seiner ganzen Regierung gewesen: »Der Fürst ist nicht der unumschränkte Herr, sondern nur der erste Diener (in der ersten Fassung, domestique', später, serviteur') seines Volkes.« Ähnliche Gedanken enthalten der »Miroir des princes« (1744) und der »Essai sur les formes du gouvernement et sur les devoirs des souverains« (1777). Überzeugt von dem volkstümlichen Ursprung der Regierungsgewalt, erklärte er die republikanische Staatsform für durchaus berechtigt und eine verfassungsmäßige Volksvertretung wie das englische Parlament für die weiseste Einrichtung. Die Denk- und Gewissensfreiheit hat F. in seinem Staat fest begründet. F. hat auch mehrere hervorragende geschichtliche Werke geschrieben: die »Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg« (1751; neue Ausg., Leipz. 1875), die »Histoire de la guerre de sept aus«; »Mémoires, depuis la paix de Hubertsbourg 1763 jusqu'à la fin du partage de la Pologne«; »Mémoires de la guerre de 1778«; »Histoire de mon temps« (neue Ausg., Leipz. 1876, 2 Bde., und in den »Publikationen aus preußischen Archiven«, Bd. 4, das. 1879); »Réflexions sur les talents militaires et sur le caractère de Charles XII«. Sein Briefwechsel ist ausgebreitet gewesen und sehr reichhaltig, besonders der mit seinem Bruder, dem Prinzen Heinrich, seiner Bayreuther Schwester (hrsg. von Berner, Berl. 1903), mit Voltaire (hrsg. von Koser, das. 1903), Duhan de Jandun (das. 1791), d'Argens u. a. Seine politische Korrespondenz wird jetzt im Auftrag der preußischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben (bisher 29 Bde., Berl. 1878–1904); ebenso »Preußische Staatsschriften aus der Regierungszeit König Friedrichs II.« (Bd. 1–3,1878–92). Seine militärischen Schriften, Instruktionen u. dgl. sind außerordentlich zahlreich (in Auswahl deutsch von Merkens, 2. Aufl., Berl. 1891, und von Taysen, das. 1880–82, 4 Tle.). Auch eine Sammlung seiner Gedichte erschien noch bei seinen Lebzeiten (»Œuvres ou poésies diverses du philosophe de Sans-souci«). Seine sämtlichen Werke hat in zwei Prachtausgaben (Berl. 1846–57, 31 Bde.) die Berliner Akademie unter Leitung von Preuß herausgegeben; eine Übersetzung ausgewählter Werke Friedrichs lieferte H. Merkens (Würzburg 1873–76, 3 Bde.), eine andre E. Schröder (3. Aufl., Berl. 1886). Die Oden wurden von E. Schröder (Berl. 1874) und von Vulpinus (»Fridericus redivivus«, mit dem franz. Text, das. 1886) übersetzt. Seine Schriften sind alle französisch geschrieben; die deutsche Literatur hielt er keiner Beachtung für würdig und einen Aufschwung für unmöglich (vgl. seine Schrift »De la littérature allemande«, 1780; mit Dohms Übersetzung hrsg. von Geiger, Berl. 1902). Trotzdem hat gerade F. bedeutend zu diesem Aufschwung beigetragen durch seine Persönlichkeit und seine Verdienste um die geistige Befreiung des deutschen Volkes.
Eine so vielseitige Tätigkeit war nur möglich bei außergewöhnlicher Arbeitskraft und peinlicher Ausnutzung der Zeit, und F. widmete bis in sein spätestes Alter den ganzen Tag den Geschäften. Vor dem Siebenjährigen Kriege liebte F., der 1747 das neue Schloss Sanssouci bei Potsdam bezog, auch Geselligkeit, namentlich geistvoller Franzosen; auch Voltaire war mehrere Jahre (1750–53) am Hofe des »Philosophen von Sanssouci«. Er war nicht nur im Verkehr mit Tonkünstlern, wie Quantz, Graun, Ph. E. Bach u. a., ein eifriger Musikliebhaber (jeden Tag war Konzert, in dem F. selbst die Flöte spielte), sondern auch selbst Komponist (eine Auswahl seiner musikalischen Werke [25 Sonaten für Flöte und Klavier, 4 Konzerte] gab Spitta heraus, Leipz. 1889, 4 Bde.). Vgl. Thouret, F. d. Gr. als Musikfreund und Musiker (Leipz. 1898). Nach dem Kriege zog er sich mehr und mehr in die Einsamkeit zurück, ging ganz in der Erfüllung seiner Pflichten auf; zugleich steigerten sich manche Schwächen: seine Sparsamkeit (er brauchte für seinen ganzen Hofstaat nur 200,000 Tlr. jährlich) artete in Geiz aus, seine Strenge oft in willkürliche Härte, seine Vereinsamung steigerte in ihm die Menschenverachtung. In seiner nächsten Umgebung war er deshalb nicht mehr beliebt, desto mehr bei seinem Volk, und der Ruhm seiner Herrschertätigkeit war über die ganze Welt verbreitet. Gegenwärtig noch bricht sich die Erkenntnis immer mehr Bahn, dass F., indem er Preußen groß machte, auch dem deutschen Volke sein nationales Selbstbewusstsein und opferfreudige Vaterlandsliebe wiedergegeben hat. F. litt wie seine Vorfahren schon früh an Gicht, die mit jedem Jahre schlimmer wurde und zuletzt in tödliche Wassersucht überging. Seine Ehe mit Elisabeth von Braunschweig war kinderlos geblieben. Seine charakteristischen, geistvollen Züge, seine einfache, aber originelle Erscheinung sind in zahllosen Porträten und Denkmälern verewigt; von letzteren ist das großartigste das Reiterstandbild von Rauch in Berlin (seit 1851); 1847 wurde seine Reiterstatue von Kiß vor dem Stadthaus zu Breslau, 1877 ein Standbild Friedrichs von Siemering in Marienburg enthüllt. Den jugendlichen F. zeigt das Standbild in der Siegesallee zu Berlin von Uphues. Seinen Namen führt seit 1889 das 3. ostpreußische Grenadierregiment Nr. 4.
Von Gesamtdarstellungen seines Lebens sind zu nennen: Preuß, F. d. Gr. Eine Lebensgeschichte (Berl. 1832–34, 4 Bde., mit 5 Tln. Urkunden); Carlyte, History of Frederick Il. (Lond. 1858–65 u. ö., 6 Bde.; deutsch, Berl. 1858–69, 6 Bde.); Droysen, Geschichte der preußischen Politik, 5. Teil: F. d. Gr. (Leipz. 1874–85, 4 Bde., bis 1756 reichend); Koser, König F. d. Gr. (Stuttg. 1890–1903, 2 Bde.; Bd. 1 in 2. Aufl. 1901); Wiegand, F. d. Gr. (Bielef. 1902); v. Petersdorff, F. d. Gr. (Berl. 1903). Vom entgegengesetzten Standpunkt aus ist F. beurteilt von O. Klopp (»F. II. von Preußen und die deutsche Nation«, 2. Aufl., Schaffh. 1867). Sehr verbreitet ist Kuglers populäre »Geschichte Friedrichs d. Gr.«, mit den Holzschnitten von A. Menzel (5. Ausg., Leipz. 1901). Vgl. ferner Taysen, Die äußere Erscheinung Friedrichs d. Gr. und der nächsten Angehörigen seines Hauses (Berl. 1891); Waldeyer, Die Bildnisse Friedrichs d. Gr. und seine äußere Erscheinung (das. 1900); Bratuscheck, Die Erziehung Friedrichs d. Gr. (das. 1885); Koser, F. d. Gr. als Kronprinz (2. Aufl., Stuttg. 1901); Fester, Die Bayreuther Schwester Friedrichs d. Gr. (Berl. 1902); Wilhelmine von Oranien, Erinnerungen an den Hof Friedrichs d. Gr. 1757–1761 (hrsg. von Volz, das. 1903); Paulig, F. d. Gr., neue Beiträge zur Geschichte seines Privatlebens, seines Hofes und seiner Zeit (4. Aufl., Frankf. a. O. 1902); Becher, Der Kronprinz als Regimentskommandeur in Neuruppin (Berl. 1892); »Die Kriege Friedrichs d. Gr.«, herausgegeben vom Großen Generalstab (3 Tle., der erste in 3 Bdn., das. 1890–93; der zweite in 3 Bdn., das. 1895; der dritte, bis jetzt 4 Bde., 1901–1902); Duncker, Aus der Zeit Friedrichs d. Gr. etc. (das. 1876); v. Bernhardi, F. d. Gr. als Feldherr (das. 1881, 2 Bde.); »F. d. Gr., Denkwürdigkeiten seines Lebens« (Leipz. 1886, 2 Bde.); Wagner, Friedrichs d. Gr. Beziehungen zu Frankreich und der Beginn des Siebenjährigen Kriegs (Hamb. 1896); Zeller, F. als Philosoph (Berl. 1886); I. Bona Meyer, Friedrichs d. Gr. pädagogische Schriften und Äußerungen (Langensalza 1885); Suphan, Friedrichs d. Gr. Schrift über die deutsche Literatur (Berl. 1888); Krause, F. d. Gr. und die deutsche Poesie (Halle 1884); d'Ancona, F. d. Gr. und die Italiener (deutsch, Rostock 1902); Beheim-Schwarzbach, F. d. Gr. als Gründer deutscher Kolonien in den 1772 neuerworbenen Landen (Berl. 1864); Stadelmann, Preußens Könige in ihrer Tätigkeit für die Landeskultur, Bd. 2: F. d. Gr. (Leipz. 1882); Ring, Asiatische Handelskompanien Friedrichs d. Gr. (Berl. 1890); Bergér, F. d. Gr. als Kolonisator (Gießen 1896); Lochmann, F. d. Gr., die schlesischen Katholiken und die Jesuiten seit 1756 (Götting. 1903); Baumgart, Die Literatur des In- und Auslandes über F. d. Gr. (Berl. 1886); Wiegand, F. d. Gr. im Urteil der Nachwelt (Straßb. 1888). Vgl. die Literatur über »Schlesische Kriege« und »Siebenjähriger Krieg«.
Betrachtungen über die Taktik und einige Fragen des Krieges
(21. Dezember 1758)
Was hat man vom Leben, wenn man nur vegetiert? Wozu hat man Augen, wenn man nur Tatsachen in seinem Gedächtnis anhäuft? Mit einem Worte: was nützt die Erfahrung, die man nicht zum Gegenstand späteren Nachdenkens macht?
Vegetius sagt: "Der Krieg soll uns ein Studium und der Friede eine Übung sein." Er hat recht!
Die Erfahrung will durchdacht werden. Erst nach wiederholter Prüfung erkennt der Künstler die Grundbedingungen seiner Kunst. In den Mußestunden, in den Zeiten der Ruhe wird neues vorbereitet, das durch die Erfahrung erprobt werden soll. Solche Untersuchungen stellt ein strebsamer Geist an. Aber wie selten ist solches Streben, und wie häufig sieht man dagegen Menschen, die ihren Körper abgenutzt, aber nie ihren Geist gebraucht haben! Nur das Denken, die Fähigkeit, Ideen zu verknüpfen, unterscheidet den Menschen vom Lasttier. Der Maulesel, der zehn Feldzüge lang den Packsattel des Prinzen Eugen trug, ist dadurch kein besserer Taktiker geworden. Zur Schande der Menschheit muß man gestehen, daß viele in einem sonst ehrenvollen Berufe alt und grau werden, ohne darin größere Fortschritte zu machen als jener Maulesel.
Dem hergebrachten Schlendrian des Dienstes folgen, sich um seinen Tisch und seine Bedürfnisse kümmern, marschieren, wenn marschiert wird, lagern, wenn gelagert wird, kämpfen, wenn alles kämpft – das heißt für die Mehrzahl der Offiziere gedient und Krieg geführt haben, unter den Waffen grau geworden sein. Daher sieht man so viele Militärs an Kleinigkeiten haften und in grober Unwissenheit verknöchern. Statt sich mit kühnem Flug in die Wolken zu erheben, wissen sie nur, auf ihre Methode eingeschworen, im Staube zu kriechen, unbekümmert um die Ursachen ihrer Siege und Niederlagen und ohne sie zu kennen. Und doch sind diese Ursachen mit Händen zu greifen.
Ein strenger Kritiker wie der scharfsinnige Feuquières hat uns alle Fehler erläutert, die die Heerführer seiner Zeit begangen haben. Er hat die Feldzüge, die er mitmachte, sozusagen anatomisch zergliedert und die Gründe für ihre Erfolge und Mißerfolge aufgedeckt. Er hat uns den Weg zu unserer Aufklärung gewiesen und uns gezeigt, wie man jene Grundwahrheiten entdeckt, auf denen die Kriegskunst beruht. Seitdem hat sich die Kriegführung vervollkommnet. Neue mörderische Einrichtungen haben die Schwierigkeiten vergrößert. Diese müssen wir auseinandersetzen, damit wir, nach genauer Untersuchung des Systems unserer Feinde und der Hindernisse, die sie uns entgegenstellen, die geeigneten Mittel zu ihrer Überwindung finden.
Ich will Euch nicht mit den Projekten unserer Feinde unterhalten, die sich auf die Zahl und die Macht ihrer Verbündeten stützen. Ihre Menge und vereinte Macht wäre mehr als hinreichend, nicht allein Preußen, sondern auch die Kräfte eines der mächtigsten europäischen Fürsten zu vernichten, hätte er sich dieser wilden Flut entgegenstemmen wollen. Auch brauche ich Euch wohl kaum an ihre allgemein befolgte Methode zu erinnern. Sie besteht darin, unsere Kräfte durch Diversionen nach einer Seite abzulenken, um auf der anderen, wo sie vor jedem ernstlichen Widerstand sicher sind, einen großen Schlag zu führen, sich aber einem Korps gegenüber, das ihnen die Spitze zu bieten vermag, in der Defensive zu halten und sich mit Nachdruck nur gegen die Truppen zu wenden, die infolge ihrer Schwäche vor ihnen das Feld räumen müssen.
Ich will Euch auch nicht an die Methode erinnern, die ich angewandt habe, um mich gegen den Koloß zu stemmen, der mich zu zermalmen drohte. Bewährt hat sie sich nur durch die Fehler meiner Feinde, ihre Langsamkeit, die meiner Regsamkeit zustatten kam, durch ihre Trägheit, die niemals die Gelegenheit erfaßte. Sie darf aber nicht als Muster aufgestellt werden.
Das gebieterische Gesetz der Notwendigkeit hat mich gezwungen, vieles dem Zufall zu überlassen. Ein Steuermann, der mehr den Launen des Windes als der Richtung seines Kompasses folgt, darf aber nie als Vorbild dienen.
Es kommt darauf an, sich einen richtigen Begriff von dem System zu machen, das die Österreicher in diesem Kriege befolgen. An sie halte ich mich, weil sie es von allen unseren Feinden in der Kriegskunst am weitesten gebracht haben. Die Franzosen übergehe ich mit Stillschweigen. Sie sind zwar klug und erfahren, verderben sich aber durch Leichtsinn und Unbestand von heute auf morgen die Erfolge, die ihre Geschicklichkeit ihnen verschafft hat. Die Russen sind ebenso roh wie unfähig und verdienen deshalb überhaupt keine Erwähnung.
Die Hauptveränderungen im Verfahren der österreichischen Generale, die ich während dieses Krieges bemerkt habe, beziehen sich auf ihre Lager, ihre Märsche und ihre gewaltige Artillerie. Denn diese dürfte schon allein, ohne Unterstützung von Truppen, fast hinreichen, um ein angreifendes Heer zurückzuwerfen, zu zerstreuen und zu vernichten. Glaubt nicht, ich vergäße die guten Lager, die geschickte Heerführer in früheren Zeiten ausgesucht und besetzt haben, wie die Lager Mercys bei Freiburg (1644) und Nördlingen (1645). Auch Prinz Eugen bezog ein gutes Lager bei Mantua, wodurch er dem Vordringen der Franzosen während des ganzen Feldzuges Einhalt gebot (1702). Markgraf Ludwig von Baden machte das Lager bei Heilbronn berühmt (1694). In Flandern ist das Lager von Sierk bekannt und viele andere, deren Erwähnung sich erübrigt.
Was die Österreicher gegenwärtig besonders auszeichnet, ist die Kunst, stets ein vorteilhaftes Gelände für ihre Stellungen zu wählen und besser als früher die örtlichen Hindernisse zur Aufstellung ihrer Truppen zu benutzen. Man frage sich nur, ob Heerführer es je verstanden haben, so furchtgebietende Aufstellungen zu nehmen, wie wir es jetzt bei der österreichischen Armee gesehen haben. Wo hat man jemals 400 Kanonen in verschiedenen Batterien etagenweise auf Anhöhen postiert gesehen, so daß sie nicht nur in die Ferne zu wirken vermögen, sondern auch, was der Hauptvorteil ist, ein verheerendes rasantes Feuer unterhalten können?
Ein österreichisches Lager zeigt also eine furchtgebietende Front. Aber hierauf beschränkt sich seine Verteidigung nicht. Seine Tiefengliederung und seine zahlreichen Treffen bergen wahre Hinterhalte, d.h. neue Kunstgriffe und geeignete Stellen, um über die Truppen herzufallen, die durch die Angriffe auf die vordersten Linien erschüttert sind. Diese Stellen sind im voraus dazu hergerichtet und mit Truppen besetzt, die keinen anderen Zweck haben als jenen. Allerdings muß man zugeben, daß die große numerische Überlegenheit ihrer Heere den Führern gestattet, sich in mehreren Treffen hintereinander aufzustellen, ohne eine Überflüglung befürchten zu müssen, und daß sie bei ihrem Überfluß an Truppen jedes Gelände, das ihnen geeignet scheint, zu besetzen vermögen, um ihre Stellung noch furchtgebietender zu machen.
Gehen wir noch mehr auf Einzelheiten ein, so werdet Ihr finden, daß die Grundsätze der österreichischen Kriegführung die Folgen reiflicher Überlegung sind. Ihre Taktik ist sehr kunstgerecht. In der Auswahl der Lager herrscht äußerste Vorsicht und große Geländekenntnis. Dazu haben sie bewährte Dispositionen und sind so klug, nichts zu unternehmen, ohne die im Kriege überhaupt mögliche Gewißheit des Erfolges zu haben. Sich nie zu einer Schlacht zwingen zu lassen, ist die erste Regel für jeden Heerführer. Darauf gründet sich ihr System. Daher ihre Suche nach starken Lagerplätzen auf Anhöhen und Gebirgen. Eigenheiten in der Wahl ihrer Stellungen haben die Österreicher nicht, außer daß man sie fast nie in einer schlechten Stellung findet, und daß sie ihr Hauptaugenmerk darauf richten, sich beständig in unangreifbarem Gelände aufzustellen. Ihre Flanken lehnen sich stets an Schluchten, steile Abhänge, Sümpfe, Flüsse oder Städte. Besonders aber unterscheiden sie sich von dem früheren Brauche durch die Verteilung ihrer Truppen, um, wie gesagt, alle Vorteile des Geländes auszunutzen. Mit äußerster Sorgfalt weisen sie jeder Waffe die geeignete Stellung an.
Außer der Kunst gebrauchen sie auch noch die List und schieben häufig große Kavalleriemassen vor, um den feindlichen Heerführer zu falschen Maßnahmen zu verleiten. Doch habe ich mehr als einmal bemerkt, daß sie sich nicht im Ernst schlagen wollen, wenn sie ihre Kavallerie in einer Linie aufmarschieren lassen. Stellt sie sich jedoch schachbrettförmig auf, dann wollen sie sie wirklich gebrauchen. Dabei ist aber zu beachten: wenn Ihr die Kavallerie bei Beginn der Schlacht angreift, so wird Eure Kavallerie sie zwar bestimmt schlagen, gerät aber bei der geringsten Verfolgung in einen von der Infanterie gelegten Hinterhalt, in dem sie vernichtet wird. Greift Ihr also den Feind in einer festen Stellung an, so müßt Ihr Eure Kavallerie anfangs zurückhalten, Euch nicht durch falschen Schein täuschen lassen und sie gar nicht dem Gewehr- oder Geschützfeuer aussetzen, das ihr den ersten Kampfesmut rauben würde. Vielmehr müßt Ihr sie aufsparen, um das Gefecht wiederherzustellen oder sie zur Verfolgung des Feindes zu benutzen. Dann kann sie die größten Dienste leisten.
Während dieses ganzen Krieges sahen wir die österreichische Armee stets in drei Treffen gestellt, unterstützt und umgeben von einer gewaltigen Artilleriemasse. Ihr erstes Treffen steht am Fuße der Anhöhen in fast ebenem Gelände, das nach der Seite des feindlichen Angriffs glacisartig abfällt. Das ist eine gute Methode. Sie beruht auf der Erfahrung, daß rasantes Feuer verheerender wirkt als Steilfeuer. Zudem hat der einzelne Mann auf dem Glaciskamm alle Vorteile der Höhe, ohne deren Nachteile zu empfinden. Der ungedeckte, bergan stürmende Angreifer kann ihm durch sein Feuer nicht schaden, wogegen er selbst ein rasantes und gut vorbereitetes Feuer unterhält. Versteht er nur seine Waffe zu gebrauchen, so wird er den vorrückenden Feind vernichten, bevor er heran ist. Schlägt er den Angriff ab, so kann er den Feind verfolgen, unterstützt vom Gelände, das die verschiedenen Bewegungen begünstigt. Stände dagegen das erste Treffen auf einer zu hohen oder zu steilen Anhöhe, so könnte es sich nicht herunterwagen, ohne in Unordnung zu geraten, und der Angreifer könnte bei schnellem Vordringen bald in den toten Winkel unterhalb der Schußlinie der Gewehre, ja selbst der Geschütze gelangen.
Die Österreicher haben die Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Stellungen wohl erwogen und bestimmen deshalb in ihren Lagern jene amphitheatralisch aufsteigenden Höhen für das zweite Treffen, das gleich dem ersten durch Kanonen verstärkt wird. Dies zweite Treffen, das einige Kavallerieabteilungen enthält, soll dem ersten zur Unterstützung dienen. Weicht der angreifende Feind, so ist Kavallerie zur Verfolgung bei der Hand. Weicht dagegen das erste Treffen, so stößt der vordringende Feind nach hartem Infanteriekampf auf eine zweite furchtgebietende Stellung, die er abermals angreifen muß. Er ist durch die vorigen Angriffe schon ermattet und muß nun gegen frische, gut aufgestellte Truppen anstürmen, die durch die Stärke des Geländes begünstigt werden.
Das dritte Treffen, das gleichzeitig als Reserve dient, ist zur Verstärkung der Stellen bestimmt, die der Angreifer zu durchbrechen sucht. Seine Flanken sind mit Geschützen gespickt wie eine Zitadelle. Sie benutzen jeden kleinen Geländevorsprung zum Aufbau von Geschützen, die schräg schießen und das ganze Gelände unter Kreuzfeuer halten. Es ist also fast das gleiche, ob man eine Festung stürmt, deren Werke keine Minenanlagen haben, oder eine Armee angreift, die sich derart in ihrem Gelände eingerichtet hat.
Nicht zufrieden mit so vielen Vorkehrungen, suchen die Österreicher ihre Front auch noch durch Sümpfe, tiefe und schwer passierbare Hohlwege, Flüsse, kurz, durch Geländehindernisse zu schützen. Sie verlassen sich nicht nur auf ihre Flankendeckung, sondern stellen auch noch an unzugänglichen Stellen, rechts und links, ungefähr 2000 Schritt von ihren Flügeln entfernt, starke Detachements auf, um den Feind zu beobachten und ihm, falls er die Hauptmacht unvorsichtig angreift, in den Rücken zu fallen. Man kann sich leicht vorstellen, welche Wirkung eine solche Diversion auf Truppen haben muß, die gerade beim Angriff sind und sich nun plötzlich in Flanke und Rücken gefaßt sehen. Der Anfang des Kampfes wäre auch dessen Ende, und es gäbe nichts als Verwirrung, Auflösung und Flucht.
Wie kann man nun, wird man fragen, gegen so wohl vorbereitete Truppen eine Schlacht wagen? Sollten diese oft geschlagenen Truppen unbesieglich geworden sein? Keineswegs! Das werde ich nie zugeben. Doch rate ich keinem, einen übereilten Entschluß zu fassen und sich tollkühn mit einer Armee einzulassen, die im Besitz so großer Vorteile ist.
Es ist aber auf die Dauer unmöglich, daß im Verlauf eines Feldzuges jedes Gelände gleich vorteilhaft ist. Auch können diejenigen, die die Truppen aufzustellen haben, irgendwelche Fehler begehen. Ich rate sehr, solche Gelegenheiten zu benutzen, ohne Rücksicht auf die Stärke des Feindes, wenn man nur etwas mehr als die Hälfte seiner Truppen hat.
Fehler des Feindes, die man benutzen kann, sind: wenn er eine Anhöhe vor seinem Lager oder seitwärts davon unbesetzt hält, wenn er die Kavallerie ins erste Treffen stellt, wenn er seine Flanken nicht gut angelehnt hat oder eins der Korps, die seine Flügel decken sollen, zu weit vorschiebt, wenn die von ihm besetzten Höhen nicht beträchtlich sind, und vor allem, wenn der Zugang durch keine Geländehindernisse versperrt ist. Das alles sind Fälle, die ein geschickter Heerführer nach meiner Meinung benutzen soll. Das erste, was geschehen muß, ist die Besetzung der Hügel und Anhöhen, von denen aus sein Geschütz das feindliche beherrscht. Dort muß er so viele Kanonen, wie Platz finden, aufstellen und von da die Armee, die er angreifen will, mit Feuer überschütten, während er seine Angriffstruppen und seine Treffen formiert. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten bemerkt, daß weder die österreichische Infanterie noch die Kavallerie dem Geschützfeuer standhält. Damit sie die ganze Schrecklichkeit der Artillerie spürt, sind entweder Anhöhen oder ein völlig ebenes Gelände nötig; denn Kanonen und Gewehre haben, wie gesagt, von unten nach oben keine Wirkung. Den Feind anzugreifen, ohne sich den Vorteil überhöhenden oder doch aus gleicher Höhe kommenden Feuers verschafft zu haben, wäre dasselbe, wie bewaffnete Truppen mit Leuten angreifen, die nur Knüppel haben, und das ist unmöglich.
Ich komme wieder auf den Angriff zurück. Alles hängt vom richtigen Erkennen der schwächsten Stelle des Feindes ab. Hier hat man keinen so heftigen Widerstand zu erwarten wie da, wo er sich besser vorgesehen hat. Ich glaube, die Klugheit erfordert, einen bestimmten Punkt der feindlichen Armee ins Auge zu fassen, sei es den rechten oder linken Flügel, die Flanken usw. Nach dieser Stelle muß man seinen Hauptstoß richten und mehrere Treffen formieren, um den Angriff zu unterstützen; denn es ist wahrscheinlich, daß Eure ersten Truppen zurückgeworfen werden. Den allgemeinen Angriff widerrate ich als zu gewagt. Bringt man dagegen nur einen Flügel oder einen Teil der Armee ins Feuer, so behält man, falls er geworfen wird, immer noch das Gros übrig, um den Rückzug zu decken, und so kann man nie völlig geschlagen werden.
Bedenkt ferner, daß man nicht soviel Leute verliert, wenn man nur einen Teil der feindlichen Armee angreift, als bei einer allgemeinen Schlacht, und daß man im Falle des Gelingens den Feind ebensogut vernichten kann, wenn sich nicht in zu großer Nähe des Schlachtfeldes ein Defilee befindet oder ein feindliches Detachement bei der Hand ist, das den Rückzug decken kann.
Hierbei scheint es mir zweckmäßig, den Teil des Heeres, den Ihr dem Feinde versagt, zur Demonstration zu benutzen und ihn fortwährend dem Feinde zu zeigen, so daß er seine Stellung nicht zu verlassen wagt, um Verstärkung nach Eurer Durchbruchsstelle zu schicken. Dadurch legt Ihr den Teil seines Heeres, den Ihr in Respekt haltet, während der Schlacht brach. Schwächt sich der Feind aber auf einer Seite, um nach der anderen Unterstützung zu bringen, so müßt Ihr das bei genügender Truppenmacht ausnutzen, wenn Ihr seine Bewegung rechtzeitig merkt.
Überhaupt muß man das Gute an der Fechtweise des Feindes nachahmen. Die Römer führten die überlegenen Waffen der Völker ein, mit denen sie Krieg führten, und wurden dadurch unüberwindlich. Ohne Zweifel muß man sich die Lagerweise der Österreicher aneignen, sich jedenfalls aber mit einer schmaleren Front begnügen, um an Tiefe zu gewinnen, und große Sorgfalt auf die Stellung und Sicherung seiner Flügel verwenden.
Auch das System der starken Artillerie muß man annehmen, so lästig es ist. Ich habe die unsere beträchtlich vermehrt, so daß sie die Mängel unserer Infanterie auszugleichen vermag, deren Material sich, je länger der Krieg dauert, nur verschlechtern kann. Indem wir so mit richtigerem Blick und größerer Sorgfalt als früher unsere Maßnahmen treffen, befolgen wir nur die alte Kriegsregel, sich niemals wider Willen zum Kampfe zwingen zu lassen.
Bei so vielen Schwierigkeiten, den Feind in seinen befestigten Stellungen anzugreifen, kommt man auf den Gedanken, ihn auf dem Marsche zu überfallen, seinen Aufbruch aus dem Lager zu benutzen und sich mit der Nachhut in einen Kampf einzulassen, wie es z.B. bei Leuze (1691) und Senef (1674) geschah. Aber auch dagegen haben die Österreicher Vorkehrungen getroffen, indem sie nur in durchschnittenen und waldigen Gegenden Krieg führen und schon im voraus Wege herrichten, die durch Wälder oder Sümpfe ziehen, oder indem sie den Talwegen hinter den Bergen folgen und die Berghöhen oder Defileen im voraus sorgfältig mit Detachements besetzen. Zahlreiche leichte Truppen setzen sich in den Wäldern oder auf den Berggipfeln fest, decken ihren Marsch, verschleiern ihre Bewegungen und verschaffen ihnen völlige Sicherheit, bis sie ein neues starkes Lager erreicht haben, in dem man sie vernünftigerweise nicht angreifen darf.
Bei dieser Gelegenheit muß ich noch angeben, wie unsere Feinde verfahren, um sich gute Stellungen auszusuchen. Sie schicken Feldingenieure aus, die das Gelände rekognoszieren und genaue Pläne davon aufnehmen. Erst nach genauer Prüfung und reiflicher Überlegung wird das Lager gewählt und zugleich seine Befestigung angeordnet.
Die Detachements der österreichischen Armee sind zahlreich und stark, die schwächsten nicht unter 3000 Mann. Öfters zählte ich ihrer fünf bis sechs zugleich im Felde. Recht beträchtlich ist die Zahl ihrer ungarischen Truppen. Wären sie alle beisammen, so könnten sie ein starkes Armeekorps bilden. Ihr habt Euch also stets mit zwei Armeen zu schlagen, einer schweren und einer leichten. Die Offiziere, denen sie diese Detachements anvertrauen, sind geschickt und besitzen hervorragende Geländekenntnis. Sie lagern oft ganz in der Nähe unserer Armeen, halten sich dabei aber sorgsam auf den Berggipfeln, in dichten Wäldern oder hinter doppelten und dreifachen Defileen. Aus dieser Art von Schlupfwinkeln schicken sie dann Streifscharen aus, die je nach den Umständen handeln, aber das Hauptkorps zeigt sich nur, wenn es einen großen Schlag wagen kann. Bei ihrer Stärke können diese Detachements unserer Armee ganz nahe kommen, ja sie umzingeln, und es ist sehr ärgerlich, daß wir nicht ebenso viele leichte Truppen haben. Unsere aus Deserteuren zusammengerafften, schwachen Freibataillone wagen oft nicht, sich vor ihnen sehen zu lassen. Unsere Generale getrauen sich nicht, sie vorzuschicken, um sie nicht zu verlieren. Dadurch wird es dem Feind möglich, sich unseren Lagern zu nähern, uns zu beunruhigen und uns Tag und Nacht zu alarmieren. Unsere Offiziere gewöhnen sich mit der Zeit zwar an diese fortwährenden Scharmützel, verachten sie schließlich und verfallen leider in jene unheilvolle Sicherheit, die uns bei Hochkirch so teuer zu stehen kam. Damals hielten viele den Überfall der ganzen österreichischen Armee auf unseren rechten Flügel für ein bloßes Scharmützel der irregulären Truppen.
Ich glaube jedoch, um Euch nichts zu verhehlen, daß Daun seine ungarische Armee noch weit besser verwenden könnte. Sie tut uns lange nicht so viel Schaden, wie sie könnte. Warum unternahmen die Detachementsführer nie etwas gegen unsere Fouragierungen? Warum versuchten sie nicht, die elenden Nester zu überrumpeln, wo wir unsere Magazine hatten? Warum suchten sie nicht bei jeder Gelegenheit unsere Zufuhr abzuschneiden? Warum beunruhigten sie unser Lager des Nachts nur mit kleinen Detachements, anstatt uns mit Macht anzugreifen und unserem zweiten Treffen in den Rücken zu fallen? Das hätte zu viel bedeutenderen und für den Ausgang des Krieges entscheidenderen Resultaten geführt. Ohne Zweifel fehlt es ihnen, so gut wie uns, an unternehmenden Offizieren, die in allen Ländern so selten und so gesucht sind, die einzigen, die aus der großen Zahl derer, die sich ohne Beruf und Talente dem Waffenhandwerk widmen, die Beförderung zur Generalswürde verdienen.
Das sind in kurzen Worten die Grundsätze, nach denen die Österreicher gegenwärtig Krieg führen. Sie haben sich sehr vervollkommnet, aber deshalb kann man doch wieder die Oberhand über sie gewinnen. Die von ihnen so geschickt angewandte Verteidigungsart liefert uns die Mittel, sie anzugreifen. Ich habe schon einige Gedanken darüber hingeworfen, wie man sich mit ihnen in einen Kampf einläßt. Ich muß noch zwei Dinge hinzufügen, die ich wohl vergessen habe. Erstens muß man sehr darauf achten, das zum Angriff bestimmte Korps gut anzulehnen, damit es beim Vorgehen nicht selbst in der Flanke gefaßt wird, statt die des Feindes zu gewinnen. Zweitens muß man den Bataillonskommandeuren einschärfen, daß sie ihre Leute beim Angriff zusammenhalten, besonders wenn sie in der Hitze des Erfolges die feindlichen Truppen vor sich her treiben. Denn die Infanterie besitzt nur so lange Gefechtskraft, als sie geschlossen und in guter Ordnung bleibt. Ist sie aber gelockert und fast zerstreut, so kann sie durch eine Handvoll Kavallerie vernichtet werden, die im Augenblick der Unordnung über sie herfällt.
Soviel Vorsicht ein Heerführer aber auch gebraucht, er muß doch beim Angriff auf schwierige Stellungen wie überhaupt bei allen Schlachten vieles dem Zufall überlassen.
Die beste Infanterie der Welt kann zurückgeworfen und erschüttert werden, wenn sie gegen das Gelände, den Feind und das Geschütz zugleich kämpfen muß. Die unsere ist durch ihre Verluste, ja selbst durch ihre Erfolge entnervt und entartet und muß daher bei schwierigen Unternehmungen mit Vorsicht geführt werden. Man darf ihren inneren Wert nicht überschätzen und muß seine Forderungen ihrer Leistungsfähigkeit anpassen. Es wäre leichtsinnig, ihre Tapferkeit bei gewagten Unternehmungen auf die Probe zu stellen, die unerschütterliche Geduld und Standhaftigkeit erfordern.
Das Schicksal der Staaten hängt von den Entscheidungsschlachten ab. Eine gut gewählte Stellung, eine tapfer verteidigte Anhöhe kann ein Königreich erhalten oder stürzen. Eine einzige falsche Bewegung kann alles verderben. Ein General, der einen Befehl mißversteht oder schlecht ausführt, bringt Euer Unternehmen in die größte Gefahr. Besonders muß man die Kommandeure der Infanterieflügel gut instruieren und gründlich erwägen, was am besten zu tun ist. So sehr es zu loben ist, wenn man sich auf ein Gefecht einläßt, bei dem man seinen Vorteil findet, so sehr ist es zu vermeiden, wenn das Wagnis größer ist als der Erfolg, den man sich davon verspricht. Verschiedene Wege fuhren zu einem Ziele. Nach meinem Dafürhalten muß man den Feind im kleinen zu vernichten suchen. Die Mittel zum Zweck sind gleichgültig, wenn man nur die Oberhand behält.
Der Feind schickt viele Detachements aus. Ihre Führer sind nicht alle gleich klug und nicht alle Tage gleich umsichtig. Man muß sich daher vornehmen, sie eins nach dem anderen aufzureiben, und solche Unternehmungen nicht als Kleinigkeiten behandeln, sondern mit Macht darauf losgehen, kräftige Streiche führen und diese kleinen Gefechte ebenso ernst nehmen wie entscheidende Schlachten. Gelingt es Euch ein paarmal, solche einzelnen Korps zu vernichten, so habt Ihr den Vorteil, daß der Feind auf die Defensive beschränkt wird. Er wird seine Truppen aus Vorsicht zusammenhalten und Euch vielleicht eine Gelegenheit bieten, seine Proviantzüge aufzuheben oder gar etwas gegen seine Hauptmacht mit Erfolg zu unternehmen.
Noch andere Möglichkeiten fallen mir ein. Doch ich wage sie angesichts der jetzigen Zeitumstände kaum zu erwähnen. Das Gewicht von ganz Europa lastet auf uns. Wir müssen mit unseren Armeen stets unterwegs sein, um bald eine Grenze zu verteidigen, bald einer anderen Provinz zu Hilfe zu eilen. Wir sind gezwungen, die Gesetze unserer Feinde anzunehmen, statt sie ihnen zu geben, und müssen unsere Operationen nach den ihren richten.
Da jedoch solche Krisen nicht andauern und ein einziges Ereignis bedeutende Veränderungen herbeiführen kann, so will ich Euch noch einiges darüber sagen, wohin nach meiner Meinung der Kriegsschauplatz verlegt werden müßte.
Solange wir den Feind nicht in die Ebene locken können, dürfen wir uns nicht schmeicheln, große Erfolge über ihn zu erringen. Gelingt es uns aber, ihn aus seinen Bergen, Wäldern und durchschnittenen Geländen, von denen er so großen Nutzen hat, herauszubekommen, so können seine Truppen den unseren nicht mehr widerstehen.
Wo aber, werdet Ihr fragen, findet man diese Ebenen? In Böhmen und Mähren, bei Görlitz, Zittau oder Freiberg? Dort nicht, antworte ich, wohl aber in Niederschlesien. Bei seiner unersättlichen Begierde, Schlesien zurückzuerobern, wird der Wiener Hof seine Truppen früher oder später dorthin schicken. Dann müssen sie ihre festen Stellungen verlassen, und die Stärke ihrer Positionen, ihr gewaltiges Aufgebot an Artillerie wird ihnen nicht mehr viel nützen. Rückt ihre Armee bei Beginn eines Feldzuges in die Ebene, so kann diese Verwegenheit zu ihrer völligen Vernichtung führen, und dann werden alle Operationen der preußischen Armeen in Böhmen wie in Mähren mühelos gelingen.
Ihr werdet sagen, es sei ein schlimmer Ausweg, einen Feind ins eigene Land zu locken. Zugegeben! Trotzdem ist es das einzige Mittel. Es hat der Natur nun einmal nicht beliebt, in Böhmen und Mähren Ebenen zu schaffen, sondern sie hat diese Länder mit Bergen und Wäldern bedeckt. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als das vorteilhafte Gelände da zu nehmen, wo es ist, und uns um sonst weiter nichts zu kümmern.
Die kunstgerechte Taktik der Österreicher verdient alles Lob. Dagegen ist ihre Heerführung im großen zu tadeln. Diese weit überlegenen Kräfte, diese Völker, die von allen vier Enden der Welt auf uns eindrangen, was haben sie erreicht? Ist es bei so vielen Hilfsmitteln, Kräften und Armen wohl erlaubt, so wenig auszurichten? Ist es nicht klar, daß alle diese Heere bei richtigem Zusammenwirken und gleichzeitigem Handeln unsere Korps eins nach dem anderen hätten zermalmen, und daß sie, stets konzentrisch vordringend, unsere Truppen schließlich auf die Verteidigung der Hauptstadt hätten beschränken können? Aber just ihre große Zahl ist ihnen schädlich geworden. Sie haben sich einer auf den anderen verlassen, der Führer der Reichstruppen auf den österreichischen General, der auf den russischen, der Russe auf den Schweden und dieser endlich auf den Franzosen. Daher die Lässigkeit in ihren Bewegungen und die Langsamkeit bei der Ausführung ihrer Pläne. Von schmeichelnden Hoffnungen und vom festen Vertrauen auf ihre künftigen Erfolge eingelullt, haben sie sich für Herren der Zeit gehalten. Wie viel günstige Augenblicke haben sie vorbeigehen lassen, wieviele gute Gelegenheiten verpaßt! Kurz, welch ungeheuren Fehlern verdanken wir unsere Rettung!
Diese Betrachtungen sind die einzigen Früchte, die mir der letzte Feldzug geschenkt hat. Der noch frische und lebendige Eindruck dieser Bilder hat mich zum Nachdenken angeregt. Noch ist nicht alles erschöpft. Es bleiben noch viele Dinge zu sagen, deren jedes besondere Prüfung verlangt. Aber wehe dem, der beim Schreiben kein Ende zu finden weiß! Ich will lieber die Diskussion eröffnen, als allein das Wort führen. Mögen meine Betrachtungen die Leser zu neuen Gedanken anregen, die, wenn sie ihren ganzen Scharfsinn darauf verwenden, mehr taugen werden, als diese leicht und eilig hingeworfenen Ideen.
Betrachtungen über die militärischen Talente und den Charakter Karls XII.
(1759)
Zu meiner eigenen Belehrung habe ich mir von den militärischen Talenten und dem Charakter des Schwedenkönigs Karl XII. ein deutliches Bild machen wollen. Ich urteile weder nach den übertriebenen Schilderungen seiner Lobredner noch nach den Zerrbildern seiner Tadler. Ich halte mich nur an Augenzeugen und an Tatsachen, in denen alle Bücher übereinstimmen. Mißtrauen wir all den Anekdoten, von denen die Geschichtsbücher wimmeln! Aus einem Wust von Lügen und Abgeschmacktheiten muß man die großen Ereignisse herausheben: diese allein enthalten Wahrheit.
Unter den Männern, die es unternommen haben, die Welt zu beherrschen oder umzuwälzen, ragen überlegene Geister hervor, deren Großtaten die Folge großer Entwürfe waren, Männer, die die Ereignisse benutzt oder sie selbst herbeigeführt haben, um die politische Gestalt der Welt zu ändern. So Cäsar. Seine der Republik geleisteten Dienste, seine Fehler und Tugenden, seine Siege – alles trug dazu bei, ihn auf den Thron der Welt zu heben. So auch der große Gustav Adolf, Turenne, Eugen, Marlborough in engeren oder weiteren Wirkungskreisen. Die einen ordneten ihre militärischen Operationen dem Ziel unter, das sie sich im Lauf eines Feldzuges gesteckt hatten. Die anderen knüpften ihr ganzes Wirken und mehrere Feldzüge an den Hauptzweck des unternommenen Krieges. Verfolgt man ihre bald bedächtigen, bald glänzenden Taten, so erkennt man aus ihnen das Ziel, dem sie zustrebten. So Cromwell, so Kardinal Richelieu, dem es durch Ausdauer gelang, die Großen des Reiches, die seine Einheit bedrohenden Protestanten und das Haus Österreich, Frankreichs Erbfeind, zu demütigen.
Es ist hier nicht der Ort, nachzuprüfen, mit welchem Rechte Cäsar die Republik unterdrückte, deren Mitbürger er war, ob Kardinal Richelieu im Laufe seiner Regierung Frankreich mehr geschadet als genutzt hat oder ob man Turenne tadeln soll, weil er zu den Spaniern überging. Es handelt sich hier nur um die an sich bewundernswerten Talente und nicht um den rechten oder tadelnswerten Gebrauch, den ihre Besitzer von ihnen machten.
Obwohl die politischen Berechnungen bei Karl XII. oft den heftigen Leidenschaften weichen mußten, denen er unterworfen war, ist er nichtsdestoweniger einer der außerordentlichen Männer gewesen, die in Europa am meisten Aufsehen erregt haben. Er hat die Augen der Kriegsmänner durch eine Fülle immer glänzenderer Taten geblendet. Er hat die grausamsten Schicksalsschläge erlitten, ist der Schiedsrichter des Nordens, Flüchtling und Gefangener in der Türkei gewesen. Ein so berühmter Feldherr verdient nähere Betrachtung. Für alle, die den Waffenberuf ergriffen haben, ist es nützlich, die Ursachen seines Mißgeschicks zu ergründen. Ich gedenke keineswegs, den Ruf dieses hervorragenden Kriegshelden zu schmälern; ich will ihn nur richtig würdigen und bestimmt wissen, in welchen Fällen man ihn unbedenklich nachahmen kann und in welchen man sich hüten muß, ihn zum Vorbild zu nehmen.
In jeder beliebigen Wissenschaft ist es ebenso lächerlich, sich ein vollkommenes Wesen auszudenken, wie zu wollen, daß Feuer den Durst löscht oder daß Wasser sättigt. Wer einen Helden eines Fehlers zeiht, erinnert nur daran, daß der ein Mensch ist. Könige, Staatsmänner, Heerführer, Schriftsteller, kurz alle, die durch ihre hohe Stellung oder ihre Talente die Augen des Publikums auf sich lenken, müssen sich dem Urteil ihrer Zeitgenossen und der Nachwelt fügen.
Karl XII. ist in vieler Hinsicht entschuldbar, wenn er nicht alle Vollkommenheiten eines Kriegsmannes in sich vereint hat. Eine so schwierige Wissenschaft wie die Kriegskunst wird keinem von der Natur eingeimpft. Mögen die angeborenen Anlagen noch so groß sein, es bedarf gründlichen Studiums und langer Erfahrung, um sich auszubilden. Entweder muß man seine Lehrzeit in der Schule und unter den Augen eines großen Feldherrn durchgemacht haben, oder man muß die Regeln nach vielen Fehlern auf eigene Kosten lernen. Die Fähigkeit eines Mannes, der mit sechzehn Jahren König ward, darf man füglich bezweifeln. Karl XII. sah den Feind nicht eher, als bis er zum erstenmal an der Spitze seiner Truppen stand.
Hierbei muß ich bemerken, daß alle, die in früher Jugend Armeen führten, sich eingebildet haben, die ganze Kunst bestände nur in Tapferkeit und Verwegenheit. Pyrrhus, der große Condé, selbst unser Held sind Beispiele dafür. Seit die Erfindung des Schießpulvers das System der gegenseitigen Vernichtung von Grund aus verändert hat, hat auch die Kriegskunst ganz andere Gestalt angenommen. Körperkraft, das Hauptverdienst der alten Helden, gilt heute nichts mehr. List siegt jetzt über Gewalt, Kunst über Tapferkeit. Der Kopf des Heerführers hat mehr Einfluß auf den Erfolg eines Feldzuges als die Arme seiner Soldaten. Klugheit bahnt dem Mute die Wege; die Kühnheit bleibt für die Ausführung aufgespart. Wer den Beifall der Kenner erringen will, muß noch mehr Geschicklichkeit als Glück haben.
Jetzt kann unsere sich dem Waffendienst zuwendende Jugend die Theorie dieses schwierigen Handwerks aus klassischen Büchern und aus den Betrachtungen alter Militärs erlernen. Der Schwedenkönig besaß solche Hilfsmittel nicht. Zu seiner Unterhaltung und um ihm Geschmack für Latein beizubringen, das er nicht liebte, ließ man ihn zwar den geistvollen Roman des Quintus Curtius übersetzen. Dies Buch mochte in ihm wohl den Wunsch wachrufen, es Alexander dem Großen gleichzutun, aber er lernte daraus nicht die Regeln, die das System der neueren Kriegskunst bietet, um Erfolge zu erringen.
Karl XII. verdankte der Kunst nichts, der Natur alles. Sein Geist war nicht gebildet, aber kühn, standhaft, schwungvoll, ruhmbegierig und imstande, dem Ruhme alles andere zu opfern. Seine Taten gewinnen bei näherer Prüfung ebensoviel, wie seine meisten Pläne verlieren. Seine Standhaftigkeit, die ihn über sein Geschick erhob, seine wunderbare Tatkraft und sein Heldenmut waren unzweifelhaft seine hervorragendsten Eigenschaften. Er folgte dem mächtigen Antrieb der Natur, die ihn zum Helden bestimmte. Sobald ihn die Habgier seiner Nachbarn zum Kriege zwang, entwickelte sich sein bisher verkannter Charakter sogleich. Folgen wir ihm denn in seinen verschiedenen Unternehmungen und beschränken wir uns auf seine ersten neun Feldzüge, die ein weites Feld zu Betrachtungen bieten.
Der König von Dänemark griff Karls XII. Schwager, den Herzog von Holstein, an. Statt seine Truppen nach Holstein zu schicken, wo sie den Fürsten, dem sie beistehen sollten, vollends zugrunde gerichtet hätten, läßt unser Held 8000 Mann in Pommern einrücken, schifft sich selbst auf seiner Flotte ein, landet auf Seeland, vertreibt von der Küste die Truppen, die sich seiner Landung entgegenstellen wollen, belagert Kopenhagen, die Hauptstadt seines Feindes, und zwingt den Dänenkönig binnen sechs Wochen zu einem für den Herzog von Holstein vorteilhaften Frieden. Das ist im Plan wie in der Ausführung bewunderungswürdig. Mit diesem Probestück stellt Karl sich Scipio gleich, der den Krieg nach Afrika hinübertrug, um Hannibals Abberufung aus Italien herbeizuführen.
Von Seeland folge ich dem jungen Helden nach Livland. Seine Truppen kommen mit erstaunlicher Schnelligkeit an. Auf diesen Zug paßt Cäsars veni, vidi, vici. Die edle Begeisterung, die den König beseelte, teilt sich seinen Lesern mit. Die Erzählung der Heldentaten, die dem großen Siege bei Narwa vorangingen und ihn begleiteten, ist hinreißend. Karls Handlungsweise war klug, zwar kühn, aber nicht tollkühn. Er mußte Narwa entsetzen, das der Zar persönlich belagerte; mithin mußte er die Russen angreifen und schlagen. Ihr zahlreiches Heer war nur eine Horde schlecht bewaffneter und undisziplinierter Barbaren ohne gute Führer. Die Schweden durften sich also den Moskowitern für ebenso überlegen halten wie die Spanier den wilden Völkerschaften Amerikas. Der Erfolg entsprach der Erwartung durchaus, und die Welt erfuhr mit Staunen, daß 8000 Schweden 80 000 Russen besiegt und zersprengt hatten.
Von dieser Stätte des Triumphes begleite ich unseren Helden an die Ufer der Düna, den einzigen Ort, wo er List angewandt hat, und zwar mit Geschick. Die Sachsen verteidigten das jenseitige Flußufer. Karl führte sie durch eine neue, von ihm erfundene Kriegslist irre. Unter dem Schutze künstlich hervorgebrachten Rauches, der seine Bewegungen verhüllt, geht er über den Fluß, noch ehe der alte Steinau, der die Sachsen befehligte, es merkt. Die Schweden sind ebenso schnell in Schlachtordnung gestellt wie ausgeschifft. Nach einigen Kavallerieattacken und schwachem Infanteriefeuer schlagen sie die Sachsen in die Flucht und zerstreuen sie. Welch bewundernswertes Verfahren beim Flußübergange! Welche Geistesgegenwart und Tatkraft, den Truppen gleich beim Landen ein geeignetes Schlachtfeld zu geben! Welche Tapferkeit, in so kurzer Zeit die Entscheidung herbeizuführen!
Solche mustergültigen Leistungen verdienen das Lob der Mit- und Nachwelt. Aber daß gerade die ersten Feldzüge Karls XII. seine vollkommensten Heldentaten sind, muß jedermann in Erstaunen setzen. Vielleicht verwöhnte ihn das Glück durch zu viel Gunst und verdarb ihn. Vielleicht glaubte er, die Kunst sei für den unnütz, dem nichts widersteht. Vielleicht auch verleitete ihn seine allerdings bewundernswerte Tapferkeit oft, bloß verwegen zu sein.
Bisher hatte Karl seine Waffen gegen den Feind gewandt, dessen Bekämpfung sein Interesse gebot. Seit der Schlacht an der Düna verliert man aber den leitenden Faden. Man sieht nur eine Menge Unternehmungen ohne Plan und Zusammenhang, freilich untermischt mit glänzenden Taten, aber nicht auf das Hauptziel gerichtet, das der König sich in jenem Kriege stecken mußte.
Der Zar war unstreitig Schwedens mächtigster und gefährlichster Feind. Gegen ihn hätte unser Held, wie es scheint, nach der Niederlage der Sachsen sofort vorgehen müssen. Die Trümmer der bei Narwa geschlagenen Armee irrten noch umher. Peter I. hatte in aller Eile 30 000 bis 40 000 Moskowiter zusammengerafft, die aber nicht viel mehr taugten als die 80 000 Barbaren, die vor den Schweden die Waffen gestreckt hatten. Er mußte den Zaren jetzt also mit aller Macht bedrängen, ihn aus Ingermanland vertreiben, ihm keine Zeit zum Erholen lassen und die Gelegenheit wahrnehmen, um ihm den Frieden zu diktieren.
August II. war vor kurzem (1697) ohne die Zustimmung des besseren Teiles der Republik, ja unter Widerspruch, zum König von Polen gewählt worden. Er saß also nicht fest auf seinem Thron und mußte, des Beistands der Russen beraubt, von selbst fallen, wenn Schweden überhaupt ein so großes Interesse an seiner Entthronung hatte. Statt aber solche verständigen Maßregeln zu treffen, schien Karl den Zaren und die in den letzten Zügen liegenden Moskowiter gänzlich zu vergessen, um irgend einem polnischen Magnaten nachzulaufen, der einer feindlichen Partei angehörte. Über solchen kleinen Racheakten vernachlässigte er die großen Interessen. Er unterwarf Litauen bald. Von dort ergoß sich seine Armee wie ein wütender Bergstrom nach Polen und überschwemmte das ganze Land. Der König war bald in Warschau, bald in Krakau, Lublin und Lemberg. Die Schweden breiten sich in Polnisch-Preußen aus, eilen dann wieder nach Warschau, setzen König August ab (1704), verfolgen ihn nach Sachsen und beziehen dort ruhig ihre Quartiere (1706). Man beachte wohl, daß diese Feldzüge, die ich nur summarisch wiedergebe, unseren Helden mehrere Jahre lang beschäftigten.