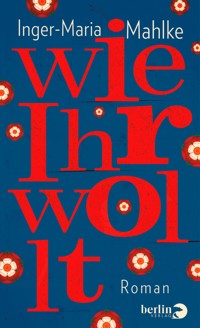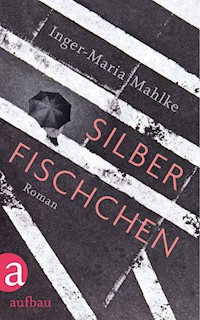4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2018: "Es ist der 9. Juli 2015, vierzehn Uhr und zwei, drei kleinliche Minuten. In La Laguna, der alten Hauptstadt des Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad. Der Himmel ist klar, wolkenlos und so hellblau, dass er auch weiß sein könnte". Damit fängt es an. Und mit Rosa, die zurückkehrt auf die Insel und in das heruntergewirtschaftete Haus der vormals einflussreichen Bernadottes. Rosa sucht. Was, weiß sie nicht genau. Doch für eine Weile sieht es so aus, als könnte sie es im Asilo, dem Altenheim von La Laguna, finden. Ausgerechnet dort, wo Julio noch mit über neunzig Jahren den Posten des Pförtners innehat. Julio war Kurier im Bürgerkrieg, war Gefangener der Faschisten, er floh und kam wieder, und heute hütet er die letzte Lebenspforte der Alten von der Insel. Julio ist Rosas Großvater. Von der mütterlichen Seite. Einer, der Privilegien nur als die der anderen kennt. Inger-Maria Mahlke ist in nur wenigen Jahren zu einer der renommiertesten deutschen Schriftstellerinnen avanciert und hat sich mit jedem ihrer Bücher thematisch und formal weiter vorgewagt. In "Archipel" führt sie rückwärts durch ein Jahrhundert voller Umbrüche und Verwerfungen, großer Erwartungen und kleiner Siege. Es ist Julios Jahrhundert, das der Bautes und Bernadottes, der Wieses, der Moores und González' – Familiennamen aus ganz Europa. Aber da sind auch die, die keine Namen haben: Die Frau etwa, die für alle nur 'die Katze' war: unverheiratete Mutter, Köchin, Tomatenpackerin - und irgendwann verschwunden. Denn manchmal bestimmen Willkür, Laune, Zufall oder schlicht: mitreißende Erzählkunst über das, was geht, und das, was kommt. Ein großer europäischer Roman von der Peripherie des Kontinents: der Insel des ewigen Frühlings, Teneriffa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inger-Maria Mahlke
Archipel
Roman
Über dieses Buch
«Es ist der 9. Juli 2015, vierzehn Uhr und zwei, drei kleinliche Minuten. In La Laguna, der alten Hauptstadt des Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad. Der Himmel ist klar, wolkenlos und so hellblau, dass er auch weiß sein könnte.» Damit fängt es an. Und mit Rosa, die zurückkehrt auf die Insel und in das heruntergewirtschaftete Haus der vormals einflussreichen Bernadottes. Rosa sucht. Was, weiß sie nicht genau. Doch für eine Weile sieht es so aus, als könnte sie es im Asilo, dem Altenheim von La Laguna, finden. Ausgerechnet dort, wo Julio noch mit über neunzig Jahren den Posten des Pförtners innehat. Julio war Kurier im Bürgerkrieg, war Gefangener der Faschisten, er floh und kam wieder, und heute hütet er die letzte Lebenspforte der Alten von der Insel. Julio ist Rosas Großvater. Von der mütterlichen Seite. Einer, der Privilegien nur als die der anderen kennt.
Inger-Maria Mahlke ist in nur wenigen Jahren zu einer der renommiertesten deutschen Schriftstellerinnen avanciert und hat sich mit jedem ihrer Bücher thematisch und formal weiter vorgewagt. In «Archipel» führt sie rückwärts durch ein Jahrhundert voller Umbrüche und Verwerfungen, großer Erwartungen und kleiner Siege. Es ist Julios Jahrhundert, das der Bautes und Bernadottes, der Wieses, der Moores und González – Familiennamen aus ganz Europa. Aber da sind auch die, die keine Namen haben: die Frau etwa, die für alle nur «die Katze» war: unverheiratete Mutter, Köchin, Tomatenpackerin – und irgendwann verschwunden. Denn manchmal bestimmen Willkür, Laune, Zufall oder schlicht mitreißende Erzählkunst über das, was geht, und das, was kommt.
Ein großer europäischer Roman von der Peripherie des Kontinents: der Insel des ewigen Frühlings, Teneriffa.
Vita
Inger-Maria Mahlke wuchs in Lübeck und auf Teneriffa auf, studierte Rechtswissenschaften an der FU Berlin und arbeitete dort am Lehrstuhl für Kriminologie. 2009 gewann sie den Berliner Open Mike. Ihr Debütroman «Silberfischchen» wurde ein Jahr später mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis ausgezeichnet. Für einen Auszug aus ihrem Roman «Rechnung offen» bekam sie beim Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis den Ernst-Willner-Preis zugesprochen; 2014 erhielt sie den Karl-Arnold-Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Ihr Roman «Wie Ihr wollt» gelangte unter anderem auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Inger-Maria Mahlke lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Umschlaggestaltung: leskas/iStock; Liszt Collection/ullstein bild
ISBN 978-3-644-00128-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Para mi abuela
Ya voy llegando a mi casa, donde muero y vivo yo.
Las paredes me conocen, pero los bienes de mi vida no.
(sagt meine Abuela)
Asi es la vida, y no hay otra.
(sagt sie auch)
Die handelnden Personen
Ana Baute Marrero, geboren 1964, Politikerin, verheiratet mit Felipe, Mutter von Rosa.
Felipe Bernadotte González, geboren 1962, Clubmitglied, verheiratet mit Ana, Vater von Rosa.
Rosa Bernadotte Baute, geboren 1994, macht was mit Kunst.
Bernarda Marrero, geboren 1934, verheiratet mit Julio, Mutter von Ana.
Julio Baute Ramos, geboren 1919, verheiratet mit Bernarda, Vater von Ana.
Francisca González Moore, geboren 1936, verheiratet mit Eliseo, Mutter von Jose Antonio und Felipe.
Eliseo Bernadotte Borges, geboren 1921, Militär, verheiratet mit Francisca, Vater von Jose Antonio und Felipe.
Jose Antonio Bernadotte González, Offiziersanwärter, geboren 1959, Bruder von Felipe.
Merche Ruiz Pérez, geboren 1924, Haushaltshilfe, Mutter von Mercedes und Eulalia.
Mercedes Morales Ruiz, geboren 1951, Mutter zweier Töchter.
Eulalia Morales Ruiz, geboren 1957, Haushaltshilfe.
Adela Moore, genannt Ada, geboren 1913, verheiratet mit Lorenzo, Mutter von Francisca.
Lorenzo González González, geboren 1907, Zeitungsherausgeber, verheiratet mit Adela, Vater von Francisca.
Augusto Baute Gil, geboren 1889, Apotheker, verheiratet mit Olga, Vater von Jorge und Julio.
Olga Ramos Díaz, geboren 1894, verheiratet mit Augusto, Mutter von Jorge und Julio.
Jorge Baute Ramos, geboren 1913, angehender Arzt.
Sidney Fellows, geboren 1881, Geschäftsführer von Elder, Dempster & Company.
2015
San Borondón
Im Kreis der schönen Künste
Es ist der 9. Juli 2015, vierzehn Uhr und zwei, drei kleinliche Minuten, in La Laguna, der alten Hauptstadt des Archipels, beträgt die Lufttemperatur 29,1 Grad, um siebzehn Uhr siebenundzwanzig wird sie mit 31,3 Grad ihr Tagesmaximum erreichen. Der Himmel ist klar, wolkenlos und so hellblau, dass er auch weiß sein könnte.
Der Besuch der Ausstellung ist Anas Idee. Felipe hat nur eingewilligt, weil er seine Ruhe haben will, Rosa hat nur eingewilligt, weil sie ihre Ruhe will. Zwei Wochen ist das her, Ana hat am Tresen gesessen, gefrühstückt, die Post vom Nichtsowichtig-Stapel geöffnet, die beiden anderen sind zufällig in der Küche. Rosa, weil sie nicht genug süße Kondensmilch in ihren Kaffee getan hat, und Felipe, weil er eine Schere sucht. Wofür, will er nicht sagen.
Ana nimmt einen Umschlag, liest laut: «80 Jahre surrealistische Konferenz von Santa Cruz.» Rosa beobachtet die Öffnung der Milchflasche, an der sich ein zäher, nur langsam dicker werdender weißlicher Tropfen sammelt, aber nicht fällt.
Felipe schließt die Besteckschublade so, dass alles aneinanderstößt und -klirrt und es danach sehr still ist und er zu Ana hinüberblickt, nachsehen, ob sie wütend wird. Ana spießt ein Stück Papaya auf, steckt es in den Mund, zieht die Karte aus dem Umschlag, liest erneut: «80 Jahre surrealistische Konferenz von Santa Cruz … Lasst uns da hingehen», sagt sie.
Felipe zieht stumm die nächste Schublade auf, Rosa schüttelt die Flasche, damit die Kondensmilch endlich herausrinnt und sie in ihr Zimmer zur zehnten Staffel Survivor, fünfte oder sechste Folge, zurückkann. Jeff Probst, der Moderator, hat gerade den Rettungshubschrauber gerufen, ein Teilnehmer hat sich beim Wettkampf – wer stößt den anderen zuerst von einem schmalen Steg ins Wasser – an der Schulter verletzt.
Ana liest weiter: «1935 besuchte der berühmte Surrealist André Breton», sieht zu Rosa hinüber, unsicher, ob sie den Namen richtig ausgesprochen hat. Für Kunst ist Felipe zuständig, ich habe Verwaltungswissenschaften studiert, leitet Ana ihre seltenen Äußerungen zu dem Thema ein, und falls die beiden glauben, sie würde nicht bemerken, welche Blicke sie einander zuwerfen, wenn Ana erwähnt, sie habe irgendetwas schön gefunden, dann irren sie sich.
Rosa rührt in der Tasse, betrachtet den weißen, schnell schmelzenden Hügel auf der Löffelspitze, rührt erneut, probiert den Kaffee, wünscht, ihre Mutter wäre endlich ruhig. Einfach rausgehen würde Diskussionen bedeuten, sie wartet, bis Ana wenigstens nicht mehr zu ihr guckt beim Lesen.
«… die Konferenz der Surrealisten im Kreis der schönen Künste in Santa Cruz de Tenerife. Zum Gedenken an dieses Ereignis …»
Rosa stößt gegen Felipe, der vor der Spüle kniet, den Mülleimer neben sich auf den Küchenfliesen.
«Herrgott, da ist keine Schere», unterbricht Ana sich. Felipe hasst diesen Tonfall, stellt den Eimer zurück, sie haben eine Geflügelschere, da ist er sicher. Eulalia hat frei. Im Flur vor seinem Arbeitszimmer lösen sich die Kabel von der Wand, ein ganzes Bündel, das zum Sicherungskasten führt, die schmalen Nägel sind aus dem Mauerwerk gerutscht. In einer Werkzeugkiste hat Felipe ein Stück gummiummantelten Draht gefunden, er will ihn zurechtschneiden, die Kabel wenigstens zusammenbinden.
Es reicht mir, ich werde den Elektriker rufen, wird Ana sagen, wenn sie es entdeckt, und Felipe sich stundenlang mit ihr streiten müssen. Er richtet sich auf, lehnt sich mit dem Rücken gegen die Spüle, tut, als würde er zuhören.
«Studenten der Kunstakademie und Nachwuchskünstler haben die Klassiker des Surrealismus neu interpretiert.» Ana sieht wieder zu Rosa hinüber, die bereits an der Tür steht.
Rosa hält inne, nickt. Was soll sie sonst tun.
«Wollen wir da hin, alle gemeinsam? Rosa ist seit sechs Monaten hier, und wir haben noch nichts zusammen …» Ana macht eine Pause, sucht das richtige Wort, «unternommen» wird es schließlich. Felipe und Rosa haben zugestimmt, eilig die Küche verlassen.
Julio, el Portero
Julio Baute schaltet erst den Fernseher, dann den Ventilator ein, lehnt seinen Stock an das Regal, das die gesamte Rückwand der Pförtnerloge einnimmt, rückt den Stuhl so, dass er, ohne den Kopf zu wenden und im Luftzug des Ventilators einen steifen Nacken zu bekommen, Tour de France schauen kann. Er hängt seine Mütze an die Stuhllehne und setzt sich, ehe er auf dem Monitor nachsieht, ob sie draußen wieder mit verschränkten Armen und ungeduldigen Uhrblicken auf Einlass warten. Es ist Mittagsruhe, die Zeiten stehen auf dem Schild neben der Klingel.
Eine Flachetappe, knapp zweieinhalb Minuten haben die Ausreißer noch, zwei Franzosen, ein Niederländer, und der vierte ist auch kein Spanier. Das Peloton kommt näher, 47 Kilometer vor dem Ziel, sie werden sie kriegen, es wird eine Sprintankunft werden. Julio Baute schaltet den Ton stumm. Morgen beginnen endlich die Bergetappen, er bevorzugt sowieso die Vuelta.
Draußen stehen zwei Frauen, eine Küchenhilfe, die jetzt viel zu spät zur Nachmittagsschicht kommt, und eine der Angehörigen. Julio Baute betätigt den Summer, später, am Abend, erwarten sie einen neuen Bewohner. Bewohner, männlich, ist Julio Baute sich sicher, ein Irrtum, wie er am nächsten Morgen feststellen wird. Für Frauen gibt es eigentlich keine freien Plätze im Asilo. Sie leben länger und leisten weniger Widerstand.
Sor Mari Carmen hat am Morgen den Besuchsraum aufgeschlossen, eine der Freiwilligen die alten Strelitzien herausgetragen, sie sind in der Wärme und Dunkelheit auf dem schmalen Couchtisch verblüht. Das Wasser ist dumpf orange, die am Glas klebenden Stiele sehen schleimig aus. Der Geruch hängt noch immer im Gang, als die Eingangstür aufschwingt, drückt der Luftzug ihn in die Pförtnerloge. Julio Baute hört die Eintretenden in seinem Rücken «danke» sagen, dreht sich nicht um. Noch zwei Minuten, sieben Sekunden haben die drei Ausreißer, 39 Kilometer bis zum Ziel.
Neben ihm auf dem Tisch steht die weiße Telefonanlage, rechteckig und fast vierzig Zentimeter lang. Links der Hörer, oben zwei Tasten, von denen er nur eine benutzt, braun gerieben von seinem Finger: der Anrufbeantworter. Er drückt sie hinab, keine neuen Nachrichten. Darunter fünf Reihen längliche Lichtdioden, neben jeder ein Pappschild unter durchsichtigem Plastik, die meisten sind nicht beschriftet, und bei denjenigen, die es sind, stimmt nicht einmal die Hälfte der Anschlüsse.
Julio, el Portero, ist die Zentrale. Der Knotenpunkt. Die Schleuse zur Welt. Ohne ihn kommt man weder ins Asilo rein noch raus, bei ihm landen die Anrufer, die keine Durchwahl haben oder niemanden erreichen.
Eine Minute vierzig, neununddreißig, einer der Ausreißer versucht wegzuspringen, der Niederländer, die anderen holen ihn sofort wieder ein.
Neben dem Telefon steht das Mikrophon für die Durchsagen. Julio, el Portero, wiederholt jede Ansage zwei Mal. «Sor Cipriana, bitte begeben Sie sich in den Speisesaal der Damen. Sor Cipriana, bitte begeben Sie sich in den Speisesaal der Damen.» Langsam und verständlich, die Besucher machen sich darüber lustig. «Wie am Flughafen», hört er sie im Vorbeigehen sagen. Er ist 95 Jahre alt, seine Ohren sind noch gut. Sein Knie nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
Julio Baute betrachtet die kleiner werdenden Zahlen am rechten Bildrand, eine Minute zwanzig Sekunden, noch 32 Kilometer, hört die Servierwagen im Flur, die in die Fernsehsäle gerollt werden. Im Monitor niemand, im Sommer ist es ruhig.
Am meisten Arbeit hat er von Mitte Dezember über Weihnachten und Silvester bis zu den Heiligen Drei Königen im Januar. Jeden Abend klingeln Musikgruppen, packen auf den Stufen vor der Eingangstür ihre Instrumente aus, verstauen die Hüllen in der Loge, um wohltätig ein, zwei, drei Lieder für die Bewohner herunterzuschrubben. Nachmittags kommen Familien mit Kindern und wollen die Krippe anschauen, die in dem Raum neben der Physiotherapie aufgebaut ist. Lieferanten bringen Spenden der hiesigen Geschäfte, für die Hochsaison brauchen sie Platz im Lager. Julio Baute hat es früher ebenso gehalten, einige der Lockenstäbe in dem seit der Krise ungenutzten Frisiersalon im Damentrakt stammen noch von Marrero Electrodomésticos.
Bäckereien schicken Kekse, die landwirtschaftlichen Kooperativen säckeweise Kartoffeln, Zwiebeln, Gofio, Kisten mit Tomaten, Avocados, Papayas. Tüten voller unsortierter Sachspenden von wohltätigen Organisationen, die örtlichen Unternehmen senden Proben ihrer Produkte, hundert Flaschen Körperlotion, zweitausend Packungen Turrón, drei Kartons mit rosafarbenen Plüscheinhörnern. Und alles muss durch seine Tür, stapelt sich neben der Rampe, auf den Stufen, bis jemand aus der Küche oder eine der Nonnen mit einigen Freiwilligen alles hereinträgt. Zu den Heiligen Drei Königen mehr Angehörige als sonst, mit schlechtem Gewissen behangen, Kindheitserinnerungen in den Tüten und Beuteln. Neue Freiwillige gibt es dann reichlich, Silvester, neu beginnen, sich eine sinnvolle Aufgabe suchen.
Ana ist seit über einer Woche nicht da gewesen, fällt Julio Baute auf. Vorgestern hat ein Mädchen vor der Tür gestanden, das Rosa ähnelte, aber sicher ist er nicht. Er hat sie nur kurz im Monitor gesehen, und der verzerrt.
«Kaffee?», fragt eine der Pflegerinnen, Carmen, an der Tür. Julio, el Portero, nickt. Sie füllt einen hellroten Plastikbecher zur Hälfte mit hellbrauner Flüssigkeit, stellt ihn auf den Tisch und legt zwei Papierstäbchen mit Zucker daneben.
«Wer gewinnt?» Carmen deutet auf den Fernseher. Die Kameras zeigen die Ausreißer, 42 Sekunden haben sie noch.
«Keiner von denen», antwortet Julio. Sie lacht.
Als es klingelt, sieht er kurz auf den Monitor und drückt gleichzeitig den Öffner, eine der Freiwilligen. Eigentlich soll er jedem und allem öffnen, es gibt keine weiteren Anweisungen. Eigentlich sitzt er nur da, damit niemand herauskommt. Mit dem Kaffee werden alle auf einmal wach, richten sich in den Sesseln auf, unterhalten sich mit ihren Sitznachbarn. Der Stimmenteppich schiebt sich durch die Flure, bis hinein in seine Loge. Sobald sie ausgetrunken haben, die Plastikbecher sich wieder zu bunten Türmen gestapelt auf den Servierwagen sammeln, tauchen die ersten Bewohner an den Fenstern zum Patio auf, der der Eingangstür gegenüberliegt. Halten so viel Abstand zur Portiersloge wie möglich und lauern. Darauf, dass Julio, el Portero, nicht aufpasst und sie rausschlüpfen können. Er weiß, wer alleine spazieren gehen darf und wer nicht, auch das ist seine Aufgabe: die Übersicht behalten.
Die Frau im Monitor drückt die Tür auf, sie lacht. Zwei der Damen, Demetria mit ihrem Gehstock und Trini mit dem Papagei, lehnen bereits am Patiofenster. «Hola chicas», hört Julio Baute die Freiwillige sagen, und wie hübsch sie doch beide heute aussehen. Die Damen kichern, aber Julio ist sich sicher, sie haben nur den kleiner werdenden Spalt der zufallenden Tür im Auge. Augusto ist spät dran, er lauert am ausdauerndsten von allen. Demenz, seit dem Schlaganfall brummt er nur noch.
Das Peloton hat die Ausreißer noch immer nicht erreicht, ist wieder langsamer geworden. Julio Baute will den Ton lauter stellen, erwischt den falschen Knopf, das Bild verschwindet, Menü steht auf dem Schirm. Er drückt Exit. Menü ist einfach. Aber es gibt Tasten auf der neuen Fernbedienung, die ihn auf unendliche Reisen durch Anzeigen schicken, und wenn er es endlich zum Fernsehbild zurückgeschafft hat, ist die Sendung, die er sehen wollte, meist vorbei.
Den alten Fernseher hat Julio Baute noch von zu Hause mitgebracht, Blaupunkt, Röhre. Ihn sechsmal repariert, bis weiße Querstreifen am unteren Bildrand flimmerten, dort auf und ab wanderten. Der Bildabnahmekopf, er hat kein Ersatzteil mehr bekommen.
Der neue ist flach, schmaler als seine Hand breit. Die Loge ist auf einmal doppelt so groß, hat Schwester Juana am Morgen der Heiligen Drei Könige gescherzt, als der neue Fernseher auf einem Tischchen unter dem Fenster stand. Gespendet von einer Elektrokette, deren Namen Julio Baute noch nie gehört hatte. Die Nonnen bildeten einen aufgeregten Halbkreis um ihn herum, jede Regung in seinem Gesicht beobachtend. Natürlich hat er sich gefreut, so gut er konnte, nicht überschwänglich genug, dessen war er sich die ganze Zeit bewusst, aber als er am Ende jeder einzelnen beide Hände drückte und vor Rührung über ihre Freude Tränen in die Augen bekam, waren alle zufrieden.
Julio Baute hat versucht, ihn zu öffnen, den neuen, trotz des Aufklebers über dem Rand der Verschalung, auf dem steht, dass die Garantie verfällt, wenn er beschädigt wird. Die Schrauben sind sehr klein, 5 zu 60 Millimeter, Kreuz, sie sitzen fest. Ihm ist der Schraubenzieher abgerutscht, mehrfach, hat anthrazitfarbenen Kunststoff zu winzigen Spänen zusammengeschoben, Kratzer hinterlassen. Irgendwann hat Julio aufgegeben. Seitdem wartet hinter dem Fernsehbild eine Frage auf ihn: ob er noch in der Lage wäre, ob er wissen würde, welches Bauteil welche Funktion erfüllt, sie erkennen, verstehen würde. Ob sich Kabel und Spulen in seinem Kopf nach wie vor von allein zu einem Schaltplan zusammensetzen.
Den Laden hat er verkauft, ehe die Maschinen anfingen, seltsam zu werden, bevor sich die Computer in sie hineinfraßen. Eine Zeitlang hat die Mutter Oberin davon gesprochen, die Telefonanlage auszutauschen. Seit der Krise ist keine Rede mehr davon. Zu seiner Erleichterung, nachts vor dem Schlafen hatte er versucht, sich vorzustellen, wie es wäre, mit den anderen Männern im Fernsehsaal zu sitzen, ab und an eine rauchen zu gehen, dreimal am Tag Essen, nachmittags Kaffee, mit einer der Pflegerinnen tanzen, wenn die Musikgruppen spielen. In einem unaufmerksamen Moment vielleicht die Hand auf ihren Hintern legen.
Augusto brummt, hebt seinen Gehstock, er kommt aus Richtung der Physiotherapie, sein Platz ist direkt vor der Tür, die Klinke, die er nicht zu öffnen vermag – das kann nur Julio, el Portero –, in der Hand. Morgens und nach der Mittagsruhe drückt und zerrt Augusto immer eine Weile an ihr, irgendwann beruhigt er sich, und wer immer dann von draußen reinwill, muss die Tür langsam aufdrücken, warten, bis Augusto Schrittchen für Schrittchen zurückweicht.
Es wird wirklich eine Sprintankunft werden, die Ausreißer sind eingefangen. Vereinzelt versuchen Fahrer noch wegzuspringen, machen nur wenige Meter gut, ehe das Peloton sie wieder schluckt. Dicht gedrängt, die Helfer der Sprintermannschaften bilden einen dünnen Flaschenhals vorne, der beschleunigt, Schlangenlinien fährt, wenn mehrere Angreifer gleichzeitig wegschießen, verzerrte Gesichter unter bunten Helmen, die jedes Loch wieder schließen. So wird es weitergehen, bis sie in die engen Gassen irgendeiner französischen Kleinstadt einbiegen, dann wird es kurz hektisch, wenn die Helfer ihre Sprinter vorne positionieren, und blitzschnell und kopflos ist alles vorbei.
Sprintankünfte erinnern ihn an die verfrühten Ejakulationen seiner Jugend. Aber morgen kommen erst die Pyrenäen, dann die Alpen. Julio, el Portero, blickt zur Uhr, langsam wird es spät für den neuen Bewohner, in einer halben Stunde beginnt der Rosario, die Zeiten stehen auf dem Schild neben der Klingel. Er wird nicht sitzen bleiben und warten, er kennt das bereits. Manchmal machen sie Theater, weigern sich, ihre Wohnung zu verlassen: Dann müsst ihr mich tragen, freiwillig gehe ich nicht!
Was soll ich machen?, weinen die Verwandten später am Telefon, ich kann ihn nicht zwingen, was soll ich machen.
Es gibt diejenigen, die zu schwinden beginnen, kaum dass sie eingezogen, ihre Koffer fertig ausgepackt sind, die Nonnen ihre Nummer mit Edding auf Etiketten, Waschanleitungen, Innenseiten der Knopfleisten oder unter die Krägen geschrieben haben. Sie werden schmaler mit jeder Mahlzeit, weiche Rundungen ebnen sich ein, neue treten hervor, nicht sanft gewölbt, sondern mit klaren Kanten. Ihre Schultern wollen zu den Knien, die sich nicht mehr strecken lassen, die einen Winkel bekommen, dessen Gradzahl kleiner wird. Erst wöchentlich, später täglich, bis in den Rollstuhl. Eine Weile stagniert es, aber die sitzenden Stunden zehren, die Muskelfasern immer kürzer, immer näher an 90° und darunter, und dann geht es bald nach oben, in den ersten Stock. Zu den Bettlägerigen, dem Sterbegebetgemurmel, Kathetern und Urinflaschen, mit hellem Stoff bezogenen Wandschirmen, hinter denen rote Lichter auf Nachttischen brennen, wenn die Beine sich wieder strecken.
Es gibt diejenigen, die sich einrichten. Die Damen tragen Schnurrbart, die Herren weißliche Stoppeln an Wangen und Kinn, zwischen denen sich faltige Hautinseln ausbreiten. Julio lebt seit achtzehn Jahren im Asilo, und es geht ihm ausgezeichnet. Seit sein Knie vor achtzehn Jahren endgültig steif wurde, Meniskusriss, seit er mit der Schuhspitze an der Stufe vor dem Supermarkt hängen geblieben ist. Jeden Morgen ist er in den Supermarkt gegangen, hat jeden Morgen seine Schuhspitze über die Schwelle gehoben, ein halber Zentimeter, mehr war es nicht. Seine Reflexe sind in Ordnung, die Hände schnellten vor den Körper, fingen den Sturz ab. Nur die Einbuchtung zwischen rechter Kniescheibe und Schienbein kam auf der Metallschiene auf, die in den Boden eingelassen ist. Schmerzte so sehr, dass er sich ein Taxi rufen ließ, die zwei Blocks nach Hause fuhr.
Der Fahrer musste ihm in den Fahrstuhl helfen, oben hat Julio sich auf den Boden gesetzt. Sich mit den Armen und dem gesunden Bein vorwärtsgeschoben, bis zur Wohnungstür, auf die Fußmatte, die Türspione der anderen auf der Etage fest im Blick. Keiner verdunkelte sich, er ist erleichtert gewesen.
Warum hast du nicht um Hilfe gerufen?, hat Ana ihm später vorgeworfen. Am nächsten Morgen war das Knie geschwollen, er hatte es die Nacht über mit Eisbeuteln gekühlt, war erst als es dämmerte ein wenig eingedöst. Nachdem er es geschafft hatte, sich einen Kaffee zu kochen, hat er den Krankenwagen gerufen. Auf dem Sofa gewartet, gewusst, dass es der letzte Kaffee ist, den er zu Hause trinken wird.
Ana hat gewollt, dass er zu ihnen zieht. Eulalia kann sich um dich kümmern, hat sie gesagt. Wenn es ihr zu viel ist, stellen wir noch jemanden ein. Es war alleine seine, Julio Bautes, Entscheidung, ins Asilo zu ziehen. Er verachtet die Kirche, aber er mag die Nonnen.
Unverändert, sagt der Arzt bei jeder Vierteljahreskontrolle, die Werte sind unverändert.
Vor dem Einschlafen geht Julio noch immer seine Liste durch: Manchmal zwingt er sich, meist kommt er über fünftens nicht hinaus, dann ist schon wieder alles schlaff, ohne dass irgendwas passiert wäre. Fünftens ist Luisa, die Frau seines Angestellten Gil.
Rosa beschließt, eine Tasche zu kaufen
Im Camp wird es dunkel. Die Teilnehmer essen den restlichen Reis, verteilen ihre Kleider auf den Bambusstangen, die den Boden des Unterstands bilden. Die Kameras schalten in den Nachtmodus, das Bild wird bläulich grau, einige legen sich schlafen, der Rest sitzt am Feuer, gibt letzte Statements ab. Nichts ist vorbei, ich fange erst an, sagt die Blonde, die wahrscheinlich als Nächste rausgewählt wird. Ihr Gesicht hat in der Dunkelheit die gleiche Farbe wie ihre Haare, die Augen, Pupille und Iris, unterschiedslos schwarz. Umschnitt auf den Nachthimmel, Zeitraffer, wimmelnde Wolkenschatten, wandernde Lichtpunkte, langsam verblassend. Umschnitt auf die Bucht, Flut frisst Felsen, Himmel rosa, Sonnenball hebt sich, voilà, Tag. Ganz mühelos.
Rosa spürt die Wärme des Tablets auf ihren Oberschenkeln, sie hat es gegen die aufgestellten Beine gelehnt. Die Unterkante drückt in die Haut zwischen den Hüftknochen, drückt auf ihre Blase, sie muss pinkeln. Nimmt kurz den Kopfhörer ab, lauscht. Noch immer schrubbt eine Bürste, Eulalia ist noch im Bad. Rosa schwitzt, feuchte Schlieren auf der Rückseite des Tablets, sie wischt es am Leintuch ab. Lange kann sie nicht mehr aushalten.
Die Teilnehmer erwachen, die Frauen gehen schwimmen, danach streiten sie, wer für das Erlöschen des Feuers verantwortlich ist. Umschnitt, Kamerafahrt über die Bucht, die Melodie, die einen Wettkampf ankündigt, ertönt. Verstummt gleich wieder, das Bild friert ein, die Geräusche aus dem Bad werden lauter, kaum gedämpft von Rosas Kopfhörern. Das Laderädchen dreht sich, der Stream hakt. Der Moderator steht still, mit weit ausgebreiteten Armen und aufgerissenen Augen, als wollte er sagen, er wisse auch nicht, was los ist.
Rosa lädt die Seite neu, aus dem Bad Klacken, als würde Gläsernes auf eine harte Oberfläche gestellt. Eulalia braucht jeden Tag länger mit dem Putzen. Rosa sucht die Stelle im Video, die sie zuletzt gesehen hat. Im Wasser sind Pfähle aufgebaut, auf denen die Kandidaten stehen, ihre Füße in zwei schmale Kerben gepresst, die am oberen Ende rechts und links ins Holz geschnitten sind. Wer als Letzter ins Wasser fällt, gewinnt für sein Team eine Fischerausrüstung, bestehend aus Leinen, Haken, Netz und einem Bambusspeer. Noch sind es zwei Teams, wenn nur noch zehn Teilnehmer übrig sind, kämpft jeder gegen jeden. Amanda ist die Vorletzte, die ins Meer springt.
Das Wasser ist großartig, schreibt Rosa, schön frisch. Behält das Telefon in der Hand, die Teilnehmer kehren ins Camp zurück, fangen aber keinen Fisch. 2 Favoriten, 3 Favoriten, 4, kein Retweet. Und niemand aus Madrid.
Die Blonde wird am Ende rausgewählt, Vorschau auf die nächste Folge.
Als Rosa im Februar, direkt nach der Landung, beim Warten am Gepäckband den Flugmodus deaktiviert hat: beruhigendes Vibrieren, minutenlang. Das Display hat noch geleuchtet, als das Laufband den ersten Koffer auf sie zutransportiert, geht gar nicht mehr in Stand-by. Sie behält es in der Hand, sieht zu, wie immer mehr weiße Querbalken mit Meldungen hinzukommen, die Zahlen größer werden. Sammelt. Überlegt, während sie den zweiten Koffer vom Band hebt, wen anrufen. Und ob überhaupt. Ana wird nicht rangehen, aus oder stummgeschaltet, Felipe dürfte im Club sein, 18 Uhr 39, unwahrscheinlich, dass er noch fahren kann. Gar nicht anrufen, ein Taxi nehmen, an der Pforte klingeln, die Koffer neben ihr auf dem Bürgersteig. Standardfilmszene: gescheitert, in der großen Stadt gescheitert, Rücksturz zur Erde, nach Hause, ins Kinderzimmer. Und wenn sich die Pforte öffnet: Eulalia. Und: Warum und wieso und was denkst du dir? Und wenn sie sich nicht öffnet: Warten auf dem Bürgersteig, immer noch Standardfilmszene, Rosa klein auf der Bordsteinkante, rechts und links ragen die Koffer auf. Und: Alle Nachbarn haben dich gesehen, das Erste, was Ana sagen würde.
Felipe geht ran, nach dem ersten Klingeln.
«Deine Vorfahren grüßen dich.» Pause. «Morituri te salutant», setzt er hinterher.
«Ich bin am Flughafen.»
«Weißt du, was morituri te…»
«Nein», unterbricht sie ihn. «Ja, weiß ich.»
Einen Moment ist es still.
«In Madrid am Flughafen?»
«Nein.» Das Transportband stoppt, die letzten Mitreisenden schieben Gepäckwagen in Richtung Zoll. Das Flugzeug war halbleer, Karneval ist gerade vorüber, Rosa hat eine Sitzreihe für sich alleine gehabt.
«Ist Ostern?»
«Nein.»
«Weiß deine Mutter …?»
«Nein. Los Rodeos, ich habe gerade die Koffer geholt.»
«Ich kann nicht fahren.»
«Rufst du Mama für mich an? Ohne Vorfahren und Morituri?»
Sechs weiße Balken auf dem Display, Text-Nachrichten, Fotos, Videos, die Rosa noch nicht anguckt, weder in der Ankunftshalle, während sie wartet, noch auf dem Autorücksitz, während alle schweigen und Rosa sicher ist, dass Felipe auch lieber auf sein Telefon sehen würde als aus dem Seitenfenster. Rosa schiebt lediglich mit dem Daumen den Displaydesktop nach unten, liest immer wieder die Push-Benachrichtigungen, beobachtet zufrieden die steigenden Zahlen, zehn, elf, zwölf Chatnachrichten, achtzehnmal Instagram, elfmal Twitter, zwei Mails von der Fluggesellschaft, Bitte bewerten Sie Ihr Erlebnis bei uns an Bord.
Die Nachrichten sind für nachher, wenn es ganz schlimm ist, alleine in ihrem Zimmer. Rosa spart sie auf, wie die Papas fritas beim Abendessen am Tellerrand. Hält das Telefon fest in der Hand beim anschließenden: Wir wollen doch nur mit dir reden. Und: Wenigstens eine Erklärung. Und: Was möchtest du jetzt tun? Traut sich nicht, mit dem Daumen das Display runterzuschieben, nach den Zahlen zu sehen, hält das Telefon nur fest in der Hand. Gleich, denkt sie, gleich. In ihrem Zimmer, wo ihr Hirn anfängt, die Fragen zu beantworten – nein und nein und nichts –, noch während sie die Lampe anschaltet und sich aufs Bett wirft.
Als Rosa fertig ist mit Lesen und aufblickt, wird ihr klar, dass sie die Ameisen vergessen hat. Fliegen kommen in Madrid nur, wenn der Abwasch zu lange steht, selten mal Mücken in der Nacht, die Kakerlaken winzig und ohne Flügel. Hier aber drängen die Insekten permanent vorwärts, stürmen an, dringen ein, hier ist alles nur abgetrotzt, alles der Natur nur abgetrotzt.
Die Deckenlampe brennt, Rosas Fenster steht einen Spalt offen, durch den sie ins Zimmer gelangen. Sie lassen sich vom Luftzug hineintragen, krabbeln über den abplatzenden Lack des Fensterrahmens, taumeln, Hormigas voladoras, fliegende Ameisen, kleine dunkle Striche. Die um die Lampe kreisen, an der Decke sitzen, winzige dunkle Striche, am dichtesten am Fenster, auf dem cremefarbenen Stoff des sich blähenden Vorhangs.
Am nächsten Morgen liegen sie federleicht und hellgrau geflügelt auf den Fliesen, wirbeln auf, sobald Rosa den Fuß neben sie auf den Boden setzt, bleiben an der Hornhaut ihrer Sohlen kleben.
Im Bad endlich Stille, Rosa steht auf, öffnet die Tür. Ihre Cremetiegel, Lippenstifte, Kajal kreuz und quer, ihre Nagellackfläschchen, die Seifenschale stehen nicht in einer ordentlichen Reihe auf der rötlich gemaserten Marmorplatte, wo sie hingehören, nach dem Putzen ordentlich wieder aufgereiht, sondern liegen im Waschbecken. Wasser tropft darauf.
Vierzehneinhalb Staffeln mit 23 Folgen, die jeweils knapp 45 Minuten dauern. Rosa rechnet es auf dem Handy aus, während sie auf der Toilette sitzt. Etwas mehr als 250 Stunden Survivor hat sie geguckt, seit sie wieder zu Hause ist. Unironisch. 23 Staffeln gibt es insgesamt. 146,625 Stunden hat sie noch vor sich, die Zahl ist irgendwie beruhigend.
Rosa spült, schaufelt mit beiden Händen die Kosmetika aus dem Waschbecken, hat keine Lust, die Tiegel, Fläschchen, Stifte wegzuräumen. Fährt mit dem Finger den Sprung in der Marmorplatte nach, er endet bei den Armaturen, wo der Stein rostbraun verfärbt ist. Lauscht. In der Küche stößt Geschirr aneinander.
An einem der ersten Morgen nach ihrer Rückkehr aus Madrid hat Eulalia, ehe sie das Bad geputzt hat, die Verbindungstür zu Rosas Zimmer weit geöffnet. Zum Lüften, behauptet sie. Rosa hat auf dem Bett gelegen, zugesehen, wie Eulalia weiße Wegwerfhandschuhe über ihre Finger zieht, die Toilettenbrille hochklappt, den Kopf schüttelt. Ist schließlich mit dem Tablet ins Wohnzimmer auf die Couch geflüchtet, später ins Arbeitszimmer, zwischen Stapel jahrealter Aufsätze. Seitdem versucht Rosa, daran zu denken, die Verbindungstür zu ihrem Zimmer hinter sich abzuschließen.
Sie zieht ihre Turnschuhe an. Als sie im Wohnzimmer die Gardinen beiseiteschiebt, die Terrassentür öffnet, schließt Helligkeit ihre Augen, trockene Wärme strömt an ihr vorbei. Hinter der Gartenmauer, wo die Straße verläuft, flimmert die Luft. Ein Gitternetz aus wadenhohen Halmen sprießt zwischen den Steinplatten, Rosa gibt acht, nicht auf sie zu treten. Sie nicht einmal zu streifen, sie kitzeln auf der Haut wie Insekten, die einen aus Versehen berühren. Ein Streifen gelb gewordener Rasen umschließt die Terrasse, und dahinter kommt das Unkraut. Hüfthoch, bereits überwiegend bräunlich, mit scharf getrockneten Kanten, wo die Stiele abgeknickt sind, die weiße Kratzer auf den Oberschenkeln hinterlassen. Rosa geht ein paar Schritte und bleibt stehen, stampft mehrmals auf, wartet, bis die Eidechsen aufhören zu rascheln. Kleine schwarze Samen hängen an ihrem T-Shirt, Amor seco, trockene Liebe, heißen sie, verheddern sich in ihrem Haar. An den größeren Pflanzen kleben Trauben gebleichter Schneckengehäuse, alle leer, in die meisten sind kleine Löcher gepickt.
Rosa muss aufpassen, wo sie hintritt, unter dem Gestrüpp liegen die Einfassungen der Beete verborgen, lauern Furchen, die der Regen in über zehn Jahren nicht weggewaschen hat. Neun war Rosa, als ihr Vater aufhörte, an der Uni zu arbeiten. Von nun an sei er nichts weiter als ein einfacher Bauer, hat er stattdessen ständig wiederholt.
Hat versucht, Kartoffeln zu ziehen. Die Erde in langen Bahnen aufgehäuft, tiefe Rillen zwischen die Reihen gegraben. Murmelgroß und schwarz waren die Kartoffeln, innen sehr gelb, süßlich und seltsam klebrig im Mund beim Kauen. Den Großteil hat Ana weggeworfen, heimlich. Das Gemüse sah gequält aus, deformiert, gefleckt, mit tief eingegrabenen Malen, die Schalen angeschrumpelt, zerkratzt von dem Werkzeug, mit dem Felipe es aus dem Boden geholt hatte. Einmal ist Rosa aus der Schule gekommen, hat sich einen Trinkjoghurt nehmen wollen, doch der Kühlschrank war voller Bubango, in jedem einzelnen Regal, den Fächern in der Tür. Eine Woche später ist es Salat.
Eine Phase, hat ihre Mutter es genannt. «Es geht vorbei» gesagt, das Gemüse Eulalia mitgegeben.
Im ersten Semester an der Hochschule in Madrid hat Rosa versucht, eine Arbeit daraus zu machen. Installation, Arbeitstitel: Was von meinem Vater übrig blieb. Sie war an der Umsetzung gescheitert. Foto, dokumentarisch, erschien ihr uninteressant, Video machten fast alle anderen. Hyperrealismus. Rosa hatte Beete in der Ausstellungshalle anlegen wollen, um sie dann verwildern zu lassen. Wollte Erde von der Insel nehmen, Samen, Schnecken einfliegen, die Insekten. Lampen mit ausreichend Lumen sollten an die Decke, um die Sonne zu ersetzen, und wenn Rosa ihn gebeten hätte, hätte Felipe es wahrscheinlich bezahlt. Hatte sie aber nicht.
Den Hühnerstall hat sich die Bougainvillea geholt, ihre Ranken verschlungen, an zentimeterlangen Dornen ineinander verhakt, mit winzigen Saugfüßen fest mit dem trockenen Mörtel verbunden. Die Tür hat ein Fenster, in dem grün lackierter Fliegendraht gespannt ist. Die Bougainvilleazweige haben die feinen Maschen auseinandergestemmt, sich Öffnungen geschaffen, durch die sie ins Innere der Hütte gewachsen sind.
Vor dem Hahn hat Rosa sich geekelt, die Hühner nicht anfassen dürfen, wegen Krankheiten und Ungeziefer. Ihre Mutter hat darauf bestanden, dass Felipe sie einhegt. Rosa hat zugesehen, wie ihr Vater den Zaun baute, aus Latten, die er krumm und schief zwischen zwei Streben nagelte, mit lila geschlagenen Daumennägeln und sonnenverbranntem Nacken, von dem Rosa abends die tote Haut ziehen durfte.
Am Ende hat sich Manchita die Hühner geholt. Eines hat versucht, über den Zaun zu entkommen, Manchita, die Terrierhündin der Nachbarin, hat im Flug ihre Zähne hineingeschlagen, den Bauch aufgerissen. Gelblich feucht verklumptes Hühnerfutter ist herausgefallen, vor Rosa auf den Boden. Daraufhin hat Felipe sich ein Luftgewehr geliehen, zum Üben Löcher in die fleischigen Blätter der Agaven geschossen. Mehrere Tage hat er auf der Lauer gelegen, schließlich die Hühner freigelassen, um Manchita anzulocken. Doch sie kam nachts, als alle schliefen. Rosa kann sich an Anas Erleichterung erinnern, als Felipe aufhörte, nichts als ein einfacher Bauer zu sein, und anfing, nachmittags in den Club zu gehen.
Rosa hört den Staubsauger schon, ehe sie die Terrassentür aufschiebt. Eulalia ist im Wohnzimmer. Saugt Kalkplacken ein, die von der feuchten Stelle oben an der Wand auf das Polster des Sessels gerieselt sind, den letzten schwarzledernen Versuch ihrer Mutter, das Haus einzurichten.
«Achtung», sagt Eulalia und deutet auf die rötlichen Erdklümpchen, die, von den Sohlen zu Rauten gepresst, hinter Rosa auf den Terrassenfliesen liegen. Rosa zieht die Turnschuhe aus, trägt sie in ihr Zimmer. In Madrid war es unmöglich gewesen, zuzugeben, dass sie Eulalia nicht mochte. Wer schon nicht aus prekären Verhältnissen kommt, muss wenigstens seine Dienstboten lieben, so hat sie es Marisa gegenüber formuliert.
Rosa hat keine Lust zu duschen, nicht einmal Lust auf Survivor. Zu heiß für alles, fahre nach Hause, schreibt sie.
An welchem Strand bist du? Bin in Radazul, aber hier sind Algen. Marisas Antwort kommt sofort, Rosa wirft das Telefon aufs Bett. Es wäre ja nur ein Tippen, eine winzige Bewegung der Hand, nein, eines Fingers, der kurz innehält, kurz das Display berührt, senden, mehr ist es nicht. Und wäre Rosa nicht im Umdrehen gegen die Kommode gestoßen und wäre die Tasche nicht heruntergefallen, auf Rosas nackte Füße, wahrscheinlich hätte sie Marisa geantwortet und sich mit ihr getroffen.
Die Tasche ist quadratisch, aus Kunststoff, weiß, mit einem Reißverschluss oben. Am unteren Rand ist schwarz die Skyline von New York aufgedruckt, mit den Türmen des World Trade Center. Sie muss aus den 80ern oder 90ern stammen, das Plastik blättert an mehreren Stellen ab, schmutzig grauer Stoff kommt darunter zum Vorschein.
Vorgestern ist Rosa noch sicher gewesen, sie wird keine neue Tasche kaufen. Sie war ein wenig rumgelaufen, hatte Musik gehört, als der Bürgersteig vor ihr plötzlich blockiert war von einer weißhaarigen Frau. Sie stand vorgebeugt, mit den Unterarmen auf einen Rollwagen gestützt, Rosa musste auf die Straße ausweichen.
«Chica», hat die Frau gerufen, Mädchen, laut genug, dass Rosa sie trotz der Kopfhörer versteht. Und als Rosa sich nach ihr umdreht: «Hilf mir!» Nicht bittend, nein, sehr bestimmt, ein Befehl. Rosa ist stehen geblieben. Die Frau trägt eine dunkle Sonnenbrille, ihr dickes weißes Haar im Seitenscheitel, zu einem Bob geschnitten.
«Hilf mir», wiederholt sie.
«Wie denn?» Rosa ist einen Schritt auf sie zu.
Die Frau hat auf die am Gestänge der Gehhilfe befestigte Tüte gedeutet. «Nimm die.»
Rosa ist neben ihr hergegangen, auf der Straße, schweigend. Eine der Rollen quietschte leise.
«Halt», sagt die Frau unvermittelt, «hier wohne ich.» Sie deutet ins Dunkel zwischen den geöffneten Doppelflügeln einer großen Holztür.
Rosa weiß genau, wo sie sind, Asyl der barmherzigen Schwestern für in Not gefallene Alte steht in schwarzen Buchstaben auf der weißen Steinplatte über dem Eingang.
«Ich verabschiede mich.» Rosa will nicht vor dem kleinen Kameraauge stehen und warten, und wenn sie drin ist, hebt er allenfalls die Hand und dreht sein Gesicht in Richtung Fernseher, wenn sie die weißlichen Stoppeln seiner Wange küsst.
«Chica», sagt die Frau, «alleine komme ich da nicht hoch.» Sie deutet auf die Rampe aus weinrotem Stein. In regelmäßigen Abständen sind raue Streifen hineingeschliffen, damit niemand rutscht, rechts und links ein Geländer, damit niemand fällt.
Neben der Rampe führen drei Treppenstufen zu einem Absatz, dort ist die Klingel, ein kleiner Messingknopf, direkt unter der Kamera in die Wand eingelassen. In einer Nische hängt Christus, zu seinen Füßen sitzt die Puppe, blond noch immer, ihr Pony sieht unter der schwarz-weißen Haube hervor. Sie trägt ein Nonnenhabit, nicht einmal das Kreuz, an einer langen Kette am Gürtel befestigt, fehlt. Als Kind, Rosa kann sich noch daran erinnern, ist sie hier immer müde gewesen, hat nach Hause gewollt, Schreikrämpfe bekommen, weil sie die Puppe anfassen wollte. Oft waren sie nicht hier. Mit Rosa gesprochen, richtig mit ihr gesprochen, hat er nur einmal. «Kunst?», hat er gefragt. «Wozu das?» Sie hatte sich von ihm verabschieden müssen, ehe sie nach Madrid zog, Ana hatte darauf bestanden. «Meiner Stimme Gehör verschaffen» oder ähnlichen Unsinn hat Rosa geantwortet. «Was hast du denn zu sagen?», entgegnete er. «Warum hasst Opa uns?», hat Rosa irgendwann gefragt. «Opa hasst uns nicht.» Anas Stimme streng.
«Los!» Die Frau steht bereits am Fuß der Rampe, eine Hand am Geländer, die Gehhilfe hat sie ein Stückchen hinaufgeschoben, die Griffe lehnen rechts und links an ihrem Bauch, damit sie nicht zurückrollt. «Du gehst vor», sagt die Frau und beugt sich ein Stück zur Seite, damit Rosa an ihr vorbeikommt.
«Hier, fass an.» Rosa versteht nicht. «Den Tacataca», sagt die Frau und deutet mit dem Kinn auf die Gehhilfe, «ich halte mich daran fest, und du ziehst.» Und so geht Rosa rückwärts die Rampe hinauf, die Hände fest um das Gestänge geschlossen, das Kameraauge im Blick.
Rosa drückt die Klingel, legt eine Hand an den Knauf, um die Tür zu öffnen, sobald der Summer ertönt. Blickt zur Seite, jetzt sieht er sie, da ist sie sich sicher. Doch es bleibt still.
«Wie viel Uhr ist es?», fragt die Frau hinter ihr.
Rosa zieht ihr Handy hervor. «Kurz vor fünf», sagt sie, klingelt erneut.
«Lass das, bis fünf ist Rosario, da macht er Pause, der faule Sack. Geht nicht mal in die Kirche mit den anderen, liegt faul in dem Sessel beim Kaffeeautomaten. Und niemand kommt rein oder raus.»
«Tut mir leid», sagt Rosa, «ich muss jetzt weiter.»
«Warte.» Die Frau hat den Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet, braun, Louis Vuitton und auf so nicht schäbige Weise abgetragen, dass sie echt sein muss.
«Nicht nötig.» Rosa will kein Geld.
«Warte!», sagt die Frau erneut, und Rosa bleibt und weiß nicht, warum.
«Hier.» Die Frau hält die Tasche in der Hand, schmutzig weiß, schwarze Skyline, World Trade Center.
«Ich brauche so eine Tasche», sagt sie, «genau die Größe. Mit Reißverschluss, der hier ist kaputt, siehst du.» Sie ratscht ihn auf und zu, auf und zu, an mehreren Stellen greifen die Zähnchen nicht mehr ineinander. «Die taugt nichts mehr, du sagst mir, wie viel du ausgegeben hast, und ich gebe dir das Geld zurück.»
«Gut», sagt Rosa. «Mache ich», sagt sie und glaubt es nicht. «Bis bald!»
«Moment», sagt die Frau, als Rosa sich zum Gehen wendet. «Nimm die mit, als Muster, ich will genau so eine, die Größe mit Reißverschluss.» Hält ihr die Tasche hin, und Rosa hat sie genommen, während die Glocken läuteten. Der Rosario war zu Ende.
Rosa ist sicher gewesen, sie wird keine Tasche kaufen, wird die alte behalten, die ist großartig, allein schon die Türme. Doch dann stößt sie gegen die Kommode, und die Tasche landet auf ihren nackten Füßen, kalt und glatt, und Rosa hebt sie auf. Eine Weile steht sie im Zimmer, hält einfach nur die Tasche in der Hand und denkt, du stehst in deinem Zimmer und hältst einfach nur eine Tasche in der Hand. Beweg dich, gottverdammt. Schließlich legt sie die Tasche aufs Bett, guter Kontrast auf dem roten Laken, nimmt ihr Telefon, macht ein Foto.
Plan für heute: Karma-Punkte sammeln, schreibt sie.
Zieht ihre Sandalen an, sprüht Deo unter die Achseln, und als sie wieder nachsieht, fragt Aki, ja, wirklich, Aki aus Madrid: In der Tasche?
Zweiunddreißig Minuten später wartet Rosa am Ende der Avenida de la Trinidad in der Schlange vor der Kasse des XXL-Ladens. Hält in der einen Hand eine Plastiktasche, rosa und cremefarben geblümt, mit den gleichen Maßen wie die mit den Türmen, 3,99 €, in der anderen ihre Kreditkarte.
Draußen vor dem Schaufenster Gedränge, am Ende der Avenida de la Trinidad ist alles eng. Vierspurig trifft die Straße aus Santa Cruz hier auf die Altstadt von La Laguna, eine Schlagader, die abrupt in filigranem Aderngeäst und Kapillarengewimmel mündet. In der Mitte die Kapelle, rechts und links von ihr die Calle Herradores und die Calle Carrera, beides Fußgängerzonen. In den Eckhäusern Haushaltswarenläden, die schon immer da waren, und das Marks&Spencer-Outlet dort, wo mal der Elektroladen von ihrem Großvater gewesen ist. Davor die Endstation der Straßenbahn, im Fünf-Minuten-Takt pumpen die kleinen bunten Wagen Fahrgäste auf den Bürgersteig unter den Arkaden, zwischen die rauchenden Once-Verkäufer, die auf Klappstühlen zusammensitzen, unablässig ihre Nummern rufen, neben Schmuckhippies, sonnenblonden, braun gebrannten Deutschen, Schweden, Holländern, in orangenen, braunen, grünen Sackklamotten, Silberringe mit irgendwie in Lederbänder eingeflochtenen Muscheln auf den samtbezogenen Auslagen vor ihren Bäuchen.
Die Klimaanlage im XXL-Laden funktioniert nicht richtig, Schweißschlieren auf dem cremefarbenen Plastik in Rosas Hand. Zwei Kunden sind noch immer vor ihr, Rosa betrachtet das Hello Kitty-Regal neben der Kasse, Federmappen, Stifte, die sie gerne einzeln in die Hand nehmen würde, vielleicht die Packung At the beach-Radiergummis kaufen. Kitty in rotem Badeanzug, Sonnenschirm in Regenbogenfarben, ein rosafarbener Eimer und drei hellblaue Muscheln. Unpostbar.
Mit Hello Kitty hat es angefangen. Im Kindergarten hat sie verstanden, dass es den anderen Mühe bereitet. Du musst doch nur malen, was du siehst, sagt Rosa, bis Marisa sie jedes Mal kneift. In der Schule benötigt sie für eine Hello Kitty keine drei Minuten. Mit Luftballons, roten oder rosa Schleifen, Eis in der Hand, Cupcake mit Kerze. In der Pause sitzt sie am Tisch in der Cafetería, die Mädchen aus ihrem Kurs stellen sich an und sagen, eine nach der anderen, was sie gemalt haben möchten. Bitte, bitte. Häufig streiten sie über die Reihenfolge, weil die Letzten bis nach der nächsten Schulstunde warten müssen, ehe sie ihr Bild kriegen. Marisa ist immer die Erste.
«Kunst», antwortet Rosa bestimmt, fünfzehn-, sechzehn-, siebzehnjährig, wenn sie nach dem Späterstudierenwollen gefragt wird. Entschieden, ohne Verlegenheit oder Zweifel, häufig begleitet sie das Wort mit einem Nicken. Selbst die skeptischsten Freunde – und die Freunde ihrer Mutter waren skeptisch – erklärten anschließend, sie seien von Rosas Berufung zur Künstlerin überzeugt.
Zu den Heiligen Drei Königen schenken Ana und Felipe ihr jahrelang Bildbände, die falschen, wie Rosa in Madrid feststellt. Picasso, Miró, Matisse, Moderne, Pop-Art, Warhol, Keith Haring, Lichtenstein: Posterbilder für Sechzigjährige.
Verzweifelt, würde Rosa sagen, wenn man sie fragen würde, wie es in Madrid war, alle seien verzweifelt gewesen. Alles schon da gewesen, und auch das bereits bearbeitet, nichts mehr besonders und die Kategorie besonders sowieso nicht tragfähig. Verzweifelt und nur damit beschäftigt, sich selbst abzusuchen. Ein Selbst, das bei allen übergroß geworden ist, als hätten sie nur darauf gewartet, sich endlich durch eine Lupe, nein, eher durch das Okular eines Mikroskops betrachten zu dürfen. Übergroß und im Zentrum fixiert, mit zwei Bügeln rechts und links, sodass nichts verrutschen kann, nichts anderes in den Blick drängt. Ich sehe, ich denke, ich finde, in mir, durch mich hindurch, das Wort banal hört auf zu existieren. Zu ähnlich, nicht anders, nicht genug, ist alles, was die meisten finden, und Angst, viel Angst. Was ist noch möglich, wenn alles möglich ist?
Rosas Handy vibriert. Felipe, eine SMS.
Du musst mich abholen, ich kann nicht fahren steht da.
Wohin?, antwortet sie.
Deine Mutter will, dass wir zu den Surrealisten gehen.
Keine Lust, hat Rosa bereits getippt, als ihr einfällt, dass sie darüber schreiben könnte. Nena, ihre Mitbewohnerin in Madrid, hat sich vor Lachen in die Hose gepinkelt, als sie von den Ausstellungen – Rosa macht Anführungszeichen mit den Fingern, jedes Mal, wenn sie das Wort benutzt – erzählt, die sie in ihrer Kindheit in Santa Cruz mit ihren Eltern angesehen hat.
Wenn du nicht gehst, gehe ich auch nicht, schreibt Felipe. Sucht eine Ausrede. Rosa löscht die Buchstaben wieder. Ich hole dich um halb acht ab, tippt sie stattdessen.
Der letzte Konquistador
Felipe Bernadotte sitzt nicht, er liegt in seinem Sessel. Trägt eine beige Hose, ein lachsfarbenes Polohemd, das Kragenband innen an einigen Stellen aufgescheuert, aber das weiß nur seine Haushälterin. Die Beine ausgestreckt und übereinandergeschlagen, seine bloßen Arme ruhen auf den Lehnen. Schweiß sammelt sich zwischen Haut und Leder, ab und zu hebt er die Handgelenke und lässt die Klimaanlage die Lache unter ihnen auskühlen.
Felipe Bernadotte ist dreiundfünfzig Jahre alt und hat nichts zu tun. Seine einzige Aufgabe, nüchtern zu bleiben, ist heute bereits unerfüllbar. Felipe blickt auf die Uhr über der hüfthohen Holzvertäfelung, es ist kurz nach zwei, er ist alleine in der Bibliothek. Die anderen Gäste sitzen im Rauchzimmer, in dem nicht geraucht werden darf, aber geredet, bei normaler Lautstärke, keine Schreie, kein überschießendes Gelächter, lauten die Clubregeln.
Ein Tropfen läuft über seine Hand, Kondenswasser des Whiskyglases, Felipe stellt es auf dem Tischchen neben sich ab. Tippt mit nassen Fingerspitzen rechts und links gegen seine Schläfen, schließt die Augen und konzentriert sich auf die beiden kühlen Punkte, spürt, wie sie allmählich verdunsten. Die Klimaanlage summt wie der Motor eines Kleinwagens, enervierend gleichmäßig und nicht leise genug, dass der Ton sich nicht ab und an ins Bewusstsein fressen, die Schwelle der Gewöhnung überwinden würde.
Die Augen öffnet Felipe erst wieder, als er ein Geräusch in seiner Nähe hört. Porzellan stößt gegen Porzellan. Rechts von ihm unter den Fenstern steht ein zierlicher Doppelsitzer, eingerahmt von zwei mit weiß-blau gestreifter Seide bezogenen Stühlen. Dort sammelt ein Kellner auf dem Couchtisch stehen gebliebene Espressotassen ein.
Kurz spürt Felipe den Impuls, sich aufrecht hinzusetzen, zu überprüfen, ob seine Kleidung in Ordnung ist, sein Gesicht abzuwischen. Der Kellner blickt nicht zu ihm herüber, mit Absicht nicht zu ihm herüber, beschließt Felipe. Der Kellner hat graue Schläfen und rückt sehr geschäftig im Weggehen die Sitzgruppe zurecht. Felipe hebt das Glas, schüttelt es kurz, sodass die verbliebenen Eiswürfel aneinanderstoßen. Der Kellner sieht ihn an, nickt aber nicht, gibt auch sonst kein Zeichen, dass er verstanden hat.
«Noch einen», sagt Felipe.
«Sicher?»
Felipe kann sich nicht erinnern, ihn schon einmal gesehen zu haben. Er antwortet nicht, hebt nur erneut das Glas und schüttelt es, der Kellner geht wortlos hinaus.
Die meisten Clubmitglieder kennt Felipe seit seiner Kindheit, gelegentlich setzt sich der eine oder andere zu ihm. Den Besuchern wird er verstohlen und mit gedämpfter Stimme als Institution vorgestellt, dort sitzt Felipe Bernadotte, der letzte Konquistador, mit seinem Whiskyglas. Verfügt man über ausreichend Mittel, geht jeder davon aus, man tue schon irgendwas dafür, im Zweifel so ausgezeichnet, so mühe- und geräuschlos, dass ein Außenstehender davon nichts mitbekommt. Felipe öffnet nicht einmal die Briefe zu Hause, Anas Büro kümmert sich darum. Im Moment zumindest, letzte Woche hat sie angedeutet, in Zukunft müssten sie das vielleicht anders regeln. Felipe nippt wider besseres Wissen erneut an seinem Glas, nur noch geschmolzenes Eis, dreht das Gesicht zur Tür. Im Flur ist niemand zu sehen, der Idiot lässt sich Zeit.
Er könnte klingeln. Aber dafür müsste er aufstehen, die Klingel ist an der Wand zwischen Kamin und Tür in die Holztäfelung eingelassen. Vielleicht, wenn er noch ein wenig tiefer rutscht, und dann noch ein wenig tiefer, sodass er beinahe liegt, sich nur noch Nacken und Kopf in der Senkrechten befinden, und wenn er jetzt das Bein ausstreckt und das Gleichgewicht nicht verliert, kann er, wenn er sich noch etwas reckt, mit der Schuhspitze die Klingel erreichen. Felipe sieht hoch, zu Fernando Bernadotte, vierter Graf von Buenavista, der über dem nie benutzten Kamin seine Stirn in Falten legt, erboste Linien zwischen dunklen Augenbrauen und dem makellosen Silberweiß seiner Allongeperücke. Felipe hält sich mit der rechten Hand an der Armlehne fest, schiebt die Hüfte noch weiter nach vorne, ist gerade dabei, das Knie durchzudrücken, nur eine Handbreit fehlt bis zu dem kleinen Messingknopf, als der Kellner eintritt. Es ist ein anderer, jünger, mit einem silbernen Tablett. Felipe zieht das Bein zurück, rutscht mit dem Hintern wieder auf die Sitzfläche. Der Kellner stellt den Whisky auf das Tischchen neben ihm.
«Danke.» Felipe wartet, bis der Kellner die Bibliothek wieder verlassen hat, ehe er seine Hand nach dem Glas ausstreckt. Über dem Kamin verdreht der vierte Graf von Buenavista die Augen und blickt um Einvernehmen heischend zu Rafael Bernadotte, dem sechsten Grafen von Buenavista an der gegenüberliegenden Wand. Felipe weiß, die beiden sind sich einig, dass er, Felipe Bernadotte – der Grafentitel ist bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit einem anderen Familienzweig erloschen –, lang ausgestreckt und betrunken in seinem Sessel, eine Schande ist.
Felipe hebt sein Glas: «Auf gerechte Ausbeutung», sagt er.
Am Anfang hat er mit ihnen abrechnen wollen. Zehn Seiten Thesis waren gefordert gewesen zur spanischen Kolonialherrschaft. Er hatte Wochen damit verbracht, den verwerflichsten Abschnitt in der Inselgeschichte zu identifizieren, an dem seine Familie maßgeblich beteiligt gewesen war. Es gab so viele, er hatte sich nicht entscheiden können. Nachts, betrunken auf der Azotea, hatte er schließlich beschlossen, über alles zu schreiben, über die schändliche Rolle der Bernadottes in sämtlichen Phasen, von der Conquista bis zum Faschismus. Nach 48 Seiten, die Abgabefrist war lange verstrichen, hatte er aufgegeben.
«Ich habe fertig studiert», sagt Felipe, laut, wie er irritiert feststellt. Keiner der Grafen von Buenavista wirkt beeindruckt.
Er ist ein leidlich guter Historiker gewesen, seine Studenten waren nicht desinteressierter als die anderer Dozenten, seine Aufsätze werden nach wie vor ab und an zitiert, manchmal sieht Felipe nach, wie oft sie in der Zwischenzeit runtergeladen wurden. Elf Jahre ist es her, dass er die Uni verlassen hat, Rosa war neun gewesen.
Niemand hatte ihm irgendetwas zugesichert oder versprochen, nichts war vereinbart gewesen, er hatte keinen Anspruch, er war nur selbstverständlich davon ausgegangen. Die Zweite Republik, der Bürgerkrieg gehörten ihm. Er hielt die Seminare, hatte mit Abstand am meisten Publikationen, vorgewerkschaftliche Arbeiterbewegungen, Verflechtung von Landeigentümern, faschistischer Bewegung und Kirche, alles seine Themen. Und natürlich hatte Leticia Ferrera schon vorher einen alltagsgeschichtlichen Ansatz vertreten und deswegen den methodischen Teil des Projektantrags geschrieben. Und natürlich war sie eine Frau. Und natürlich hatte er die beiden letzten größeren Projekte geleitet und wäre Teil des Projekts geblieben, hätte so viel beitragen können, wie er wollte, und das nächste Projekt wäre wieder seines gewesen. Das Schlimmste ist, dass keiner es ausspricht, hatte er immer wieder zu Ana gesagt. «Hör auf, das ist eine fixe Idee geworden von dir», hatte sie immer wieder geantwortet.
Bürgerkrieg und Repression auf den Kanarischen Inseln. Geschichte in privaten Fotos, Briefen und oralen Überlieferungen, das Thema war perfekt für ihn. Und es ging nicht um die Frauenquote oder um: andere müssen auch mal dürfen. Nein. Das Problem war sein Name, Bernadotte. Mit dem er immer kritisch umgegangen war. Er hatte schonungslos verurteilt, hatte seine familiäre Belastung immer transparent gemacht, sie stand in jedem Vorwort, das er verfasst hatte. Inhaltlich konnten sie ihm nichts vorwerfen, darum sprachen sie es nicht aus. Wollten sich nicht angreifbar machen. Aber darum ging es, darum hatte Leticia Ferrera die Projektleitung bekommen, ist Felipe überzeugt. Die Kündigung komme überraschend, hatte der Dekan gesagt, und ob er nicht nachdenken wolle.
Nein, wollte er nicht.
Felipe hebt erneut das Glas. «Auf die Bernadottes», sagt er. Der Whisky schmeckt schon wieder wässrig, die Grafen blicken an ihm vorbei zu Boden.
Am Anfang hatte Felipe vorgehabt, eine Stiftung zu gründen. Seine Aufgabe war es, aufzuarbeiten, ans Licht zu bringen, und wenn ihn die Universität nicht dabei unterstützte, würde er es alleine tun. Gesellschaft zur Aufklärung der frankistischen Repression hatte er sie nennen wollen. Er hatte sich mit einem Web-Designer getroffen, überlegt, wer von seinen ehemaligen Studenten als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Frage käme. Eine Sekretärin bräuchten sie, Räume hatte er besichtigt, Thesen formuliert, Projekte konzipiert und wieder verworfen. «Niemand wird dich ernst nehmen», hatte Ana gesagt.
Darüber hatte er lange nachgedacht, und ob es Sinn hätte, sich scheiden zu lassen. Schließlich hat er beschlossen, kein Bernadotte mehr zu sein und sich stattdessen um den Garten zu kümmern. Eine Dummheit ist das gewesen, und an dem Tag, als ihm das klarwurde, war er mit erdverschmierter Kleidung in den Club. Er hatte versucht, Süßkartoffeln zu ernten, hatte sich seitlich an sie herangegraben, hatte gegraben und gegraben, und als er endlich eine fand, hatte sie ausgesehen wie eine junge Karotte, nicht dicker als sein Zeigefinger. Er hatte die Kartoffel einfach liegenlassen, das Werkzeug ebenso, und war in den Club gegangen, direkt in die Bibliothek. Hatte sich unter den strengen Blicken seiner Verwandten auf den Boden gelegt, flach auf den Rücken, Arme und Beine ausgestreckt, braune Erde auf die Perserteppiche schmierend. Doch nicht einmal seine vollständige Kapitulation hatte die Grafen interessiert.
An der Tür hatten die Kellner beratschlagt, wie mit ihm zu verfahren sei. Sie hatten versucht, Ana anzurufen, sie glücklicherweise nicht erreicht. Schließlich hatte Felipe, noch im Liegen, einen Whisky bestellt, sich erst auf den Boden, dann in den Sessel gesetzt und beschlossen, dass nichts anderes mehr Sinn ergab. Seitdem überlegt er. Meist in diesem Sessel, manchmal nimmt er auch den anderen, rechts vom Kamin.
«Auf euren Sieg.» Felipe hebt schon wieder das Glas. Er ist zufrieden, der letzte Konquistador zu sein. In den guten Momenten fühlt er sich wie eine Figur aus einem Somerset-Maugham-Roman, ein melancholische Trinker, der in die Gegenwart hineinragt aus einer anderen Zeit. Fehlt nur eine unglückliche Liebe. Aber dafür taugt Ana nicht. Felipe könnte nicht einmal sagen, an welche Maugham-Geschichte er dabei denkt, zu lange her, dass er sie gelesen hat. Aber seine Niederlage ist absolut, dessen ist er sich bewusst, Kolonialismus, Kolonialismus, Felipe Bernadotte ist der sitzende Beweis, dass niemand aus seiner Haut kann.
Im Rauchzimmer sprechen sie über San Borondón, der Name schafft es mehrfach klar verständlich zu ihm herüber. Eine künstliche Insel, die keine zwanzig Seemeilen entfernt an einer flacheren Stelle des Atlantiks entstehen soll, auf einem aufgefalteten Fitzelchen Erdkruste, dessen Spitzen an fünf Stellen aus dem Meer ragen. Leicesters Legacy nennt sich das amerikanische Unternehmenskonsortium, das die Idee entwickelt hat, unter Berufung auf New Atlantis, den Floßstaat, den Hemingways Bruder Leicester in den 60ern vor Jamaika gegründet hat. «Stell dir vor», beginnt der Werbespot, der das ganze letzte Jahr über im Fernsehen gelaufen ist. Danach entfalten sich verschiedenste blaue Blüten im Zeitraffer zu Geigenmusik. Vor einem Monat hat das Parlament in Madrid das Projekt bewilligt, auch wenn der genaue Zweck der Insel nirgendwo genannt wird. Ana gehörte zu den entschiedenen Gegnern, ihre Koalition hat dennoch mit Ja gestimmt. Die Tourismusverbände sprechen von unabsehbaren Einbußen. Sie sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Eine neue Art Hotel fürchten sie, Unterbringung, Themenpark und Insel in einem.
Nebenan geht es um die Frage, ob es sich überhaupt um eine Insel oder nicht doch um ein Schiff handelt. Die meisten geplanten Flächen werden schwimmen, riesige Pontons, sagt jemand.
Felipe ist es gleichgültig. Er hat aufgehört, sich für Politik zu interessieren, als Ana ihm eröffnet hat, dass sie kandidieren werde. Für die Konservativen. Beim Abendessen, zwischen Vorspeise und Hauptspeise, beiläufig, so ganz nebenher. Rosa saß zwischen ihnen, sie waren mit dem Krabbencocktail fertig, abgepackter, aus dem Supermarkt, mit zu viel Mayonnaise, das wird Felipe nicht vergessen. Eulalia hat gerade die Gläser auf dem Tablett zusammengestellt, Ana wartet nicht einmal, bis sie den Raum verlässt, um das Fleisch aus der Küche zu holen. Rosa ist irgendwann in ihr Zimmer gegangen. Felipe hat es gar nicht mitbekommen, plötzlich war sie weg.
Er stemmt sich aus seinem Sessel, geht ins Bad, trifft zum Glück niemanden auf dem Flur. Nimmt eines der Handtücher von der Ablage über den Waschbecken. Wieder im Sessel, faltet er es in der Mitte, rutscht nach vorn, bis sein Nacken auf der Rückenlehne aufliegt, und bedeckt die Augen.
Der Kellner weckt ihn, indem er Felipe erst seine Hand auf die Schulter legt und schließlich den Stoff von seinem Gesicht zieht. «Sie werden erwartet.»
Felipe nickt, fängt im Aufstehen das Handtuch auf, geht doch, denkt er, tränkt es im Bad mit warmem Wasser. Wischt sich das Gesicht ab, steht still, mit geschlossenen Augen, bis die Nässe auf der Haut kühl wird, ehe er sich abtrocknet.
Rosa sitzt im Auto, startet wortlos den Motor, als Felipe die Beifahrertür öffnet und einsteigt. Lächelt ihn kurz an und bleibt nicht mit den Augen an den dunklen Wasserspritzern auf Kragen und Brust hängen, ganz so, als hätte sie nichts bemerkt. Rosa fährt auf die alte Carretera General. «Die Autobahn ist dicht», sagt sie, als sie Felipes Blick bemerkt, «haben sie im Radio gesagt.»
Er hätte etwas essen sollen, mit einem Mal fühlt Felipe seinen Magen, klein und zusammengekrampft, als hätte er die Form einer Rosine. Felipe muss aufstoßen, Speichel läuft in seinem Mund zusammen. Er drückt auf den Fensterheber, lehnt sich im Sitz zurück, drückt weiter, als Rosa beginnt, ihr Seitenfenster hochzufahren, drückt, bis seine Scheibe beinahe in der Tür verschwunden ist. Mit dem Luftzug geht es, zurückgelehnt im Polster. Rosa biegt rechts ab, schaltet das Radio ein, Salsa, macht es gleich wieder aus.
Für einen Moment ist zwischen den Häusern das Meer zu sehen. Die Sonne ist bereits untergegangen, in ein paar Jahren werden dort bei Dunkelheit Lichter leuchten, ob Insel oder nicht, dieses dümmliche San-Borondón-Gewäsch. Draußen am Horizont werden sie im unterschiedslosen Schwarz von Himmel und Wasser die Kim markieren. Eine gelbe Punktekette, so stellt Felipe es sich vor. Ein künstlicher Strand soll am Fuß der Felsnase der größeren Insel angelegt werden. Auf Betonplattformen, haben sie einander aufgeregt beim letzten Jahresempfang des Gastronomieverbandes erzählt, zu dem er Ana hatte begleiten müssen.
San Borondón, San Borondón, nach der Messe vor der Catedral, im Restaurant, an der Supermarktkasse, als Felipe gestern an der Bushaltestelle an der Plaza del Adelantado vorbeigegangen ist. Verschwörung, Verschwörung im Onlineforum des Diario de Avisos, bei den Linken wie den Rechten, immer neue Gerüchte: Testgelände, Waffen, Drohnen. Warum müssen sie extra eine Insel bauen, so weit draußen, wenn es nichts Schlimmes ist? Serverfarmen, künstliche Intelligenz, Ufo-Landeplatz.
Neu, durch und durch neu, das macht ihnen Angst. Nicht von der Zeit deformiert, zurechtgedrückt, geschliffen. Nicht mit Geschichte behangen, das macht ihnen Angst. Keine Verwerfungen, aufgestautes Geröll, verkrustete Strukturen unter einer nur mit Mühe glattgezogenen Oberfläche. Am Seitenfenster ziehen mit weißen Würfelhäuserstapeln besetzte Berghänge vorbei, die unregelmäßigen orangefarbenen Lichterketten der Straßenlaternen kreuz und quer dazwischen. Niemals wird dies hier neu werden, denkt Felipe. Niemals schlank und mit präzise gedachten Linien, und alles hat eine Funktion, und nichts ist nur da, weil es schon immer da war oder weil niemand sich die Mühe gemacht hat, es zu beseitigen.
Die Menschen, die sie erschaffen, San Borondón, sind geschichtsbehangen, wendet sein innerer Student ein. Sie wirken aber nicht so, antwortet der Dozent, betont geduldig. Sie wirken, als wenn sie alles vergessen könnten, jederzeit hinter sich lassen, was keine Funktion mehr erfüllt. Davor haben sie Angst. Und wir? In all den Gesprächen, ob Insel oder nicht, und wenn ja, wie schlimm, tun sie eigentlich nichts anderes, als «Und wir?» zu fragen.
Rosa bremst, die Ampel ist rot, sie muss die Straßenbahn durchlassen, deren Gleise die Straße kreuzen. Felipe betrachtet die riesengroße Schüssel vor dem Museo de la Ciencia, es ist die Antenne des Radioteleskops, braun gefleckt, verblichene Tarnfarbe, so scheint es, aber es sind die Koordinaten und der Umriss des nach der Insel benannten Berges auf dem Mond.
Die Hänge sind voll von Zurückgebliebenem. Zwischen den sie immer dichter bedeckenden hellen Würfeln, sind sie noch immer sanft gewellt von den Terrassen, auf denen fast hundert Jahre lang Wein wuchs. Auf jeder unbebauten Parzelle, jeder ebenen Fläche zwischen Straße und Berg wachsen Chumberas, bedeckt mit pudrigen Schildlausgelegen, trotz der Dämmerung sehr weiß und gut zu erkennen. Zuckerrohr, auf dem Kreisel, den Rosa zweimal