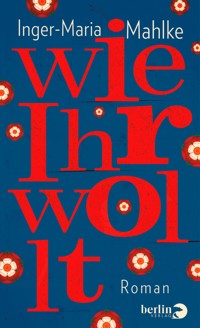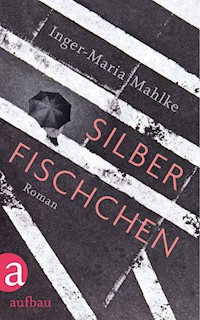19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Lübecker Familie, protestantisch, konservativ, kaisertreu: die Lindhorsts. 1890 kommt Marthe in einem weitläufigen Patrizierhaus zur Welt. Um sie eine Schar älterer Brüder, deren Freiheiten nicht ihre sein werden. Und doch ist es ein Leben mit glänzenden Aussichten. Bis ein Bestsellerroman, verfasst vom Sohn eines verstorbenen Bekannten, den Lindhorsts klarmacht, dass sie für ihr Umfeld auch nach Generationen noch immer «die Jüdischen» sind. Ein Familienepos über mehrere Generationen: der neue Roman der Buchpreisträgerin. «Man muss diese Autorin einmal mehr bewundern: für ihr bislang zugänglichstes Werk, für die Subtilität, mit der sie Beziehungen, Machtgefälle und die Regeln der Zeit beschreibt, in der es spielt ... Ein wagemutiger, erstaunlicher, toller Roman.» Hamburger Abendblatt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inger-Maria Mahlke
Unsereins
Roman
Über dieses Buch
Eine Lübecker Familie, kinderreich, konservativ, kaisertreu: die Lindhorsts. 1890 kommt Marthe in dem weitläufigen Patrizierhaus in der Königstraße zur Welt. Um sie eine Schar älterer Brüder, deren Freiheiten nicht ihre sein werden. Und doch ist es ein Leben mit glänzenden Aussichten. Bis ein Bestsellerroman, verfasst vom Sohn eines verstorbenen Bekannten, den respektablen Lindhorsts klarmacht, dass sie für ihr Umfeld auch nach zwei Generationen noch immer «die Jüdischen» sind.
Unsereins ist der Roman einer Stadt und ihrer Gesellschaft, ihrer Bürger und Lohndiener, der Handwerker und, vor allem, ihrer Frauen. Ob Dienstmädchen, Hausfrau, Weißnäherin oder Schriftstellerin, ob manisch-depressiv wie Marthes Mutter, durchlässig wie Marthe selbst, die mit eigenen und fremden Erwartungen ringt. Inger-Maria Mahlke erzählt von Identität und Zugehörigkeit, von Geschlecht und Klasse, von Macht- und Liebesverhältnissen – von allem, was nicht nur den vormals «kleinsten Staat des deutschen Reichs», Lübeck, formte und zusammenhielt.
Der neue Roman der Buchpreisträgerin: eine epische Familiengeschichte voll von Respekt, Humor und tiefer Einsicht.
Vita
Inger-Maria Mahlke wuchs in Lübeck und auf Teneriffa auf, studierte Rechtswissenschaften an der FU Berlin und arbeitete dort am Lehrstuhl für Kriminologie. 2009 gewann sie den Berliner Open Mike. Ihr Debütroman Silberfischchen wurde ein Jahr später mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis ausgezeichnet. Für einen Auszug aus ihrem Roman Rechnung offen bekam sie beim Wettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis den Ernst-Willner-Preis zugesprochen; 2014 erhielt sie den Karl-Arnold-Preis der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Ihr Roman Wie Ihr wollt gelangte unter anderem auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises, den sie 2018 für den Roman Archipel dann erhielt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Designbüro Lübbeke Naumann Thoben
Coverabbildung Interieur mit vier Zeichnungen (Ausschnitt). Gemälde von Vilhelm Hammershøi, 1904 (Vidimages/Alamy Stock Photo)
ISBN 978-3-644-00683-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die handelnden Personen
Friedrich Lindhorst, Rechtsanwalt, und Marie Lindhorst, Tochter des berühmtesten Dichters aller Zeiten, deren Kinder
Erasmus
Cord
Friedrich – Frieder – junior
Robert
Werner
Alma
Jost
Marthe
Senator Achim Lindhorst, Friedrichs ältester Bruder
Konsul Heinrich Lindhorst, sein zweiter Bruder
Ida Stuermann, Dienstmädchen im Haushalt der Lindhorsts
Johann Gotthard Isenhagen, Ratsdiener
Carl Richard – Charlie – Helms, Lohndiener
Mathilde – Tilly – Helms, geb. Weber, dessen Frau
Elisabeth Schilling und Wasserbaudirektor Konrad Schilling, deren Kinder
Theo (Konrads Sohn aus erster Ehe)
Henriette (Elisabeths Tochter aus erster Ehe)
Ilse, Lotte und Ludwig
Georg Presswitz, der eigentlich nach Berlin gehört, seine Mitschüler
Thomas – Tomy – Mann, der Pfau, und
Otto Grautoff, dessen Schatten
Pastor Leonhard, Georgs Pensionsvater, dessen Frau,
Sohn Heini und Töchter
Hermann Heinrich Bannow, kein Bäckermeister
Pauline, dessen Bulldogge
Theodor Schwartz, Former, Koch, Schriftsteller, Zeitungsherausgeber, Sozialdemokrat
Senator Pusselt, Unternehmer der Montanindustrie und völkischer Rechtsextremer
Die Senatoren Vanheeren, Martfeld, Steinbrück, Stenzel und Buchenberg, deren Söhne, Neffen und Cousins, Fechtclubmitglieder
Fanny zu Reventlow, Grethe Lindhorst, Maria Schorer, ihr Bruder Theo, Vilhelm – Vil – Petersen und Käthe, Ibsenclubmitglieder, ebenso Else und Grete Bützow, die studieren wollen
Die schöne Josephine, später Frau Martfeld
Alle wohnhaft im kleinsten Staat des Deutschen Kaiserreichs. Eigentlich der zweitkleinste: Bremen hat weniger Fläche und ein obskures Fürstentum Köstritz weniger Einwohner. Jedoch: zweitkleinster klingt mickrig.
IDer kleinste Staat
Januar 1890
1 Regen, noch immer kein Schnee im kleinsten Staat des Deutschen Reiches. Die zweite Januarwoche und nichts als stahlgraue Wolken, zügig und dicht gen Westen ziehend. Wäre dies ein Film und wir die Zuschauer, die erste Einstellung wäre mit einer Drohne aus der Perspektive eines Regentropfens gedreht: als würden wir durch seine vom Luftwiderstand abgeflachte Seite auf die Erde herabblicken. Vom Wind in einen spitzen Fallwinkel gedrückt, sähen wir erst nur das matschige Grünbraun Ostelbiens und einen Streifen wolkengrauer Ostsee. Bis sich ein Fluss in den Kameraausschnitt schiebt, die Trave, und außerdem ein zweiter, kleinerer, die Wakenitz, und dort, wo beide ineinander münden würden, wenn alles geradlinig verliefe, erhebt sich ein Hügel, den sie beide umfließen. Auf dem Hügel befindet sich ein Fleck, noch immer überwiegend backsteinrot, mittelalterfarben, und aus dieser Entfernung allenfalls fingernagelgroß: der kleinste Staat des Deutschen Reiches, seine älteste Republik. Und beides ist nicht ganz richtig, aber das wird Isenhagen später erklären.
Allmählich zeichnen sich die Gleise der Büchener Eisenbahn ab – der schmale, schwarze Strich, der schräg durchs Bild läuft, schwer auszumachen in all dem Grün –, die den mittlerweile faustgroßen Staat durchqueren und Richtung Altona verschwinden. Es sieht aus, als habe jemand einen Stein in einen mit Entengrütze zugewachsenen Teich geworfen: die ihn umgebenden Wallreste der alten Bastion wie konzentrisch sich ausbreitende Wellen. Nicht eben beeindruckend, wenn man als Tropfen bereits auf München oder Hamburg oder Berlin niedergegangen ist, und man könnte dem Irrtum erliegen, lediglich auf eine größere, aber nicht wirklich große norddeutsche Stadt zuzurasen. Dunkle Dachreihen, Gärten, Gänge und Straßen werden langsam erkennbar, türkisgrün angelaufen die Kupferdächer der Kirchen dazwischen. Auf ihren Türmen staken Wetterhähne wie Nadelspitzen, doch der Kameratropfen fliegt an ihnen vorbei, ohne zu zerschellen.
Es ist Montagmorgen, kurz nach neun, das Quadrat des Marktplatzes ist mit einem Muster aus Karren und Ständen bedeckt, die Waren sicher verwahrt unter von Algen angegrünten Planen. Die hellgelben, quirligen Punkte sind die Strohhüte der Fischhändlerinnen, die dunklen größeren, gemächlich im Zickzack wandernden die Regenschirme einkaufender Hausfrauen.
Eine Windböe drückt uns über den Giebel des neben dem Markt liegenden Rathauses hinweg. Das schwarze Längliche, das gerade die Breite Straße herunterkommt, ist der Zweispitz von Ratsdiener Isenhagen, der, wie jeden Montag, Mittwoch und Freitag im Winter, um einige Minuten verspätet zum Dienst eilt. Als er das Portal erreicht, befinden wir uns bereits über dem gegenüberliegenden Feuerwehrhaus. Fliegen die Königstraße entlang, werden einen Moment entsetzt von Ida Stuermann angestarrt, ehe sie mit dem Federbett im Arm, das sie eine halbe Stunde zuvor zum Lüften über das Fensterbrett gelegt und dort vergessen hat, im Inneren des Schlafzimmers im ersten Stock des Hauses Nummer 5 verschwindet. Ein letzter Windstoß schiebt uns die Straße hinunter, wir rasen auf die Anstalt zu, wie das älteste hiesige Gymnasium genannt wird. Kurz vor dem Aufprall blendet die Kamera ab.
Gut dreieinhalb Meter unterhalb des langsam über die Dachplatten herablaufenden Tropfens und von ihm durch einige Millimeter Zink, einem seit fünfhundert Jahren an dieser Stelle befindlichen Balken, eine Lage Dielenbretter und eine Schicht Putz getrennt, sitzt Georg, neuester, jüngster und wohl auch zögerlichster Chronist dieses Staates und betrachtet das soeben Geschriebene:
Liebe Mutter,
ich bin in größter Not, bitte lies diese Zeilen aufmerksam! Und zeig sie nicht gleich wieder Großvater
Er ist nicht sicher, ob er den letzten Satz streichen soll. Der Ton erscheint ihm falsch, nicht gewichtig genug. Nur: Wie gewichtig wirkt Gestreiche gleich in der zweiten Zeile? Es ist auch gar nicht einfach, einen langen, geraden Strich zu ziehen, wenn man mit angezogenen Knien in einer Toilettenschüssel hockt. Einer eingestaubten und unter dem Staub sauberen und nicht einmal mit Kalk verkrusteten Toilettenschüssel, deren Wasser abgedreht ist, aber dennoch. Das Buch mit dem Briefbogen lehnt an seinen angewinkelten Oberschenkeln, und wenn er beim Schreiben am äußeren Rand der Zeilen anlangt, muss er den Ellbogen anziehen, damit er nicht gegen die Schrubberstiele stößt, die neben ihm an den Fliesen lehnen. Sie kommen leicht ins Rutschen und poltern gegen die Holzwand, die seine Kabine von der nächsten trennt.
Die Toiletten im zweiten Stock – die einzigen Wasserclosetts der Anstalt – werden Primanertoiletten genannt, weil die Älteren ihre Räume hier oben haben und sich von den Jüngeren keiner hereintraut. Acht Holzverschläge, vier an jeder Seite, die letzte Kabine, rechts an der Wand unter dem dauergekippten Fenster, ist immer verschlossen. Sie dient dem Hausmeister als Lager für Putzzeug, wie Georg vor einigen Wochen festgestellt hat. Besetzt steht auf dem Schild über der Klinke.
Er war auf der Flucht vor zwei Tertianern in der Wasserlache auf den Fliesen vor den Waschbecken ausgerutscht und in die einzige Richtung gerobbt, die Schutz versprach. Hatte sich in Panik durch den Spalt zwischen Verschlag und Boden gezwängt, sicher, dass sie ihn entdecken würden. In Luft aufgelöst oder in der verschlossenen Kabine waren bald auch die letzten verbliebenen Möglichkeiten. Die Tertianer hämmerten gegen die Tür, das Holz vibrierte, klapperte in den Angeln. Georg zog sich zusammen, als es unvermittelt still wurde. Und dann sehr hektisch: Rufe, Schuhsohlen, die hastig auf nassen Fliesen Halt suchten, danach war es wieder still. Bis er es aus Richtung der Pissoirs plätschern hörte.
Seitdem ist Georg regelmäßig hier. In den meisten Hofpausen. Oder wenn Kandidat Lose, wie heute, in den ersten beiden Stunden «Bein hat» und sagt, die Klasse solle Aufgaben lösen und so ruhig sein, als läge sie vor Sedan. Obwohl Lose die Tür zur klaffenden Korridorstille weit offen lässt, dreht sich, noch bevor seine Schritte am Kreuzgang verhallen, der erste Ostelbische auf dem Stuhl um, das Geschoss aus Papier und Spucke fertig präpariert in der Hand.
Der Trick ist, vor den Großen bei den Toiletten zu sein. Sobald die Pausenglocke schrillt loszuschießen. Wenn er Hausaufgaben abschreiben muss, die Hefte griffbereit zu haben. Nicht den Flur im Erdgeschoss zu nehmen, in den die Tertianer aus ihren Klassenräumen strömen, sondern die vorderen Treppen bis in den zweiten Stock und oben den Korridor.
Georgs Waden kribbeln, er richtet sich auf, langsam, drückt die Knie durch, die Schrubberstiele fest im Blick. Einmal sind sie ins Rutschen gekommen, während sich draußen einer der Primaner, Tietjens, die Hände wusch. Glücklicherweise hat Tietjens die Flucht ergriffen, am nächsten Tag erzählt, eine bibergroße Ratte sei aus dem Hausmeisterverschlag auf ihn zugeschossen.
Zwölf Minuten sind es noch bis zum Ende der zweiten Stunde. Georg muss vor dem Pausenklingeln auf dem Korridor sein, wenn er den richtigen Moment verpasst, muss er warten, bis der letzte Primaner die Toilette wieder verlassen hat.
Der Brief. Georg geht erneut in die Hocke … und zeig sie nicht gleich wieder Großvater.
So schwer ist das nicht, könnte man denken. Aber Georg muss nicht irgendeinen Brief schreiben, sondern den absoluten, vollkommenen Brief, dem seine Mutter nichts mehr entgegensetzen kann. Keinen von denen, die er jeden Samstag verfasst, nach dem Mittagessen, mit den anderen Pensionären von Pastor Leonhard unten am Esstisch. Wer kein Briefpapier hat, bekommt von Frau Pastorin Leonhard, von allen heimlich Pastete genannt, Bogen und Kuvert mit der Ermahnung, ihr gleich am Montag beides zu ersetzen. Wer fertig ist – bevor die Uhr in der benachbarten Stube nicht drei schlägt, hat niemand fertig zu sein –, legt den nicht zugeklebten Umschlag im Flur auf die Konsole. Das Hausmädchen bringt sie später zur Post.
Ausschließlich wegen der Rechtschreibung, sagt die Pastete, nur wegen der Fehler pflege sie die Briefe vorher zu überfliegen.
Ich gehe zugrunde, könnte er schreiben, wenn du mich nicht holst, geh ich zugrunde.
Das ist dumm schreibt er stattdessen, und jetzt kann er die Seite wegschmeißen.
Nicht dass es sein erster Versuch wäre. Im November hat er heimlich während der Hausaufgabenzeit geschrieben. Den Brief abends beim Spazierengehen eingesteckt. Beim Einschlafen überlegt, gleich in der Früh seinen Koffer zu packen.
Am nächsten Morgen, beim Frühstück, hatte er trotz des ständigen «Nu iss endlich» der Pastete nicht aufhören können, in den Flur zu blicken, auf das Klingelschrillen zu warten, das jeden Moment in alle Körper fahren würde.
Atemlos vor Eile, so hatte er sich Mutter vorgestellt, denn den Weg vom Bahnhof wäre sie gelaufen, um nicht auf eine Droschke warten zu müssen. Mit braunen Strähnen, die sich aus ihrer Frisur gelöst hätten und an den Schläfen unter der Krempe ihrer Kappe hervorsähen. Mit knappen, scharfen Worten würde sie die Pastete anweisen, seine Abreise vorzubereiten.
Nach dem Frühstück hatte er umständlich nach Handschuhen gesucht, die in seiner Manteltasche steckten. Schließlich entschieden, in der Schule werde Mutter ihn auch finden. Sich die knappen, scharfen Worte ausgemalt, mit denen sie Kandidat Lose anweisen würde, Georg aus der Klassenliste zu streichen.
Auf dem Heimweg war er sicher, sie werde im Pastorat auf ihn warten. Dreimal hat er sich die Hände waschen müssen vor dem Essen, bis Augen und Nase nicht mehr rot waren, er wieder einatmen konnte, ohne Stocken, ohne dass sich in seiner Brust etwas zusammenzog und die Luft nur schubweise hereinließ.
Abends rief der Großvater aus Berlin an. Der Fernsprecher hängt in der Apotheke an der Puppenbrücke, die Pastete hatte darauf bestanden, ihn zu begleiten, nachdem einer der Apothekersöhne Bescheid gegeben hatte.
«Da ist bestimmt was passiert», sagte sie mehrfach, während sie neben ihm die Straße entlanglief. «Da ist bestimmt was passiert.»
«Kommt Mutter? Soll ich alleine fahren? Ich brauche Geld fürs Billett.» Georg hatte sich bemüht, die Pastete und ihre sich vor der Brust verschränkenden Arme nicht anzublicken.
«Langsam, langsam.» Die Stimme des Großvaters sanft, die As langgezogen, das folgende Lachen weich und warm. Wattig gepolstert, keine Kante, nichts Scharfes, das Trotz ermöglicht hätte. Wattig gepolstert schob der Großvater sämtliche Einwände beiseite. «Jeder Junge schreibt einen solchen Brief. Das gibt sich», wiederholte er mehrmals. Und die Art, wie er das sagte, klang, als habe er es, vermutlich Mutter gegenüber, schon einige Male wiederholt.
Ob er die Pension wechseln wolle, vielleicht zu einem der Lehrer?
«Nein.»
«Was ist denn so schlimm?»
Georg hatte nicht gewusst, wie er es beschreiben sollte. In wenigen Worten. Am Telefon. In die unerbittlich warm-wattige Stille hinein. Er war sicher, der Großvater lächelte, mit dem Hörer in der Hand, hinter seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Wahrscheinlich hatte er beim Reden Mutter zugezwinkert, die in einem der kleinen, im Halbkreis arrangierten Sessel ihm gegenübersaß.
Georg hatte bereits Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken, was so schlimm war. Er hatte Dutzende verschiedene Antworten gefunden. Keine einzige klang nicht lächerlich, wenn er sich die Worte innerhalb der mit silbernen Reihern tapezierten Wände des Berliner Arbeitszimmers vorstellte. Das Schlimme ist gleichzeitig sehr kompliziert und ganz einfach. In der komplizierten Variante gibt es an der Anstalt mehrere einander überlappende Hierarchien, unübersichtliche Verflechtungen und sich aus ihnen ergebende Konsequenzen. In der einfachen Variante steht Georg in jeder einzelnen dieser Hierarchien ganz unten, und alles andere ist eigentlich gleichgültig.
«Das Essen», hatte er schließlich geantwortet.
Scharfes Lufteinziehen der Pastete neben ihm. Die hatte er ganz vergessen.
«Denk auch ein bisschen an deine Mutter», hatte der Großvater zum Abschied gesagt.
Zu Weihnachten, in Berlin, hatte Georg versucht, mit ihr zu reden. «Aber im Herbst hat es dir dort doch so gut gefallen», hatte seine Mutter entgegnet.
Als er mit ihr im Oktober für eine Woche zur Aufnahmeprüfung hier war, wirkte die klaffende Korridorstille friedlich. Sonnenstrahlen fielen durch die hohen Fenster des Kreuzgangs, nach Tempelritter und Allerheiligstes und Gral sah die Anstalt aus. Die großen hellgrauen Steinplatten in den Fußböden im Erdgeschoss haben Senken in der Mitte und rundgelaufene Kanten und dort, wo sie nicht von zahllosen Füßen geglättet sind: Reste von Buchstaben. Die man, wenn man Der Graf von Monte Christo gelesen hat und gerade mitten im dritten Band von Sagen der Vorzeit steckt, auf allen vieren untersuchen möchte. Hätte er nicht befürchtet, Mutter werde sich umdrehen, ihn an der Hand nehmen, damit er nicht zurückbliebe, trödelte, einen schlechten Eindruck machte, hätte er sich sofort hingehockt.
In den Tagen danach, bei den Großeltern in Berlin, hatte er sich ausgemalt, wie er die Steinplatten entziffern würde, ihr Geheimnis – denn natürlich bargen sie ein Geheimnis – offenbaren. Alleine erst, später zusammen mit seinem Banknachbarn, der Ben heißen und mit dem er sich anfreunden würde. Vielleicht würden sie eine Schar Gleichgesinnter, wie es in Büchern heißt, um sich versammeln. Da war er sich nicht sicher gewesen.
Kaum an der Anstalt, hatte er zweierlei festgestellt: Die Steinplatten waren bereits entziffert, von Dr. Herbert – Latein, Altgriechisch, Geschichte –, der einem ständig die Aufsätze aufzählt, die er in den Jahresheften der Historischen Gesellschaft veröffentlicht hat. Fragt man ihn nach den Platten, ergießt sich ein endloser Schwall aus Namen, Kirchenämtern und Jahreszahlen, und von irgendwem gibt es tatsächlich noch einen Brief über den Klostergarten im Schularchiv, und früher oder später muss man etwas Lateinisches übersetzen, und wenn man einen Fehler macht, schlägt Dr. Herbert einem mit der flachen Hand gegen den Oberarm. Und außerdem: Würde Georg sich im Korridor auf alle viere hocken, wäre eine lange Folge Arschtritte unvermeidlich.
Er weiß ja, dass sie bloß dumm sind. Rückständig, sagt seine Mutter. Provinz, sagt sie. Meistens weiß er das. Morgens, auf dem Weg zur Schule, wenn er mit den anderen Pensionären von Pastor Leonhard die Puppenbrücke überquert und die Altstadtinsel vor ihnen liegt, weiß er es. Links der Bahnhof, dessen Wartehalle mindestens fünfmal in die des Lehrter Bahnhofs in Berlin passt. Wenn man sein einziges Gleis überquert und hineinblickt, sieht er aus wie ein Tunnel mit Bahnsteig. Rechts das Holzlager und der kleine Kran, der mehr mit dem Spielzeugmodell gemeinsam hat, das Georg vor Jahren zu Weihnachten aus Lagen Papier mit aufgedruckten Tannenzweigen gewickelt hat, als mit denen, die turmgleich am Berliner Humboldthafen aufragen.
Überhaupt Türme. Die beiden Spitzen des Holstentors, auf das die Brücke zuläuft, sind nicht auf einer Höhe, sondern schief abgesackt, und trotz der dichten Schornsteinreihen dahinter und ihres emsig aufsteigenden Rauchs, trotz der beiderseits des Tors aufragenden Kirchen, St. Petri, St. Jakobi, St. Marien, er kann sie nicht auseinanderhalten, trotz der bulligen Reihe Speicherhäuser an der Untertrave, Wal, Eiche, Elefant, Namen, die er sich nicht einmal merken will – morgens, auf der Puppenbrücke, die wegen der blöden Statuen rechts und links so heißt, morgens von der Puppenbrücke aus gesehen, sieht die Stadt mickrig aus. Provinz. Aber sobald auf der Straßenseite gegenüber der Anstalt die beiden Ladenschilder erkennbar werden – auf einem steht Südfrüchte, auf dem anderen Zigarren –, schwindet jede Gewissheit. Und spätestens, wenn er durch die schmiedeeiserne Pforte den Vorderhof betritt, ist die Anstalt alles, und die Welt hat aufgehört zu existieren.
2 Keine fünfhundert Meter von der Primanertoilette der Anstalt entfernt trocknet Isenhagen im Pausenraum der Ratsdiener seinen Zweispitz. Seine Katze habe erbrochen, hat er beim Eintreten seine Verspätung gerechtfertigt. Ratsdiener Böger hat verständnisvoll genickt, Isenhagens Katze ist öfter krank. Böger drückt bei Isenhagen meist ein Auge zu, denn Isenhagen ist der einzige Freiwillige für die abendliche Müllrunde, bei der er nach Dienstschluss den Inhalt der Papierkörbe im großen Ofen im Keller verbrennt.
Nicht dass es einen Unterschied macht, ob Isenhagen pünktlich im Rathaus ist. Seine heutige Dienstpflicht besteht überwiegend in der Beschaffung eines 1,75 x 1,75 Meter großen, eher tannen- als oliv-, aber auf gar keinen Fall schlammgrünen Stückes Samt.
«Kamille. Ins Futter mischen», rät Böger, ehe er den Pausenraum verlässt. Und Isenhagen nickt und antwortet nicht, denn Isenhagen hat keine Katze. Für Isenhagens Zuspätkommen gibt es gleich zwei Gründe: Frau Suhls Augen und Frau Helms Pflanze, aber dazu später.
Ratsdiener Johann Gotthard Isenhagen gehört zu den Institutionen einer Stadt, die allen bekannt sind, die aber niemand kennt. Führte man im kleinsten Staat des Deutschen Reiches eine Umfrage durch, so käme Folgendes heraus: Nahezu hundert Prozent der Befragten ist Isenhagen ein Begriff. Penibel und korrekt, tragen sie in das Feld ein, in dem sie ihn mit zwei Adjektiven charakterisieren sollen. Bittet man um eine kurze Beschreibung seines Äußeren, antworten über neunzig Prozent: schwarzer Zweispitz, roter Mantel, gelbe Weste. Auf den Einwand hin, das sei die Ratsdieneruniform, entscheiden sich sämtliche Befragte für: Weiß nicht. Die Hälfte sagt: jung, der Rest, seine Pensionierung stehe bevor.
Obwohl alle angeben, Isenhagen bereits ohne den Zweispitz gesehen zu haben – er nimmt ihn jedes Mal ab und senkt das Haupt, wenn die Senatoren in Zweierreihen an ihm vorbei in den Audienzsaal gehen –, herrscht Uneinigkeit darüber, ob Isenhagen kahlköpfig ist oder nicht. Selbst Fräulein Neesen, das er jeden zweiten Freitag im Etablissement der Witwe Knoop in der Weberstraße besucht, könnte nur beitragen, dass er erst ein bisschen Französisch und dann wie die Hunde bevorzugt, wie die meisten ihrer Kunden. Haare auf dem Kopf? Achselzucken. Schlank sei er, sauber, ohne Fussel im Bauchnabel.
Friseurmeister Werner aus der Hartengrube könnte Haarfarbe (dunkelblond) und Schnitt (kurz) korrekt benennen. Außerdem: Seitenscheitel links, keine Koteletten, kein Bart, zum Abschluss ein paar Fingerspitzen Makassar-Öl. Er weiß aber nicht, dass es sich bei dem Kunden, der alle sechs Wochen Samstagfrüh, unmittelbar nachdem er die Ladentür aufgesperrt hat, mit einem Kopfnicken eintritt und sich stumm in den Stuhl setzt, um Isenhagen handelt. Für Meister Werner heißt Isenhagen nur: kein warmer Kaffee, den er in einem Emaillebecher behutsam aus seiner Wohnung hinüberträgt, um ihn in der für gewöhnlich ruhigen ersten halben Stunde des Arbeitstages zu trinken.
Isenhagen heißt Isenhagen, wie seine Mutter und Großmutter, der Rest ist etwas diffus. Der letzte Herr Isenhagen, an den man sich im kleinsten Staat erinnert, war Anfang des Jahrhunderts zur Zeit der französischen Besatzung als Administrateur des Départements des Bouches de l’Elbe in die Stadt gekommen und bald darauf verstorben.
Dennoch: Niemand hätte bei der jährlichen Sedanfeier, wenn Isenhagen die Flagge des kleinsten Staats und Ratsdiener Böger die des Deutschen Reiches trägt, die stillen Tränen in seinen Augenwinkeln für etwas anderes als Ergriffenheit ob des Sieges über Frankreich gehalten. Und niemand ahnt: Ratsdiener Johann Gotthard Isenhagen ist ein exzessiver Mensch.
Den größten Exzess betreibt er beim Verbergen seiner kleineren Exzesse vor den Augen der Welt. Die in diesem Fall identisch sind mit den rotgeäderten, vor siebenunddreißig Jahren einmal mit Kornblumen verglichenen Augen von Frau Suhl, seiner Aufwärterin.
Im Winter stellt Isenhagen jeden Montag-, Mittwoch- und Freitagmorgen erst Kohlenschippe und Ascheimer aus der Stube in den Windfang, dann die aus der schmalen Kammer am Ende des Flurs, die seiner Mutter früher als Schlafzimmer gedient hat. Nachdem er sich vergewissert hat, dass die schmutzige Wäsche im Korb so arrangiert ist, dass die heikleren Flecken erst beim Sortieren im Halbdunkel des Suhl’schen Kellers zum Vorschein kommen, setzt er den Zweispitz auf und nimmt den roten Dienstmantel vom Garderobenbügel. Er dreht erst den Schlüssel im Schloss der Flügeltür und lässt ihn in die rechte Manteltasche gleiten, dann den im Schloss der schmalen Tür am Ende des Flurs, der in die linke Manteltasche kommt. Ehe er die restliche Wohnung der eine halbe Stunde nach ihm eintreffenden Frau Suhl preisgibt, drückt er zur Sicherheit noch einmal beide Klinken hinab und rüttelt, erst dann zieht er die Haustür hinter sich zu.
Mit absoluter Bestimmtheit könnte Frau Suhl nur sagen, was sich nicht in der Kammer am Ende des Flurs befindet: eine Eichenfurniergarnitur, bestehend aus einem schmalen Bett, eintürigen Schrank und zierlichen Nachttisch. Diese hat Isenhagen ihr nämlich vor acht Jahren, wenige Wochen nach dem Ableben der alten Dame, Gott habe sie selig, geschenkt. An einem Sonntag hatte der alte Suhl damals die Möbel mit dem Handwagen abgeholt. Am folgenden Montagmorgen waren die beiden Türen erstmals verschlossen. Am Mittwoch nicht anders.
Sie sei sich keiner Schuld bewusst, sagte Frau Suhl, und lasse sich solche Unterstellungen auch nicht gefallen. Weshalb sie freitags schließlich eine halbe Stunde früher hinging.
Sie traf Isenhagen in gelber Weste, noch ohne Zweispitz, Mantel, Stiefel an. Seltsam sah er aus, als wäre er nur halb da, während er auf Strümpfen einen großen Schritt aus dem Wohnzimmer in den Windfang machte, die Tür dabei hinter sich zuzog.
«Gibt es was auszusetzen?»
«Nein?» Isenhagen klang erstaunt. «Vielleicht etwas weniger Stärke an die Hemdkragen?»
Wieso die Türen dann abgeschlossen seien?
«Zu meinem Plehsier», hatte Isenhagen nach einer Pause geantwortet.
Zumindest lautete so das Wort, das Frau Suhl zu ihrem Alten nach Hause trug, nachdem Isenhagen ihr versichert hatte, er werde ihr das Gleiche zahlen, auch wenn zwei Räume weniger zu reinigen seien.
Als sie das Wort am darauffolgenden Montag gegenüber Frau Helms auf der Treppe zu Isenhagens Wohnung wieder hervorholte, tat sie es hinter vorgehaltener Hand. Was Unanständiges, hatte die Übersetzung von Herrn Suhl gelautet.
Damit war für die Zukunft alles aufs Beste arrangiert, denn Frau Suhls Plehsiere umfassen:
1. Sich nachts, wenn der alte Suhl neben ihr schläft, daran erinnern, was die Finger von Otto, dem Rezeptionisten, in ihrer Unterhose gemacht haben, als sie noch in der Wäscherei des Hotels Kaiser am Braunschweiger Bahnhof angestellt war und Kornblumenaugen hatte.
2. Auf Pferde wetten.
3. Mutmaßen, was sich hinter den verschlossenen Türen in Isenhagens Wohnung befindet.
4. Rote Grütze.
Selbstverständlich stand «ein Mädchen!» am Anfang aller Suhl’schen Theorien über die verschlossenen Türen in Isenhagens Wohnung, begleitet von «stille Wasser …» und so weiter.
Als es nach einer Woche an Schwellen, Türen, Rahmen nichts mehr zu wischen gab, nahm Frau Suhl den Lappen nicht einmal mehr mit, wenn sie sich vor dem Wohnzimmer auf den Boden kniete, um abwechselnd das rechte und linke Ohr ans Holz zu pressen, unentschieden, welches besser hörte. Und obwohl sie den Atem anhielt, hörten beide, wie immer: nichts. Kein Kichern, kein Lachen, keine Gewichtsverlagerung – das Sofa aus Rosshaar und die Sesselbeine knirschen, sobald man sich vorbeugt –, kein Dielenknarren, kein Barfuß-Tapsen, kein Auf-Socken-Schleichen, kein Tack eines auf dem Tisch abgestellten Glases, Umblättern einer Buchseite, kein Husten, Niesen, Nase-Hochziehen.
«Nicht einmal ein Atemzug», sagte Frau Suhl. Sagte es laut vor sich hin, während sie sich am Türrahmen hochzog, und erschrak. Was sollte es sonst sein? Kein Mädchen sitzt wochenlang, ohne sich zu rühren, im Wohnzimmer.
«Ein totes Mädchen», flüsterte sie erst, als sie Isenhagens Tür bereits hinter sich zugeschlagen hatte und auf der Treppe den Mantel überwarf. Ihr Hut, fiel ihr ein, lag noch auf dem Küchentisch, und doch rannte sie weiter.
«Wie lange? Eine Woche? Das täte doch stinken», widersprach der alte Suhl, als er abends vom Hafen kam. Und obwohl er wohl recht hatte, schlief sie in der Nacht schlecht, und Montagmorgen, ehe sie zur Arbeit aufbrach, nahm sie das Tranchiermesser aus der Schublade, wickelte die Klinge in ihr bestes Geschirrtuch und steckte es in die Tasche. Das Gewicht zog die Mantelaufschläge auseinander und schlug bei jedem Schritt gegen ihre Hüfte.
Egal, wie viel Luft sie einsog, im Hausflur, im Windfang, vor dem Wohnzimmer, mit gespreizten Nüstern und langsam austrocknenden Schleimhäuten, am Schlüsselloch und schließlich auf den Knien vor der Türritze, egal, wie viel Luft sie einsog, es roch nach Staub und schalem Kohlenrauch, nach Isenhagen, nicht unangenehm, dazu ein kleiner Rest Lavendel, von der alten Dame, Gott habe sie selig.
«Und wenn er die Leiche nachts weggeschafft hat?»
«Warum sollte er dann weiter abschließen?», wandte Frau Helms ein, die ihr auf dem Weg zum Markt im Treppenhaus begegnet war. Das Einkaufsgeld hatte Isenhagen, wie immer, auf den Küchentisch gelegt, zwischen ihren Hut und den Korb mit der schmutzigen Wäsche. Das Tranchiermesser in ihrer Manteltasche schlug, wenn sie sich vorbeugte, mit metallenem Klonck gegen die Apfelkiste, das Heringsfass, den Karren, und als sie bezahlen wollte, entdeckte sie, dass die Spitze sich durch den Stoff gebohrt hatte.
Vor Isenhagens Haustür wartete Frau Schröder mit der Nachricht, sie habe kein Gerumpel gehört, des Nachts auf der Treppe, zumindest nichts, was nach einer fortgeschafften Leiche klang.
Den gleichen Einwänden begegnete die «Ein Jüngling!»-Hypothese, die Elsbeth Suhl anschließend beschäftigte. Außerdem: «Kannste ja nichts für, wenn du so geboren bist», wie Frau Helms leise sagte. Vielleicht dachte sie es auch nur.
Als Nächstes waren mögliche Haustiere und Gründe, sie geheim zu halten, an der Reihe. Ein Papagei? Unter einem Tuch? Aus Sorge, exzentrisch zu erscheinen? Meerschweinchen? Einige Tage hielt sich die Annahme «Eine Schlange!» und Frau Suhl sich nur auf Zehenspitzen in der Wohnung auf.
Solange sie ihn künstlerischer Ambitionen verdächtigte, forschte sie nach, ob jemand Isenhagen in der Nähe der Lüttgendorff’schen Mal-Akademie am Pferdemarkt getroffen habe. Reihum war er ein Fälscher, Schmuggler, Hehler und wie immer die hießen, die nackte Frauen fotografieren. Je nachdem, über welche Delikte Die Blätter, wie die einzige Tageszeitung der Stadt genannt wird, gerade berichteten. (Die Fischfrau spart mittlerweile die Seite mit den Polizeimeldungen für die Suhl’schen Einkäufe auf.)
Glücksspiel, Karten, Roulette – bräuchte es dafür nicht Gäste?, gab Frau Schröder zu bedenken.
Mitte Januar 1890 hat Elsbeth Suhl sich auf das Terrain der Religion vorgearbeitet. Isenhagen sei konvertiert, lautet die aktuelle These, vor Trauer über den Tod der Mutter, Gott habe sie selig.
Die Frage ist nur, welcher Gott. Katholisch, muslimisch, jüdisch oder das mit den Kühen? Frau Suhl schwankt, aber an diesem Montag, gegen neun Uhr, während sie die Treppe zu Isenhagens Wohnung hinaufgeht, ist sie fest überzeugt, hinter der Wohnzimmertür seien ein metergroßes Papstportrait in Öl, Rosenkränze, Oblaten und was immer man noch für Papismus benötigt, verborgen.
In Wahrheit ist natürlich alles ganz anders. Die Liste mit Ratsdiener Isenhagens Plehsieren sieht nämlich folgendermaßen aus:
1. Erst ein wenig Französisch und dann wie die Hunde.
2. Napoleon und zwar ausschließlich der III.
3. Wachsbilder.
3a. Sämtliche Kombinationen aus 2. und 3.
4. Große und kleine Gemeinheiten sammeln.
5. Frau Schröder von über ihm und Frau Helms von unter ihm zuhören, wenn sie auf der Treppe Frau Suhls Theorien über den Inhalt seiner verschlossenen Zimmer diskutieren.
6. (und das ist neu) Frau Helms’ Pflanze.
Das größere, das Wohnzimmer, ist den Plehsieren Nummer zwei und drei vorbehalten. Das andere Zimmer aber, die Kammer, gehört ganz Plehsier Nummer vier: Isenhagen nutzt sie als Lager für alles, was er heimlich im Rathaus mitgehen lässt. Sie ist sein Geheimes Staatsarchiv.
Das Wohnzimmer schließt er nur ab, um Frau Suhl abzulenken. Und ein wenig, weil er angesichts des resolut über sie fahrenden Staublappens um die erhabenen Details seiner Wachsbilder fürchtet.
Nach wie vor zu feucht, um wieder in den Regen hinauszugehen, befindet Isenhagen, obwohl er den Zweispitz bereits eine Weile trocken reibt. Er könnte ohne Hut aufbrechen, um den Samt zu kaufen, das einzige in Frage kommende Geschäft befindet sich keine hundert Meter entfernt in der Breiten Straße. J.H. Ehlers & Söhne en détail und en gros seit 1796. Zurzeit ist glücklicherweise nur ein Ratsmitglied im Tuchhandel. Anschaffungen mit Staatsmitteln sind eine heikle Angelegenheit im kleinsten Staat des Deutschen Reiches, en détail und en gros.
Zu den festen Terminen in Isenhagens Dienstjahr gehört – neben Sedanfeier und Kaisergeburtstag – mindestens eine Ratssitzung mit dem Tagesordnungspunkt: Abortverhältnisse und Abfuhrwesen. Trotz der unzähligen Privet-Annoncen der Porzellanhersteller in den Bättern wird der Inhalt der Abtrittkästen und Nachttöpfe im kleinsten Staat noch immer mit Karren von den Gärtnereien abgeholt, die damit düngen und straßenzugweise Pacht zahlen. Allenfalls zwei Dutzend Häuser sind derzeit – dank der jährlich erhobenen Anschlussgebühr – mit den Leitungen des Sielsystems verbunden.
4762 Beschwerdebriefe hat die Wasserclosett-Fraktion im Vorjahr zu Protokoll gegeben. Detaillierte Beschreibungen der überschwappenden Eimer und Spritzer auf Teppichen und Möbeln, Röcken und Vorhängen. Witterungsbedingt – der Regen verflüssigt den Sammelbehälterinhalt, weswegen die Karren stinkende Fährten hinterlassen – findet die Sitzung dieses Jahr nicht nur außergewöhnlich früh statt, Senator Steinbrück hat außerdem die Vorführung zweier Anschauungsobjekte beantragt. Zweier Einmachgläser mit Wakenitzwasser.
Ob nicht eines reiche, hatte Böger eingewendet. Ein Zehn-Liter-Glas könne Isenhagen auf einem Tablett in die Sitzung tragen, bei zweien befürchtet Böger Unfälle.
Die Proben würden an verschiedenen Stellen entnommen. Einmal in der Nähe der Siele, einmal außerhalb der Stadt.
Wo sei da der Unterschied?
Das sei es ja, es gebe noch keinen, hatte Senator Steinbrück erwidert und war gegangen.
Böger und Isenhagen haben die Präsentation bereits ausgiebig erörtert, sich für einen Aktenwagen entschieden, den Isenhagen auf ein Zeichen hin in den Audienzsaal rollen würde. Der Gewichtigkeit der Umstände entsprechend, solle der Wagen mit einem Stück Samt abgehängt werden.
Wie ziemlich alles hier hat der Beruf des Ratsdieners bessere Zeiten gesehen. An Stelle verwegener Reiter, erfahrener Henker, versiert im Umgang mit Gesandten der Englischen Krone, erwartet das Anforderungsprofil von Bewerbern derzeit: Geschicklichkeit beim Schwenken von Reichsflaggen, Ausdauer bei Botengängen und Beherrschen eines für Marschkapellen geeigneten Musikinstruments. Letzteres glücklicherweise erst nach Isenhagens Dienstantritt. Alles, von Briefe für die Senatoren befördern bis ihnen die Hosen hochziehen, wäre Isenhagens Antwort, würde ihn jemand nach seinen Pflichten fragen. Aber glücklicherweise fragt niemand.
Statt sich endlich auf den Weg zu machen, setzt Isenhagen sich an den Pausentisch und schlägt den ersten Band der Flora Prussica auf, den er sich gestern im Geschäftszimmer des Stadtgärtners geliehen hat, und beginnt zu blättern. Abbildung sämtlicher bis jetzt aufgefundener Pflanzen Preußens, verspricht der Untertitel. Der Band ist von 1859.
Skeptisch betrachtet Isenhagen die Bildtafeln. Was er sucht? Plehsier Nummer sechs: Frau Helms Pflanze. Die andere Ursache seiner morgendlichen Verspätung. Eine Entwicklung, die er selbst als Dummheit abtäte, würde jemand nach ihr fragen, doch glücklicherweise fragt niemand.
Isenhagens Küchenfenster geht nach hinten auf die Höfe hinaus. Von seiner Mutter hat er die Gewohnheit übernommen, morgens Kaffee mit warmer Milch zu trinken, sehr französisch für den kleinsten Staat des Deutschen Reiches. Meist sitzt er auf einem der Küchenstühle am Fenster, den Frau Suhl dreimal die Woche unter den Tisch zurückschiebt, und betrachtet den Rauch, der weiß aus den Schornsteinen der Katen gegenüber steigt. Die unregelmäßigen hellgrauen Flechten auf ihren Dächern sehen aus wie Möwenschisse, auf der Wetterseite sind die Schindeln moosgefüllt. Oft beobachtet er die Katze, die dort, wo die Hofmauern ein T bilden, lauert. Ein, zwei Jahre lang ist es immer dieselbe, derzeit ist sie weiß mit schwarzen Flecken auf der Schwanzwurzel und zwischen den Ohren. Sie jagt über die Katendächer davon, sobald er das Fenster öffnet, der Riegel ist eingerostet.
Wenn Isenhagen beide Hände aufs Fensterbrett stützt und die Hauswand hinunterblickt, kann er durch die blankgeputzten Sprossenscheiben im Parterre ungefähr einen Quadratmeter der Helm’schen Wohnung einsehen. Was er seit einigen Wochen mit wachsender Bewunderung tut.
Zuerst war es nur ein brauner, rindiger Stumpf, der dort an Stelle des verkümmerten Farns im hölzernen Blumenständer stand. Als Isenhagen bald darauf an der Oberseite des Stumpfes etwas Hellgrünes entdeckte, hielt er es zunächst für Lichtreflexionen der Scheibe. Doch in den folgenden Wochen wuchs sich das Hellgrüne zu fedrig beblätterten Stängeln aus, die – Karottenkraut nicht unähnlich – seltsam rührend herabhängen. Wenn es windig ist, wiegen sie sich sanft im Luftzug zwischen Sprossen und Scheiben.
Isenhagen hat sich angewöhnt, regelmäßig nach der Pflanze zu sehen. Seit er letzten Mittwoch fünf violett gefärbte Punkte entdeckt hat, Knospen, vermutet er, beugt er sich auch abends aus dem Fenster und am Wochenende, wenn er keinen Dienst hat, noch öfter. Denn am Wochenende rücken Frau Helms Hände, mehr kann Isenhagen nicht erkennen, den Blumenständer den wandernden Sonnenflecken hinterher. Gerötete Finger, schmale Handgelenke, ein, zwei Zentimeter helle Haut, der Manschettenstoff ihrer Ärmel: Blau in allen Schattierungen. Und wollte ihm jemand vorwerfen, er stelle seiner Nachbarin nach, Isenhagen würde es weit von sich weisen.
Das Erdgeschossfenster erinnert ihn an die gläsernen Guckkästen, die zum Kongress der Gesellschaft Deutscher Naturforscher vor einigen Jahren in einem der Gewölbe des Rathauses aufgestellt worden sind. In Dämmerlicht und Wärme schwammen Echsen und Molche in künstlichen Tümpeln, versteckten sich eilig zwischen den Grünpflanzen, sobald Isenhagen an die Scheibe tippte. Er hatte damals gern seine Pausen bei ihnen verbracht.
Bereits nach wenigen Seiten in der Flora Prussica ist Isenhagen unsicher, ob er die fedrig grünen Stängel identifizieren könnte. Keine der abgebildeten Pflanzen kommt ihm bekannt vor. Er ist bei Tafel 10 (Gladiolus palustris) angelangt, als einer der Kanzleischreiber gruß-, aber nicht eben geräuschlos einen Stapel Hauspost neben ihm auf den Tisch legt. Bis Tafel 46 (Myosotis versicolor) hält Isenhagen durch, ehe er das Buch zuklappt.
Als er sich die Post unter den Arm klemmen will, gleitet ein Blatt zu Boden. Und schon während er sich bückt, weiß Isenhagen, worum es sich handelt. Wieder das Heine-Gedicht. Auch wenn es in keinem der neun Bände der grünen Werkausgabe im Bücherregal in Isenhagens Wohnzimmer zu finden ist. Er hat nachgesehen, in jedem einzelnen.
ERLAUSCHTES
O kluger Jekef, wieviel hat dir
Der lange Christ gekostet,
Der Gatte deines Töchterleins?
Sie war schon ein bisschen verrostet.
Du zahltest sechzig tausend Mark?
Du zahltest vielleicht auch siebzig?
Ist nicht zu viel für Christenfleisch –
Dein Töchterlein war so schnippsig.
Vor gut zwanzig Jahren brachte einer der hohen Herren es von einem Hamburgbesuch mit und leistete damit Hervorragendes für die literarische Bildung des Senats, verdoppelte sie gewissermaßen, denn alle lernten zusätzlich zu den zwei, drei Keitel-Zitaten, die sie regelmäßig in ihre Reden einstreuen, ein paar Zeilen Heine auswendig. Seitdem kann man die Senatoren einander «O kluger Jekef» zuzischen hören, meist im Vorbeigehen, meist nur zwischen den Zähnen, aber immer, wenn sie gerade eine Niederlage erlitten haben und einem der Lindhorsts die Schuld dafür geben.
Isenhagen weiß nicht, ob das Blatt aus einer Korrespondenzmappe gefallen ist oder zwischen den Kanalentwürfen lag. Das ist auch gleichgültig, denn Isenhagen legt es nicht zurück, sondern faltet es sorgfältig zweimal und schiebt es in die Innentasche seiner Ratsdieneruniformjacke.
In der Kammer hat er bereits eine ganze Sammlung.
3 Ida hält inne. Die Schlafzimmer sind gemacht, Öfen ausgefegt und angefeuert, Toiletteneimer abgeholt. Die Gnädige ruht nach dem Frühstück, um halb zwölf kommt der Arzt, um nach dem Bauch zu sehen. Nur: Seit die Jungen zur Schule aufgebrochen sind, knirscht es auf der Galerie bei jedem Schritt. Und wenn Ida die Galerie fegt, muss sie die Diele unten auch fegen, denn egal wie vorsichtig sie mit dem Besen vom Rand zur Mitte fährt, irgendwas schafft es immer unter der Brüstung durch und rieselt hinab. Ida kann die Zehn-Uhr-Glocken von St. Jakobi bereits in den Gliedern fühlen. In wenigen Minuten werden sie das Kristall im Buffet des Esszimmers zum Schwingen bringen. Noch ist es still bis auf den Regen, den der Wind in Böen gegen die Galeriefenster drückt. Die Wolken so gleichmäßig grau, als hätte jemand einen ausgewrungenen Feudel zum Trocknen über die Dächer gehängt.
Der Census des Jahres 1870 verortet Stuermann, Ida, noch in der Dankwartsgrube 19, 1. Obergeschoss. Anzahl der in massiver Bauweise errichteten Zimmer: 5. Davon beheizt: 4. Mit Fenster zur Straßenfront: 2. Mit Fenster zur Gartenseite: 2. Ohne Fenster: 1.
Haushaltsmitglieder: 1. Stuermann, Karl Heinrich, evangelisch, Kaufmann, Kontor: Wakenitzmauer. 2. Stuermann, Johanna Henriette Luise, evangelisch, Ehefrau. 3. Stuermann, Ida, evangelisch, Tochter.
Weitere im Haushalt lebende Personen: 1. Weber, Minna – Dienstmädchen. 2. Struck, Anna – Dienstmädchen.
Der Census des Jahres 1880 listet Stuermann, Johanna Henriette Luise, Kaufmannswitwe, und Stuermann, Ida, Tochter, unter der Adresse: Kleiner Schrangen 4. Anzahl der in massiver Bauweise errichteten Zimmer: 3. Davon beheizbar: 2. Fenster zur Straßenfront: 3. Fenster zur Gartenfront: –. Weitere im Haushalt lebende Personen: Struck, Anna – Dienstmädchen
Dazwischen liegt eine schlecht vertäute Ladung Eisenstäbe, die beim Verladen ins Rutschen und erst zwei Zentimeter hinter dem Os frontalis des vorbeieilenden Kaufmanns zum Halt gekommen ist. So erzählte es zumindest seine Witwe. Gefunden wurde er jedenfalls morgens in der unteren Alfstraße beim Hafen mit eingedrücktem Schädel.
1882 reduziert sich die Anzahl der weiteren im Haushalt lebenden Personen auf null, weil die alte Anna ins Altenasyl zieht. Und ein weiteres Jahr später ist der Stuermann’sche Haushalt aufgelöst und Stuermann, Johanna Henriette Luise, Kaufmannswitwe, im Beerdigungsregister unter Burgtorfriedhof, III. Gang, Parcelle 4c, verzeichnet.
Im Januar des Jahres 1890 steht Stuermann, Ida – Dienstmädchen – im ersten Stock des Haushalts Königstraße Nr. 9, Dr. Lindhorst – 23 Zimmer, 18 beheizbar – und versucht zu akzeptieren, dass sie Besen und Kehrschaufel von unten holen muss.
«Das Erste, was ich morgens vor mir sehe, noch ehe ich wach bin, ist der Steingutkrug mit den blauen Blumen», hatte die alte Anna erzählt. Der Krug stand im Güstrower Land, wo die alte Anna aufgewachsen war, über Nacht auf der Fensterbank, damit die Milch darin nicht sauer wurde; in der Früh wurde sie aufgekocht. Das Erste, was wiederum Ida morgens vor sich sieht, noch ehe sie richtig wach ist, ist die alte Anna. Am Abend, bevor sie ins Altenasyl gezogen ist, haben sie zu zweit in der Küche gesessen. «Such dir jetzt was. Noch bist du nicht zu runter für Gesellschafterin oder Hausdame», hatte ihr die alte Anna damals gesagt.
Endlich setzen Idas Füße sich in Bewegung, knirschend in Richtung Treppe. Sie gibt acht auf den Stufen, sonst lässt das Gepolter die Tür des Comptoirs aufschlagen, mit Hupmann, dem Bürovorsteher, im Rahmen, der «Ruhe!» brüllt. Unten, in den straßenseitigen Räumen ist die Kanzlei untergebracht.
Als Ida zu fegen beginnt, klingelt das Glöckchen über der Windfangtür. Zu früh für die Post, sie blickt über die Galeriebrüstung, vermutlich Helms oder ein anderer Diener. «Die Gnädige Frau empfängt nicht», muss sie nur selten sagen. Die meisten schnippen die Karte schweigend in die auf einer gedrechselten Säule neben der Treppe bereitstehende Schale.
Doch es ist der Älteste, der die Stufen heraufkommt, schon aus der Schule zurück. «Wieder Kopf?», fragt Ida.
«Hals.» Erasmus deutet auf seine Kehle. Seine Wangen sind gerötet, er sieht nicht nach Kopfschmerzen aus. Am Fuß des Treppenaufgangs zum zweiten Stock wendet er sich um. «Tee wäre hilfreich.»
Ida nickt.
Den ersten Anfall hatte er, kurz nachdem sie die Stelle bei Lindhorsts angetreten hat. Sonntagnachmittags stand plötzlich ein Junge in der Diele: Erasmus liege in der Hundestraße im Sterben. Die Familie war aus, die Köchin befahl ihr mitzukommen. Erasmus saß mit dem Rücken an eine Hauswand gelehnt, die langen Storchenbeine quer über den Gehweg gestreckt. Nicht älter als zehn war er, noch in kurzen Hosen, den Kopf mit den dunklen Locken aufgestützt, die Hände über den Ohren. Neben ihm auf dem staubigen Pflaster ein runder nasser Fleck. Erbrochenes, stellte Ida am säuerlichen Geruch fest, während sie sich hinkniete.
Er habe einen hell leuchtenden Kranz mit spitzen Zacken gesehen, sagte er, und die Köchin bekreuzigte sich. Und dann erbrach er sich auf Idas Schuhen.
Die Anfälle dauern meist zwei Tage, Dr. Reiter verschreibt Migränepulver, das nicht wirkt, und frisch geschnittene Zitronenscheiben auf Stirn und Schläfen, die das Betttuch einsauen. Wenn nichts helfe, sei auch nichts, sagt der Gnädige.
Am Montagmorgen ist die Köchin, wie alle Köchinnen, auf dem Markt, Ida wird den Tee selber zubereiten müssen. Würde gerne Besen und Schaufel auf der Galerie stehen lassen, um nicht, wenn sie die Kanne hochgebracht hat, erneut hinunterzumüssen. Aber dann wird sich sicher in der Zwischenzeit die Schlafzimmertür der Gnädigen öffnen, und es wird Geschrei geben, weil Ida wieder alles herumliegen lässt.
Der Regen wird lauter. Nicht dass er Ida stören würde. Die letzten Wochen waren die längste Zeitspanne ohne Fensterputzen, seit sie in Stellung ist. Kein Frost, nicht einmal nachts, ihr Atem nicht zu sehen, wenn sie sich morgens im Bett aufsetzt. Keine dünne Eisschicht auf dem Wasser im Waschkrug, die sie mit sich rötenden Fingerknöcheln eindrückt. Letzten Winter hat die Hälfte der Tage so angefangen. Die größte der Dienstbotenkammern unterm Dach, durch die der Schornstein läuft, gehört der Köchin. Wenigstens ist ihres kein fensterloses Holzkabuff, in eine Ecke der großen Kaufmannsdiele eingebaut, wie in den meisten alten Häusern.
Erasmus liegt im Bett und liest, als Ida mit dem Tee klopft, deutet stumm auf den Nachttisch. Sechs Söhne sind es insgesamt und dann noch Alma. Der Zweitälteste, Cord, ist sechzehn, rotblond, wie der Gnädige. «Verrat mich nicht, liebreizende Ida», flüstert er, wenn sie ihn nachts bei ihrer Ofenrunde ertappt, auf dem Weg, sich rauszuschleichen. Und dann lächelt er, und wenn Cord lächelt, leuchtet er. Sodass man zu spät merkt, dass man gerade zwar «So ein Unsinn!» gesagt hat, aber dabei gekichert hat wie eine dumme Gans. Frieder, der Nächstälteste, wird von allen Dicker gerufen; er macht ihr am wenigsten Arbeit, meist sitzt er herum und malt. Am unordentlichsten ist Robert, der alles zerbricht, verliert, verstreut, verdreckt, außer seine Geige, auf der er stundenlang dasselbe Stück übt. Braunhaarig, elf Jahre alt, seit dem Eingriff letztes Jahr steht eines seiner Ohren weniger ab als das andere. «Das gute Ohr», wie die Gnädige es nennt. Beim Eindecken muss Ida achtgeben, ihn so zu platzieren, dass es der Stirnseite des Tisches zugewandt ist. Werner, der fünfte, ist neun, blond, mit Brille und petzt tote Insekten im Lampenschirm, Staubflusen, Kalkringe in seiner Karaffe. Und dann noch Jost, der Nachzügler. Nach Almas Geburt war die Gnädige länger im Sanatorium gewesen.
Und nun kommt noch ein Nachzügler. Die Leute zerreißen sich das Maul darüber, sagt die Köchin.
Auf dem Weg in die Küche ist noch alles in Ordnung. Doch als Ida mit Besen und Schaufel die Treppe wieder heraufkommt, hört sie bereits die Stimme der Gnädigen. Und wie sie vor der Schlafzimmertür angelangt ist, öffnet sich diese.
Ida knickst. Meist ist mit der Gnädigen gut auskommen, denn meist kümmert sie sich nicht um den Haushalt. Aber wenn sie sich kümmert, wünschen alle, sie täte es nicht. Marie Lindhorst ist nicht mehr in Nachthemd und Morgenmantel, sondern trägt ein hellblaues Hauskleid, und einen Moment sieht es so aus, als würde sie einfach an Ida vorbeigehen und im roten Wohnzimmer verschwinden. Doch dann bleibt sie stehen, eine Hand auf den vorgewölbten Bauch gelegt.
«Das muss gebohnert werden.» Sie deutet auf die Dielen. «Wenigstens übergebürstet. Im Gartenzimmer auch. Und im Saal. Das Parkett ist stumpf, wie in einer Bauernstube.» Ihr Gesicht so schmal und eingefallen, dass sie eher krank als schwanger aussieht.
Statt zu nicken, zu knicksen und stumm weiterzufegen – meist vergisst die Gnädige ihre Anweisungen wieder –, hört Ida sich «Jetzt?» fragen und etwas in ihrer Stimme, das nach Entrüstung klingt.
«Selbst-ver-ständ-lich!» Jede Silbe einzeln.
4 Friedrich Lindhorst steht am Fenster des Gartenzimmers und lauscht. Hinter ihm, im Comptoire, Arbeitsstille. Vor ihm, im Garten, Regenstille. Die Vögel verschwunden, nicht einmal ein Rabe, der irgendwo eine Walnuss hervorgräbt. Nur die nassgrüne Rasenfläche und das gleichmäßige Tappen der Tropfen. So vertraut, dass es beinahe tonlos ist, herausgefiltert aus seiner Wahrnehmung.
Über ihm, im ersten Stock: Bauchstille. Es wird der letzte Bauch sein. Und er ahnt, die Bezeichnung ist falsch, die Stille wird bleiben, auch wenn der Bauch verschwunden ist. Die Jungen und Alma sind in der Schule, der Jüngste mit dem Kindermädchen draußen. In seinem Rücken die beruhigend leere Zimmerflucht des Flügels, zwischen ihm und allem anderen.
Wenn er am Schreibtisch sitzt, schieben sie sich ineinander, werden zu der Sorte Stille, die ihm das Gefühl gibt, alles sei einerlei. Ob er die Anträge für die Toiletteneimer-Sitzung am Mittwoch liest, die vor ihm auf der dunkelgrünen Schreibauflage liegen. Seinen Vortrag vorbereitet. Eine Stille, die ihm das Gefühl gibt, nicht sitzen bleiben zu können. Keinen Augenblick länger, hat er gedacht, und dennoch ist ihm erst einige Sekunden später im Aktenraum bewusst geworden, dass er tatsächlich aufgestanden ist. Seinen Stuhl zurückgeschoben hat und nach nebenan, ins Halbdunkel zwischen den wandhohen Regalen gestürzt ist. Dem Lichtkegel, der durch das kreisrunde Fenster über der Verbindungstür zur Schreibstube fällt, ist er ausgewichen, unsinnigerweise befürchtend, man würde ihn darin sehen.
Als kenne sie das Ziel, hat seine rechte Hand die Klinke zum kleinen Lager hinuntergedrückt. Dort ist er stehen geblieben. Zwischen Putzgerätschaften, kippelnden Stühlen und gesprungenen Lampenschirmen, die Hupmann, der Bürovorsteher, dort aufbewahrt. Hat sich vorgestellt, wie das wäre: zurückzugehen, sich wieder hinzusetzen, vielleicht die Akte zu schließen, den Vortrag beiseitezulegen. Etwas anderes zu machen.
Stattdessen, als Gepolter auf der Treppe ertönt, ist er leise und schnell in die Diele geschlüpft und nach links in den Flügel, weiter durchs Empfangszimmer und in den Saal, am Piano vorbei. Erst im Landschaftszimmer, vor dem Fenster, ist er stehen geblieben. Am entferntesten Punkt zum Schreibtisch. Und würde es draußen nicht regnen, so hätte er die Glastür geöffnet, wäre auf die Veranda hinaus und die Stufen hinab, über den Kiesweg, am Stall vorbei, an der Toilette, durch die Pforte auf den Langen Lohberg hinaus und runter an die Wakenitz, nicht in die Wakenitz, nur an die Wakenitz, und dort wäre es vielleicht gegangen.
Im Rosenbeet staken die gerade abgeschnittenen Äste aus dem aufgehäuften Laub, ihre empfindlichen Narben gut bedeckt. Wenn es nicht bald friert, werden sie austreiben. Er hat die Tür zum Flügel nicht hinter sich zugezogen, fällt ihm auf. Von der Diele aus kann man ihn hier stehen sehen. Montagmorgen um kurz nach halb elf, ohne erkennbaren Grund in den Garten starrend. 43 Jahre alt. Vater von sieben – oder eher sechs drei viertel, ein paar Wochen fehlen noch – Söhnen. Und wenn es doch eine zweite Tochter sein sollte, hätte er mittlerweile nichts einzuwenden. Vor fünf Jahren hat er das Haus gekauft. So groß, dass er es fühlen kann, die meterdicken Mauern, das Volumen des Raumes, den sie umschließen. Die Festigkeit, mit der sie es tun.
Draußen vor dem Fenster die nackten Äste des Walnussbaums im Regen. Genau wie letztes Jahr. Und vorletztes und nächstes Jahr und übernächstes. Im Sommer hoch auf den Riggi. Und irgendwann der Schwarze Bleistift.
Um zwölf haben die Vertreter der Gärtnereien einen Termin. Unvermeidlich werden in den nächsten Stunden außerdem die Abgesandten der Werke für haltbare Speisen, des Metallwalzwerks und der Emballagefabrik bei ihm vorstellig werden. In der Senatssitzung am Mittwoch geht es erneut ums Abwasser. Anschluss sämtlicher Haushalte an die Siele, lautet die Forderung. Unglücklicherweise ist die älteste im kleinsten Staat ansässige Industrie die Produktion von Konserven, deren Konkurrenzfähigkeit vom Einkaufspreis des Gemüses abhängig ist und der wiederum von den Düngerkosten. «Wir verkaufen Scheiße in Form von Erbsen, Bohnen, Spargel und Möhren nach ganz Europa», hat ihm einer der Geschäftsführer vor seiner ersten Scheiße-Sitzung erklärt.
Der Köchin hat Friedrich seitdem das Verwenden von Konserven untersagt. Ihren Einwand, dass frisch gekauftes Gemüse auch nicht anders wachse, hat er überhört. Um die Eimer kümmern sich die Dienstboten, und die Steuererträge gleichen die im Ostseehandel verlustig gegangenen wieder aus.
Vor wenigen Wochen ist er zum zweiten Mal zum Vorsitzenden des Bürgerausschusses bestimmt worden, der für die Bürgerschaft mit dem Senat verhandelt. Beim dritten Mal darf die Wahl abgelehnt werden, steht in der Verfassung. Marie würde das sicherlich begrüßen.
Dabei sind sie eigentlich eine große Liebesgeschichte, bezaubernd, romantisch, bei der heimlich mitgefiebert wurde. Der Kaufmannssohn und die Dichtertochter. Noch heute, fast zwanzig Jahre später, kann er, wenn er sich in die weibliche Hälfte einer Teegesellschaft verirrt, mit einer winzigen Andeutung über die Nacht des Sommerfests im damals noch Bohm’schen Garten, wo sie sich anno 71, nicht sonderlich gut verdeckt von zwei Buchsbaumkugeln, verlobt hatten, das Ticken der Stricknadeln auf den Sofas ringsum zum Einhalten bringen. Der einzige Fall, bei dem in den nachmittäglichen Empfangszimmergesprächen Einvernehmen herrscht, ist, dass Schönheit und Geist der Braut (und die zahlreichen adligen Bewunderer des Brautvaters) ihren Mangel an Vermögen beinahe ausgeglichen haben.
Doch, wie bei allem Schönen, das man lange anblickt: Irgendwann weiß man eher um die Schönheit, als dass man sie noch sieht. (Und die Einladungen der adligen Keitel-Bewunderer zu Jagdausflügen und Nachmittagstees – nicht dass es ihn stört, sagt er sich – galten allein Marie und den Kindern.) Manchmal, wenn Marie an seinem Arm durchs Theaterfoyer geht, wird er von den Blicken überrascht. Die innehalten, bei ihren dunklen Augen verweilen, der feinen kleinen Nase, dem schlanken Hals über dem sich wölbenden Dekolleté.
Die Bohm’schen Buchsbäume sind vor Jahren dem regennassen Rosenbeet gewichen. Es war der Wunsch seines Vaters, dass er das Bohm’sche Haus kaufte. Seine Eltern hatten darin zur Miete gewohnt, nachdem sein Vater den Familiensitz an die städtische Versicherungsanstalt veräußert hatte. Er würde es ja selber erwerben, wenn er sein Vermögen nicht zu gleichen Teilen unter den Kindern aufteilen müsste. Ein Senatorenhaus, nannte er es.
Swisch, swisch, swisch, entfernt und leise. Erst allmählich dringt es ihm ins Bewusstsein, swisch, swisch, swisch, Besenstriche, jemand fegt. Mit einem Mal spürt er die offene Flügeltür in seinem Rücken, als stünde dort Hupmann auf der Suche nach einer Unterschrift oder eines der Dienstmädchen, stumm gaffend. Swisch, swisch. Es kommt von oben, von der Galerie.
Friedrich Lindhorst dreht sich mit einem Ruck um. In der Diele niemand. Dennoch setzt er sich in Bewegung, das regelmäßige Tack-Tack seiner Schuhe auf den Dielen wirkt beruhigend, durch den Saal, am Piano vorbei, auf dessen Notenständer wie immer das Blatt mit Verlassen, verlassen, verlassen liegt. Als kenne Marie es nicht auswendig.
In der Diele zögert er kurz, entscheidet sich dann für den richtigen Weg: durchs Vorzimmer. Unvermittelt verstummt das Fegen oben auf der Galerie, und er meint, Maries Stimme zu hören. Seine Schritte beschleunigen wie von selbst. Er erinnert sich noch, dass die Tage einmal zu kurz waren, nicht genügend Stunden hatten, die sie miteinander verbringen konnten, er bis in alle Ewigkeit mit Marie auf dem Sofa liegen wollte, ein Gläschen Schnaps auf dem Beistelltisch, an dem sie abwechselnd nippten. Die Beine ineinander verflochten, seine Wange an ihrer Stirn, den linken Arm um sie geschlungen, in der Rechten das Buch, aus dem er ihr vorlas. Shakespeare, Goethe, Lessing, Heyse. Wie sie beide heimlich zur Buchhandlung Grautoff gegangen waren, um den anderen mit neuer Lektüre zu überraschen. Und er weiß, dass er dabei still gestaunt hat, dass ein Mensch so glücklich sein kann. Doch allmählich, nicht jäh, kroch Unruhe in ihn, wurde Marie ihm schwer auf der Brust, schlief sein Arm ein. Erst korrigierte sie ihn lachend, wenn er sich verlas, weil er in Gedanken woanders war. Zappelte, wie sie es nannte, weil er aufstehen wollte. Später kamen die Vorwürfe. Auf eine Stunde haben sie sich irgendwann geeinigt. Bis heute, jeden Abend. Die längsten sechzig Minuten des Tages, und wenn er aufsteht, jeden Abend: Schluchzen und «Bleib doch». Und kaum ist er gegangen, lässt sie Erasmus rufen, um sich bei ihm zu beklagen. Am Vorabend seiner ersten Wahl in den Bürgerausschuss hatte der Junge an die Arbeitszimmertür geklopft. Mama habe Krämpfe. Vorwurf in seinem Blick.
Dabei ist es nicht so, dass die Arbeit im Bürgerausschuss irgendwo hinführen würde. Sein Bruder Achim sitzt im Senat, und mehr als ein Mitglied einer Familie erlaubt die Verfassung des kleinsten Staates nicht. Nach Achim käme der nächstälteste Heinrich dran. Und bei Heinrich gibt es nichts zum Nachrücken, Heinrich ist Präses der Handelskammer und Friedrich Lindhorst kein Kaufmann. Im kleinsten Staat des Deutschen Reiches sind ihm alle Wege abgeschnitten. Nichts davon ist neu, und nichts davon hat ihn bisher bedrückt.
Als Nachlassverwalter hat er sich verstanden. Bewahrer des Keitel’schen Erbes. Elf Schritte sind es von seiner Haustür in südlicher Richtung die Königstraße hinunter, bis er die linke Schuhspitze seines Schwiegervaters sieht und, nach ein paar weiteren Schritten, sein angewinkeltes Knie und gleich darauf den Ellbogen darüber. An der Ecke ragt er dann in Gänze vor ihm auf: 3,70 Meter hoch, 1,27 Tonnen schwer sitzt der Dichter, in Bronze gegossen, breitbeinig auf einem Baumstumpf und blickt über den Platz, der seit letztem Herbst seinen Namen trägt. Im Ganzen recht gelungen, der Entwurf, findet er. Selbst der sterbende Engel am Fuß des gemauerten Sockels, von dem niemand so recht weiß, was er bedeuten soll. Nur kann Friedrich nicht anders, als jedes Mal, wenn er über den Koberg geht, sich den Wutausbruch des alten Herren vorzustellen, hätte ihm tatsächlich jemand vorzuschlagen gewagt, auf einem Baumstumpf Platz zu nehmen.
Nur der Auftakt, so hatte er die Feierlichkeiten im Herbst gesehen. Ein Höhepunkt, ja, aber eher der Anfang als das Ende von etwas. Eine Jubiläumsedition hatte der Cotta-Verlag abgelehnt, es seien noch genügend Gesammelte Werke auf Lager. Ebenso den Sonderband mit unveröffentlichten Briefen und Fragmenten. Friedrichs Korrespondenz mit dem Kreis der Freunde und Verehrer ist in den letzten Monaten auf ein paar gelegentliche Karten zusammengeschrumpft.
Vor dessen Tod hatten die Keitel’schen Angelegenheiten seine Vormittage verschlungen und, wenn er zu Gericht musste, die Abende. Als Auszeichnung, so hatte er es empfunden, auch wenn er manche Erkundigung nach der Beschaffenheit von Pensionszimmern, Fußbänken oder Haartoniken gerne Hupmann und den Schreibern überlassen hätte. Als Ausdruck unausgesprochenen Vertrauens. Der Dichter überließ ihm alles blind, allenfalls ein zerstreutes «Ist es erledigt?» von Zeit zu Zeit. Einem großen Geist ist Kleinliches abhold, so drückte er es aus. Friedrich hat den Satz irgendwo notiert, er sammelte damals für einen Aphorismenband.
Er öffnet die Tür zur Schreibstube, Hupmann zuckt zusammen. Die Sekretäre nehmen Aufstellung neben ihren Pulten.
«Sie haben Mandantschaft», sagt Hupmann.
Als Friedrich nach seiner Taschenuhr greift, um sich zu vergewissern, dass es noch nicht zwölf ist, die Vertreter der Gärtnereien zu früh gekommen sind, schüttelt sein Bürovorsteher den Kopf. «Pusselt.» Er flüstert. «Ich habe ihn in Ihr Arbeitszimmer geführt, das Wartezimmer ist noch nicht angeheizt.»
«Was will er?»
Pusselt & Söhne ist eines der aufstrebenden Handelshäuser des kleinsten Staates, Eisenerz aus Schweden und Russland, anwaltlich werden sie seit Jahrzehnten von Dr. Vanheeren vertreten. Gerüchte über ein Zerwürfnis gibt es bisher keine.
Hupmann zieht die Schultern hoch. «Offenbar hat sein Diener heute früh seine Karte abgegeben, um ihn anzukündigen.» Hupmann reicht sie Friedrich. «Sie lag in der Schale in der Diele, wir haben sie vorher nicht bemerkt.»
Werde mich um zwölf in Ihrem Bureau einfinden, steht dort. Kein Bitte. Kein Würde es Ihnen passen? Pusselt werden Ambitionen auf den Vorsitz der Handelskammer nachgesagt, den Bruder Heinrich innehat.
Es poltert auf der Treppe hinter ihnen in der Diele, Friedrich fährt herum. Werner und Robert, die beiden Mittleren, vermutet er. Doch als er die Tür öffnet, um sie zurechtzuweisen, ist es das Mädchen, das mit dem Bohnerbesen die Treppe herunterkommt.
«Ich dachte, die Jungen wären schon zu Hause.»
Das Mädchen bleibt auf den Stufen stehen. «Nur der Älteste.»
«Erasmus? Warum das?»
«Halsschmerzen.» Sie schwankt ein wenig.
Die Wut kommt so unvermittelt, dass sie Friedrich überrascht, fast wäre er an Ida vorbei die Treppe hinaufgestürzt. Gerade noch rechtzeitig fällt Pusselt ihm ein. «Ruhe! Ich habe Mandantschaft.»
5 Nur die Borsten des Bohnerbesens auf dem Parkett des Gartenzimmers sind zu hören und ihr Atem, das rechte Nasenloch pfeift. Im restlichen Haus: Auf-Zehenspitzen-Stille. Während Ida die gusseiserne Besenplatte zum zweiten Mal über das Parkett des Saals schob, gab es Gebrüll im zweiten Stock. Kurz darauf polterten sie die Treppe herunter, erst der Vater, dann der Sohn. Übertönten mühelos das Schleifen der Klauenfüße, als Ida das Sofa beiseite zog. Der Gnädige knallte die Tür der Schreibstube hinter sich zu, Erasmus riss die zum Windfang so heftig auf, dass sie gegen die Wand schlug und Ida sich schon die Scherben der geätzten Glasscheiben auffegen sah. Doch alle sind heil geblieben.
Seitdem herrscht Auf-Zehenspitzen-Stille. Weil Ida bohnert, hat die Köchin bei Tisch aufgetragen. Die Gnädige isst oben. Ida lehnt sich auf den Besenstiel, sodass sie die Borsten an der Unterseite der Platte eben noch vorwärtsschieben kann. Auf deren Oberseite das Relief eines Tierkörpers mit glänzend aufgeworfenem Bauch. Eine Ratte, hat Ida am Anfang gedacht. «Ein Elefant!», hat die Köchin sie belehrt, weil: «Je mehr Gewicht, desto schöner glänzt das Holz.» Erst wenn sich sämtliche Stühle, Sessel, Tischchen, Regale, die weißen Porzellanbäuche der Vasen, die lindgrünen Lampenschirme mitsamt den Konsolen, auf denen sie stehen, einwandfrei im Boden spiegeln, ist er fertig, sagt die Gnädige.
Benutzt wird der Saal für Dinner oder Bälle, nachmittags empfängt die Gnädige im Gartenzimmer. Seit Ida bei Lindhorsts ist, gab es allerdings erst zwei Dinner, und schon vor der Schwangerschaft wünschte Marie Lindhorst kaum Besuch.
Idas linker Arm gibt unvermittelt nach, der Ellbogen knickt ein, ohne Schmerz, ohne scharfes Stechen. Hält einfach nur nicht mehr stand. Ida versucht, sich mit der anderen Hand abzufangen, die Balance nicht zu verlieren, vergebens. Langsam kippt sie nach vorn und dann zur Seite, landet mit der Schulter, der Hüfte auf den Dielen, und jetzt sticht der Schmerz reichlich. Die Haut über ihrem Hüftknochen ist violett verfärbt, als sie abends nachsieht, ebenso ihr Oberarm.
Ida rollt auf den Rücken, die feuchten Abdrücke vor dem inneren Auge, die ihre schweißdurchnässte Bluse auf dem Holz hinterlassen wird. Ihre Füße stoßen gegen das Tischchen, auf dem die Gnädige Andenken an ihren Vater auslegt, die sie höchstselbst abstaubt. «Ein Ekel», sagt die Köchin über den alten Keitel, «alle ständig am Rennen, um es ihm recht zu machen. Aber recht war es nie, und am Ende gab’s immer Tränen.»
Ida schiebt sich mit den Fersen ein Stück über das Parkett, zwischen die weißlackierten Füße des Seidensofas und den Flügel, bleibt einfach liegen. Atmet tief ein, fühlt die glatte Härte des Bodens. Ihr Brustbein, einige Wirbel knacken, als die Luft ihre Lungen dehnt, den Brustkorb hebt und senkt. Ruhe macht sich in ihr breit, noch nie hat sie so gut gelegen, findet Ida. Vielleicht täuscht sie sich, sie dreht das Gesicht zum Fenster, aber ihr kommt es vor, es würde heller. Die Wolken weniger grau, der Notenständer wirft einen kaum auszumachenden Schatten an die Wand.