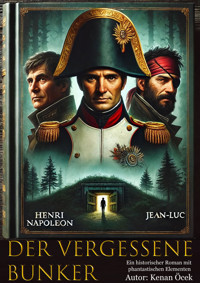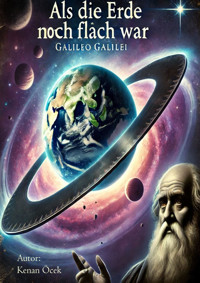5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Architektin der Macht Salome dachte, sie hätte den Traum eines perfekten Lebens gefunden – doch was als Märchen begann, verwandelte sich in einen Albtraum aus psychischem Terror. Gefangen in einer toxischen Ehe, zerfrisst die Kontrolle ihres Mannes langsam ihre Identität. Doch Salome ist keine Frau, die sich brechen lässt. Inmitten von Lügen, Demütigungen und Manipulation reift in ihr ein Plan. Sie wird nicht länger Opfer sein. Sie wird zur Architektin ihres eigenen Schicksals – und der Zerstörung all jener, die sie kleinhalten wollen. Ein Roman über den Preis der Freiheit, die dunklen Facetten von Macht und den unaufhaltsamen Willen, sich selbst zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kenan Öcek
Architektin der Macht
Macht, Luxus und der Mann, der für den Luxus zahlt – und dann bitte ruhig sein.
Salome – einst gefangen in einer toxischen Ehe, jetzt die Architektin ihrer eigenen Macht. Intrigen, Verrat und ein Plan, der alles verändert. Ein fesselnder Thriller über den Weg von der Unterdrückung zur absoluten Kontrolle. Wer sie unterschätzt, zahlt den höchsten Preis.Inhaltsverzeichnis
Architektin der Macht
Architektin der Macht
1. Akt: Raus aus Georgien, hinaus aus der Armut
2. Akt: Ankunft in der Ordnung
3. Akt: Schöne Bescherung
4. Akt: Picknick und Pakt
5. Akt: Systemfehler. Biologischer Code vs. Machtcode
6. Akt: In Reichtum und Rache
7. Akt: Villa am Waldrand
8. Akt: Leises Implodieren, laute Folgen
9. Akt: Getrennte Betten, getrennte Leben
10. Akt: Das süße makabre Dessert
11. Akt: Die ganze Wahrheit – ein Sack voller Lügen
12. Akt: Im Zweifel für den Zweifel
13. Akt: Zug um Zug alles mein
14. Akt: Die große Säuberung
15. Akt: Reich und Witwe
10. Akt: Die Krone der Macht
Impressum
Architektin der Macht
Vorwort
Salome Gelaschwili – ein Name, der heute für Macht, Einfluss und unbeirrbare Ambition steht. Doch ihr Aufstieg verlief alles andere als gewöhnlich.
Geboren in einem abgelegenen georgischen Dorf, kämpfte sie sich mit eiserner Entschlossenheit aus der Enge einer unbarmherzigen Kindheit bis in die Zentren globaler Macht. Ihr Weg führte durch Verletzung, Verrat und Entscheidungen, für die andere ihre Seele verkauft hätten.
Doch Salome war nie darauf aus, zu gefallen. Sie wollte gestalten. Sie wollte herrschen.
„Architektin der Macht“ ist mehr als ein Thriller. Ein Kaleidoskop aus menschlichen Abgründen – und das Porträt einer Frau, die die Spielregeln der Macht nicht nur versteht, sondern neu schreibt.
Hinter glitzernden Fassaden liegen die Narben ihrer Opfer – und ihre eigenen. Was treibt einen Menschen an, alles aufs Spiel zu setzen? Wie hoch ist der Preis, wenn Moral und Macht sich ausschließen?
Salome stellt diese Fragen – und zwingt uns, selbst Stellung zu beziehen.
Manche Migrationsgeschichten sind keine Flucht – sondern eine Evolution.
Und Salome ist der lebende Beweis dafür.
Begleiten Sie sie auf dem Weg von der zähen Träumerin zur strategischen Meisterin eines Imperiums.
Lassen Sie sich faszinieren. Lassen Sie sich erschüttern – wenn Sie es aushalten.
Und vielleicht – ja, vielleicht – verführen.
Willkommen in der Welt der Macht.
PrologEin Tag wie viele
Zwischen den Reihen war es still.
Nur das gelegentliche Knacken trockener Stängel unter Tomas Füßen.
Salome kniete im Staub, die Hände tief in der Erde, bis die Nägel dunkel waren.
„Schau mal“, sagte Toma plötzlich.
Er zeigte nach vorn, zu einer flachen Senke, wo zwischen den Steinen etwas flatterte.
Ein Schmetterling – nicht groß, aber auffällig: helle Flügel, fast durchsichtig im Licht.
„Was für einer ist das?“, fragte er.
„Keine Ahnung“, sagte Salome, ohne aufzublicken. „Irgendeiner.“
„Schwesterherz“, rief Toma und grinste schelmisch, „was glaubst du – wie viele Schmetterlinge gibt es eigentlich?“
Salome lächelte, nahm Toma leicht unter die Arme und half ihm auf die Beine.
„Was meinst du? Auf dem Acker?“
„Nee, auf der Erde“, erwiderte Toma ernst.
Salome zuckte mit den Schultern, blickte über die Felder. „Keine Ahnung. Aber ich hab gerade einen gesehen.“
Toma schaute nach oben, wo ein zarter Falter über die Wegwarte tanzte, leicht wie eine Feder im Wind.
„Einer“, sagte sie leise, „kann mehr bewirken, als man denkt.“
Toma wollte hinterher, doch der Schmetterling stieg schon wieder auf, ließ sich vom Wind mitnehmen, über den Pfad, vorbei an den Wegwarten, weiter Richtung Hügel.
Salome sah ihm nach, nur für einen Moment, dann schob sie sich mit dem Handrücken eine Strähne aus der Stirn und griff nach der nächsten Kartoffelpflanze.
„Sind doch überall, diese Viecher“, murmelte Toma. Aber sie hörte ihn kaum.
Ihr Blick hing noch dort, wo der Falter verschwunden war.
Nicht wegen ihm.
Sondern wegen der Art, wie er geflogen war.
Als wüsste er nichts vom Gewicht der Welt.
1. Akt: Raus aus Georgien, hinaus aus der Armut
1. Kapitel: Die Schattenspiele der Zukunft
Das Mädchen mit den löchrigen Schuhen
Die Sonne war längst hinter den Bergen von Sno versunken, doch die Hitze des Tages klebte noch schwer in der Luft.
Salome balancierte einen Korb voller Kartoffeln auf der Hüfte, während sie mit Toma den holprigen Pfad entlangging.
Feiner Staub bedeckte ihre nackten Füße, und bei jedem Schritt spürte sie den rauen Boden durch die löchrigen Sohlen ihrer abgetragenen Schuhe.
„Schneller, Salome – sonst fängt Onkel Valerian an zu schimpfen!“, rief Toma, der wie eine flinke Bergziege vor ihr hersprang.
Onkel Valerians Haus war das einzige im Dorf mit einem Fernseher – für Salome ein Fenster in eine andere Welt.
Während die anderen Kinder draußen spielten oder Kühe trieben, saß sie am liebsten vor dem flimmernden Bildschirm und träumte sich in die glänzenden Welten, die er zeigte.
Als sie die Tür öffneten, saß der alte Valerian bereits in seinem Lehnstuhl.
„Da seid ihr endlich! Strom kostet Geld, ihr Tagträumer!“, knurrte er und nahm den Korb entgegen. „Und das Brot ist wieder vom Billigbäcker, oder?“
„Brot ist Brot, Onkel“, antwortete Toma mit einem unschuldigen Grinsen.
Salome hörte kaum hin.
Ihr Blick klebte bereits am Fernseher, wo eine elegante Frau in einem schneeweißen Kleid eine Kokoskugel in Zeitlupe in den Mund gleiten ließ. Im Hintergrund: türkisfarbenes Wasser, eine schwingende Hängematte, leise Klaviermusik – eine Werbung wie ein Versprechen.
„Mama, schau mal … so möchte ich auch eines Tages leben“, flüsterte Salome, ohne den Blick vom Bildschirm zu lösen.
Ihre Mutter Tsilia legte ihr sanft eine Hand auf die Schulter.
„Vielleicht, mein Kind. Eines Tages. Aber zuerst müssen wir dir neue Schuhe besorgen.“
Salome sah nach unten. Die Löcher in ihren Schuhen wirkten größer als gestern – als wüchsen sie mit jedem Tag, als wollten sie ihre Ungeduld zeigen. Sie biss sich auf die Lippe und senkte den Kopf.
„Nächsten Monat“, fügte Tsilia leise hinzu – fast, als wolle sie es sich selbst mehr versprechen als ihrer Tochter.
Später, als Salome in die Nacht hinausging, war das Dorf still.
Nur ihr Atem, das Knirschen des Pfades und das Bild der Kokoskugel in Zeitlupe kreisten durch ihren Kopf.
Der Traum von der Südsee – ausgerechnet aus einer Werbepause – war der erste Funke.
Sie wusste es noch nicht.
Aber er hatte Feuer gefangen.
Wenn Wünsche Flügel hätten
„Toma! Komm her, es gibt Neuigkeiten!“ Salome rief ihren Bruder vom Brunnen, während sie über die staubige Dorfstraße zur Nachbarin rannte.
Vor dem kleinen Häuschen von Tante Nargiza stand ein alter, aber blitzblank polierter VW Passat mit deutschem Kennzeichen.
Daneben: Koffer. Keine Beutel oder Tüten – echte, glänzende Hartschalenkoffer. Im Dorf wirkten sie wie königliche Schatztruhen.
„Deutschland!“ rief Tante Nargiza, als sie Salomes neugierigen Blick bemerkte. „Mein Sohn hat mich endlich eingeladen. Schau dir das an, Salome! Das ist mein Ticket. Ich fliege morgen nach Frankfurt.“
Salome schnappte sich das Ticket und hielt es, als wäre es aus Gold.
„Deutschland … Frankfurt“, las sie langsam. Das Wort klang wie ein Zauberspruch.
„Frankfurt – ist das da, wo sie goldene Straßen haben?“, fragte Toma, der inzwischen neben ihr stand.
„Ach, Kinder!“ Nargiza lachte, legte die Hände in die Hüften und blickte in die Ferne. „Dort arbeitet man hart, ja. Aber man lebt wie ein König. Mein Sohn hat eine Spülmaschine – stellt euch das mal vor! Die wäscht das Geschirr ganz von allein!“
„Wirklich?“ Salome konnte es kaum glauben. Ihr Blick wanderte zu den rissigen Händen ihrer Mutter, die im Hof Wäsche wrang.
„Und Heizungen haben die! Im Winter ist es drinnen warm wie im Sommer.“
„Mama!“ Salome rannte los. „Wir müssen auch nach Deutschland! Da gibt es Maschinen für alles – und warme Häuser!“
Tsilia, die sich gerade den Schweiß von der Stirn wischte, seufzte.
„Deutschland, hm? Da musst du erst mal hinkommen. Das kostet Geld.“
Salome kaute auf ihrer Lippe.
In ihrem Kopf begann es zu rattern.
„Ich finde einen Weg“, murmelte sie.
Am nächsten Tag saß sie stundenlang unter der alten Ulme. Toma und ein paar Nachbarskinder hatten sich um sie versammelt.
Gemeinsam schmiedeten sie Pläne, wie man das nötige Geld auftreiben könnte.
„Wir könnten Eier verkaufen!“, schlug Toma vor. „Oder die alte Ziege“, sagte ein anderes Kind.
„Vergesst das. Wir brauchen mehr“, sagte Salome und verschränkte die Arme. „Ich muss wie Nargiza einen Sohn haben, der mich später einlädt!“
„Du bist erst neunzehn!“, rief Toma empört.
„Und?“ Salome grinste. „Man muss früh anfangen.
Ich werde nach Deutschland gehen – und dann hole ich euch alle nach!“
Die Kinder klatschten.
Salome blickte in die untergehende Sonne.
Goldene Straßen, Spülmaschinen, warme Häuser – es war, als ob ihre Fantasie Flügel bekommen hätte.
Aber tief in ihrem Innern begann sie sich bereits zu verabschieden – von der Erde unter ihren Füßen, vom vertrauten Staub, vom Rhythmus des Dorfes.
Am Abend saß sie allein, ein geliehenes Modeheft auf dem Schoß.
Sie blätterte langsam, stieß auf eine kleine Anzeige – „Billigflüge Frankfurt ab 316 Lari“ – und schnitt sie mit einer rostigen Nagelschere aus.
Nicht, weil sie es brauchte. Sondern weil es ihr Beweis war: Der Traum hatte jetzt eine Zahl. Eine Richtung. Einen Anfang.
Die schiefe Naht
Es war nur ein Kleid.
Dunkelblau, schlicht, aus georgischem Stoff und durchwachten Stunden genäht.
Tsilia hatte es in einer Nacht voll Flüstern und Fadenstille gefertigt.
Das Licht war gedimmt, der Tee längst kalt. Ihre Hände arbeiteten, während draußen der Wind an den Fensterläden kratzte und drinnen eine Mutter versuchte, etwas zu schaffen, das blieb.
Sie war zufrieden gewesen. Fast.
Doch unter der Schulter – da war sie.
Eine schiefe Naht.
Nur ein Stich zu viel zur Seite, nur sichtbar, wenn das Licht von der Seite fiel.
So, wie man Schuld auch nur sieht, wenn jemand genau hinschaut.
„Sieht man’s?“, hatte sie Salome gefragt.
Das Mädchen, sechzehn, mit dieser Art von Augen, die schon mehr kannten, als sie sagen durften, drehte sich vor dem Spiegel, prüfte den Stoff, sagte dann:
„Wenn du nichts sagst, sieht es niemand.
Und wenn doch – denken sie, es gehört so.“
Tsilia lächelte.
Doch irgendwo in ihr blieb ein kleiner Stich, wie ein Faden, der sich nie ganz lösen lässt. Denn sie wusste:
Es gibt Dinge, die nur Mütter bemerken. Und Dinge, die Töchter tarnen – aus Liebe, aus Trotz, aus einem Zwischenraum, den nur Blut versteht.
Die Naht blieb.
Wie eine Erinnerung, die niemand sieht. Und doch spürt.
Später, beim Zusammenlegen des Kleides, dachte Tsilia daran, wie man es in ihrer Kindheit mit Teppichen gemacht hatte.
In jedem war ein einziger, kleiner Fehler geknüpft worden – mit Absicht.
„Nur Gott ist vollkommen“, hatte ihre Großmutter gesagt.
„Und wer es besser machen will, verflucht sein eigenes Werk.“
Vielleicht war auch das Kleid so ein Teppich.
Ein stilles Gebet aus Stoff und Sehnsucht.
Und die schiefe Naht – kein Fehler.
Sondern ein Zeichen, dass es von Menschen gemacht war.
Von Händen, die lieben konnten.
Mehr als nur Maisbrot
Der Duft von frisch gebackenem Maisbrot durchzog das kleine Haus wie eine warme Umarmung gegen die Kälte des Lebens. Am alten Holztisch saß die Familie dicht gedrängt, während Tsilia dampfende Schüsseln mit Bohnensuppe auftrug – Bohnen, die sie selbst gepflückt, selbst eingeweicht hatte. Für einen Moment schien alles friedlich – bis Salome das Schweigen durchbrach.
„Papa?“ Ihre Stimme war leise, fast zögerlich, während der Löffel in der Suppe kreiste. „Hast du jemals darüber nachgedacht, woanders zu leben?“
Beso hielt inne. Seine Hand erstarrte, der Löffel tropfte zurück in die Schüssel.
„Woanders?“ Er sah sie an, misstrauisch. „Wie meinst du das?“
„Na ja... Deutschland zum Beispiel.“ Salome versuchte zu lächeln – ein Lächeln, das zwischen Hoffnung und Angst balancierte. „Keine klapprigen Traktoren mehr. Keine Winter, in denen man im Schlaf atmet wie eine Dampflok, nur um sich warm zu halten.“
Beso schnaubte. „Deutschland. Da reden sie, als hätten sie Murmeln im Mund. Und alles kostet mehr, als du in einem Jahr verdienst. Was willst du da tun?“
„Arbeiten!“ Ihre Stimme wurde fester. „Tante Nargiza sagt, ihr Sohn verdient dort mehr in einem Monat als wir in einem ganzen Jahr. Er hat zwei Autos, Papa. Zwei!“
Toma verschluckte sich fast am Brot und prustete los. „Und du willst gleich Autohändlerin werden, oder was? Vielleicht Ministerin?“
„Lass sie reden“, sagte Tsilia ruhig, während sie Brotkrümel vom Tisch strich – als würde sie damit auch die Zweifel wegwischen wollen. „Vielleicht hat sie ja recht. Hier kommen wir kaum noch über die Runden. Der Staat schickt nur Versprechen, keine Lösungen.“
Beso verzog das Gesicht. „Und die Felder? Wer kümmert sich um das Land? Um die Reben? Wer beschützt die Erde, wenn wir gehen?“
Salome zögerte nur einen Moment. Dann kam es wie ein Stich aus ihrem Inneren:
„Ein Land, das nur noch Schulden hervorbringt und keine Zukunft, kann uns nicht halten. Wir reißen uns jeden Tag den Rücken auf – für kaputte Schuhe und einen Fernseher, den wir nicht mal selbst besitzen.“
Er antwortete nicht sofort. Also legte sie weicher nach: „Ich will nur eine Chance, Papa. Nur eine echte Chance.“
„Und was ist mit der Sprache?“ fragte Beso, fast trotzig.
„Die lernen wir. In der Schule hatten wir doch schon ein bisschen Deutsch. Hör mal: Guten Tag, ich bin Salome. Ich möchte arbeiten.“ Sie grinste, als hätte sie gerade den Zauberspruch fürs bessere Leben aufgesagt.
Toma schüttelte grinsend den Kopf. „Das klang eher wie: Ich verkaufe Fisch auf dem Markt.“
Alle lachten. Sogar Beso. Doch das Lachen klang dünn – wie das Licht einer Petroleumlampe, kurz bevor der Docht verlischt.
Später, als die Schüsseln leer waren und die Kerze auf dem Tisch flackerte, saß Beso noch immer dort. Schweigend. Starrte auf die Maserung im Holz, als könnte sie ihm eine Antwort geben.
„Sie hat Träume, Beso“, sagte Tsilia leise, als sie sich neben ihn setzte. „Und vielleicht ist dieser Traum die letzte Tür, die uns nicht zugeschlagen wurde.“
Er schwieg. Draußen spannte sich der Himmel wie ein dunkles Tuch über das Land. Die Sterne funkelten wie Nadelstiche der Hoffnung. Dann sagte er:
„Weißt du, was mit einem Baum passiert, den man ausreißt? Er trägt keine Früchte mehr. Egal, wie gut die Erde ist, in die du ihn setzt.“
Tsilia sah ihn an.
„Vielleicht. Aber vielleicht gibt es auch Bäume, die in der Fremde stärker Wurzeln schlagen, weil sie es müssen.“
Er atmete langsam aus, als müsse er damit einen Teil seiner Geschichte loslassen.
„Gut,“ murmelte er schließlich. „Wir versuchen es. Aber es wird nicht leicht.“
Salome hatte alles gehört. Ihr Herz pochte wild, während sie ins Freie stürmte. Kalte Nachtluft schlug ihr entgegen, doch sie lachte – leise, wie man lacht, wenn man etwas gestohlen hat, das man sein Eigen nennt.
Sie blickte hinauf zu den Sternen, die wie kleine Wegweiser über dem Dach standen.
„Deutschland“, flüsterte sie. „Ich komme.“
2. Kapitel: Die Tür zum Paradies
Passierschein für Träume
Der alte Bus ächzte und knarrte, als er die kurvigen Straßen hinunterrollte. Staub wirbelte auf, das Dröhnen des Motors übertönte fast die Gespräche der Fahrgäste. Salome saß neben Beso, die Stirn gegen die Fensterscheibe gelehnt, und beobachtete die vorbeiziehenden Felder und Dörfer.
„Also, wie läuft das genau?“ fragte Beso, während er nervös die Tickets in seiner Jackentasche drehte.
„Wir stellen uns an, geben die Unterlagen ab – und dann warten wir“, sagte Salome. Ihre Stimme klang gelassen, aber innerlich vibrierte sie.
„Warten?“ Beso kniff die Augen zusammen. „Wie lange?“
„Ein paar Wochen vielleicht.“ Sie zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck Wasser.
„Wochen?“ Er schnaubte. „Ich dachte, das geht schneller. Wir sind doch nicht die Einzigen, die was erreichen wollen.“
„Genau deshalb“, konterte Salome knapp. „Es gibt viele wie uns. Aber wir haben etwas, das die anderen nicht haben.“
„Was denn?“ fragte Beso skeptisch.
„Mich“, sagte sie, blinzelte ihm zu und trank weiter.
Beso stöhnte. „Du und dein Selbstvertrauen.“
Der Bus hielt vor einer belebten Straße. Das deutsche Konsulat ragte hinter hohen Zäunen auf, ein Schild mit großen Lettern kündigte die Botschaft an. Eine lange Schlange hatte sich bereits gebildet, und die Sonne brannte gnadenlos.
„Das ist es also“, murmelte Beso und zog den Hut tiefer ins Gesicht. „Das Tor zum Paradies.“
„Oder zur Hölle“, fügte Salome trocken hinzu.
In der Schlange erzählte ein alter Mann Geschichten aus seiner Jugend. Ein Mädchen biss in einen Apfel, größer als ihre Hand. Eine Frau schimpfte über die Bürokratie, als wäre sie ein persönlicher Angriff auf ihr Leben.
„Wenigstens stehen wir im Schatten“, bemerkte Beso, als ein Windhauch die stehende Luft aufwirbelte.
„Wenn wir es schaffen, Papa“, sagte Salome ernst, „dann wird alles besser. Kein Maisbrot mehr. Keine kaputten Schuhe. Keine Träume, die im Staub ersticken.“
Beso seufzte und legte ihr eine Hand auf die Schulter. „Dein Traum, Salome… ich hoffe, er ist die Mühe wert.“
Sie schwiegen. Die Schlange kroch langsam vorwärts.
Als sie das Tor erreichten und ihre Unterlagen abgaben, spürte Salome, wie sich ein Knoten in ihrer Brust löste.
„Der erste Schritt“, flüsterte sie beim Betreten des Konsulats. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Drinnen war es kühl, klinisch hell.
Die Stimmen hallten zwischen Glaswänden und Formblättern. Salome blinzelte gegen das Neonlicht. Vielleicht war ein Konsulat wie ein Geburtskanal für Träume – eng, bürokratisch, gnadenlos hell.
Beso trat neben sie, legte ihr eine Hand auf den Rücken.
„Du bist im tiefsten Winter geboren. An einem Tag, da alles grau war. Und dann kamst du – und die Kälte machte Platz für einen Sonnenstrahl.“
Salome antwortete nicht.
Aber das Zittern in ihren Schultern war kein Frösteln.
Es war das leise Beben eines Traums, der gerade laufen lernte.
Blicke hinter dem Schalter
Das Innere des Konsulats war steril. Der Geruch von Bodenreiniger lag wie ein Schleier in der Luft. Die langen Holzbänke wirkten abgenutzt, als hätten Generationen von Suchenden hier ihre Hoffnung abgelegt – still, ohne Spuren zu hinterlassen.
Salome saß neben Beso, der nervös die Papiere sortierte und dabei ein Lied summte – ein Ritual gegen die Anspannung. Sein bestes Hemd trug er. An den Ellbogen war es vom vielen Tragen fast durchsichtig. Salome trug ein geblümtes Kleid ihrer Cousine – zu groß, zu neu, aber wenigstens ohne die staubige Spur des Dorfes.
Beide versuchten Haltung zu bewahren. Doch das Gefühl des Dazugehörens fehlte.
„Was summst du da, Papa?“, flüsterte Salome.
„Einen alten Kriegergesang“, antwortete Beso leise. „Passt zur Situation. Hier kämpfen wir – um unsere Zukunft.“
Salome kicherte. „Ich dachte eher, wir kämpfen gegen den Bürokratie-Drachen.“
Vor ihnen zog sich die Schlange weiter. Am Ende: ein Schalter mit einer Beamtin, deren hochgestecktes Haar bei jedem Tastenanschlag leicht wippte – wie eine Königin im kalten Schloss.
„Glaubst du, sie hasst ihren Job?“ flüsterte Salome, den Kopf leicht geneigt.
„Wen meinst du?“
„Die Schalterhexe.“
Beso unterdrückte ein Lachen. „Salome, benimm dich.“
„Vielleicht hatte sie einfach keinen Kaffee“, meinte sie grinsend.
„Oder wir sind ihr zu oft über den Weg gelaufen.“
Sie kicherten.
Dann waren sie dran. Beso legte die Dokumente auf die Theke.
„Passkopie?“ fragte die Beamtin, ohne aufzublicken.
„Hier.“ Beso reichte sie – und ließ dabei einen Stapel Unterlagen fallen.
„Oh, Entschuldigung!“ Salome sprang auf, sammelte die Blätter ein.
Die Beamtin seufzte. „Passiert öfter, als Sie denken.“ Dann, trocken: „Nächstes Mal bitte in einer Mappe.“
„Mein Fehler“, murmelte Beso.
„Hier passieren ständig Fehler“, sagte sie. Ihre Finger tippten weiter, mechanisch, wie ein Uhrwerk.
Salome warf einen verstohlenen Blick auf den Bildschirm. Die Worte waren unverständlich. Neben ihnen tuschelten zwei Mitarbeiter. Sie war sich sicher: Es ging um sie.
„Papa“, flüsterte sie, „glaubst du, die Beamten haben Spaß daran, uns zu beurteilen?“
Beso sah sie an. Resignation und Entschlossenheit lagen in seinem Blick.
„Mach dir keine Sorgen. Das hier ist nur ein kleiner Schritt. Und wir gehen ihn.“
Die Beamtin schob die Papiere zurück. „Reichen Sie die Unterlagen in der Botschaft ein. Die Entscheidung dauert mehrere Wochen.“
Salome lächelte höflich. „Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag.“
Die Frau hob die Augenbraue – für einen Moment blitzte Amüsement in ihrem Blick auf.
Draußen atmete Beso tief durch.
„Das war wie ein Verhör bei den Sowjets.“
„Aber wir haben’s geschafft“, sagte Salome. „Ein Schritt näher am Paradies.“
Drei Tage später zogen wieder Hühner durch die staubigen Gassen von Sno. Alles war wie immer. Nur lag nun ein kleiner Zettel in Salomes Tasche – unscheinbar, aber vielleicht der Anfang eines neuen Lebens.
Hoffen, beten, warten
Im Dorf war die Aufregung groß. Besos Auswanderungspläne waren das Gesprächsthema Nummer eins. In der Abenddämmerung versammelten sich die Nachbarn wie Mücken auf den Hausstufen – summend vor Neugier.
„Beso!“ rief Dato. „Schon die Koffer gepackt, oder wartest du noch auf das goldene Flugticket?“
„Komm erst mal mit dem Visum an, dann reden wir weiter.“
„Und wenn du zurückkommst, kaufst du das ganze Dorf auf!“
Lachen.
„Bring mir eine Kuh aus Deutschland mit!“
Noch mehr Lachen.
„Ich bring dir lieber einen Traktor“, warf Salome trocken ein.
Zura stand plötzlich am Ziegenzaun.
„Na, wohin geht die Reise, Salomuschka? Reich heiraten? Vielleicht zeigt er dir ein echtes Klo?“
Er schob sich eine unreife Kirsche in den Mund.
„Oder du kommst zurück – mit blonden Zwillingen und deutschem Hund.“
Salome sagte nichts. Nur dieser Blick – trocken wie Lehmboden in der Dürre.
„Oder zeigst im Fernsehen, wie man Suppe mit Regenwasser kocht?“
Noch eine Kirsche. Noch ein Spruch.
Beso trat mit einem Eimer Wasser aus dem Haus. „Zura, wenn Reden Gold wäre, wärst du Milliardär. Leider bist du nur laut.“
„Ich sag ja nur, wie’s ist.“
„Und trotzdem fahren wir los“, sagte Salome ruhig.
„Ach, Zura“, rief Beso. „Eines Tages hörst du meinen Namen im Fernsehen.“
„Papa, dann nur, weil du Zura versehentlich mit dem Eimer erwischt hast“, grinste Salome.
„Oder weil ich mich beim Fensterputzen verheddert hab“, warf Tsiala ein.
„Oder weil ich die erste Revolution in Deutschland mit Tee und Freundlichkeit anzettle“, konterte Beso.
„Dann bin ich deine Pressesprecherin.“
„Und du lügst für mich?“
„Nur beim Alter.“
Das Lachen war kurz, aber echt – und blieb wie ein warmer Faden in der Luft hängen.
„Ich werde seine Leibwache!“, rief Dato noch aus dem Fenster.
Eine alte Frau nickte. „In Deutschland wächst das Brot auf Bäumen.“
„Nein, Oma“, flüsterte Salome. „Aber vielleicht wächst dort das Geld.“
Wieder Lachen.
Dann Stille.
Beso saß allein auf der Stufe und starrte in die Nacht.
„Was ist los, Papa?“
„Was, wenn alles zerplatzt? So viel Hoffnung…“
Salome legte ihre Hand auf seine. „Vielleicht schaffen wir’s nicht sofort. Aber irgendwann. Für uns. Für die, die nach uns kommen.“
Er nickte. „Die Zeit des Wartens wird mich noch umbringen.“
„Dann nutzen wir sie“, sagte Salome. „Fangen wir an, deutsch zu denken.“
„Zum Beispiel?“
„Pünktlich sein.“
Beso lachte und zog sie in eine Umarmung. „Du bist wirklich die Tochter eines Kriegers.“
Über dem Dorf funkelten die Sterne.
Und in Salomes Kopf: Hoffen. Beten. Warten.
Das Visum war nicht nur Papier.
Es war ein Versprechen.
3. Kapitel: Die Währung der Träume
Was bleibt, wenn nichts mehr übrig ist?
Der Duft von frisch gebackenem Maisbrot erfüllte die kleine Küche, während Salome mit ihrer Mutter Tsilia den Teig knetete. Doch an diesem Morgen klangen selbst die vertrauten Geräusche des Holzofens bedrückend. Heute stand eine Entscheidung an, die ihr Leben verändern sollte.
„Salome, wir haben kaum noch etwas übrig,“ sagte Tsilia und wischte sich den Mehlstaub von den Händen. Ihre Stimme war schwer. „Wie sollen wir die Gebühren bezahlen? Das Visum, das Ticket ...“
Salome sah ihre Mutter an. Ihre Augen brannten vor Entschlossenheit. „Wir verkaufen, was wir haben. Alles, was nicht lebensnotwendig ist.“
Tsilia runzelte die Stirn. „Und was bleibt dann?“
Salome zuckte mit den Schultern. „Die Hoffnung.“
Später stand Salome auf dem kleinen Marktplatz des Dorfes, ein Bündel in der Hand. Darin lagen die wenigen Wertgegenstände ihrer Familie: eine silberne Brosche der Großmutter, ein selten genutztes Radio, ein Paar Ohrringe von der Cousinenhochzeit – alles, was blieb. Die anderen Marktfrauen musterten sie mit einer Mischung aus Neugier und Mitleid. Eine alte Bekannte, Nina, trat näher.
„Salome, warum verkaufst du das alles? Sind die Zeiten so schlecht?“
„Nicht schlecht genug, um mich aufzuhalten,“ antwortete Salome und setzte ein Lächeln auf, das mehr Zuversicht verbarg, als sie fühlte.
Ein Kunde interessierte sich für das Radio. Er drehte es in den Händen, prüfte es skeptisch. „Funktioniert es?“
„Einwandfrei,“ sagte Salome und erinnerte sich daran, wie sie früher Musik aus diesem Gerät gehört hatte, während sie die staubigen Böden wischte.
„Fünf Lari gebe ich dir dafür.“
„Zwanzig,“ entgegnete Salome sofort, ihre Stimme fest.
Der Mann schnaubte verächtlich. „Für zwanzig lei bekomme ich ein neues!“
„Dann kaufen Sie ein neues,“ erwiderte Salome und hob das Radio zurück. „Ich bin hier, um zu verkaufen, nicht um zu verschenken.“
Nach einer halben Stunde Feilschen, Argumentieren und gelegentlichem Charme hatte sie genug Geld zusammen, um einen Teil der Kosten zu decken. Doch als sie später nach Hause kam und die Münzen auf den Tisch legte, reichte es noch nicht.
„Das wird nicht reichen,“ flüsterte Tsilia und zählte die Münzen ein letztes Mal.
„Es wird reichen,“ sagte Beso plötzlich, als er mit einem kleinen Sack in der Hand zur Tür hereintrat.
„Was ist das?“ fragte Salome.
„Die Kette deines Großvaters. Ich habe sie für einen besonderen Moment aufbewahrt. Und ich glaube, dieser Moment ist jetzt.“
Salome schluckte schwer. „Aber Papa, das ist doch ein Erinnerungsstück.“
„Was nützen Erinnerungen, wenn wir nicht vorankommen?“ sagte Beso fest. „Ich will, dass du das nutzt. Es ist ein Opfer, das ich gerne bringe.“
Salome nahm die Kette in die zitternden Hände. Es fühlte sich an, als würde sie ein Stück ihrer Familie loslassen. Doch sie wusste, es war nötig.
Am nächsten Morgen, als die Sonne langsam über den Hügeln aufstieg, stand sie wieder auf dem Marktplatz. Mit jedem verkauften Stück wurde ihr Traum greifbarer. Doch ihr Herz wurde bei jedem Abschied schwerer.
Tausche Huhn gegen Hoffnung
Auf dem staubigen Dorfplatz herrschte geschäftiges Treiben. Zwischen dem Murmeln der Marktfrauen und dem gelegentlichen Krähen eines Hahns balancierte Salome einen Korb. Darin: das einzige Huhn der Familie – ein stolzer, weißer Vogel, der seit Jahren Frühstückseier gelegt hatte.
„Salome!“, rief Nachbarin Lela vom Stand gegenüber. „Willst du dein Huhn verkaufen? Was bleibt euch dann zum Leben?“
Salome lächelte dünn.
„Ich tausche es, Lela. Gegen Zukunft.“
Lela hob die Brauen.
„Du wirst es bereuen. Niemand tauscht hier fair.“
Salome ignorierte den Ton. Sie ging zu Tamazi, einem alten Händler mit einem Tisch voller Secondhand-Kleidung.
„Was gibst du mir für das Huhn?“ fragte sie, mit einer Sicherheit, die mehr Fassade war als Gefühl.
Tamazi musterte das Tier.
„Mager.“
„Mager?“ Salome schnaubte. „Das ist das kräftigste Huhn im ganzen Dorf.“
„Ich geb dir ein Paar gebrauchte Stiefel“, sagte er. Pause. „Und eine Dose Nägel.“
Salome starrte ihn an. So wenig war ihr Traum also wert. Dann straffte sie die Schultern.
„Abgemacht.“
Als sie nach Hause kam, stellte sie die Stiefel und die Dose Nägel auf den Tisch.
Beso sah sie ungläubig an. „Du hast unser Huhn gegen Nägel eingetauscht?“
„Nägel für den Sarg unserer Armut“, sagte Salome. Und lachte – nicht, weil es lustig war, sondern weil es das Einzige war, was ihr blieb.
Dann grinste sie.
„Weißt du noch Nikoloz? Nargizas Sohn? Der Tagedieb, der Nägel auf Baustellen sammelte, geradebog und weiterverkaufte? Alle haben über ihn gelacht. Jetzt lebt er in Frankfurt, fährt zwei Autos, hat seine Mutter nachgeholt – und spricht von Familienzusammenführung, als wär er Diplomat.“
Beso runzelte die Stirn.
„Nikoloz? Der, der mal im Dorfbrunnen badete und meinte, das sei sein Spa?“
„Genau der.“
„Manchmal führen selbst krumme Wege nach Deutschland.“
Salome legte die Nägel auf den Tisch – nicht achtlos, sondern mit Geste.
Wie eine Königin, die Tribut zahlt.
Ein Klacken. Weich. Endgültig.
„Weißt du, was auf Nargizas Flugticket stand?“, fragte sie.
Stille. Dann kam das Wort – wie ein Orakel, wie ein Riss im Weltbild:
„Economy.“
Sie nickte dabei. Langsam, mehrmals.
Ein Nicken wie ein Ritual.
Und dann riss sie die blauen Augen auf, als wolle sie das Universum zwingen, zuzuhören.
„Sie hat Ja gesagt. Nicht klein. Nicht geknickt. Sondern mit diesem Blick, als würde sie zur UNO fliegen – und das Ticket sei der Schlüssel zum Himmel.“
Beso prustete los.
„Du meinst ernsthaft … Economy?“
Er wusste nicht, was das Wort bedeutete. Aber es verzauberte ihn.
Salome beugte sich vor.
Ihre Stimme: weich, scharf, unausweichlich.
„Ich meine: Sie hat das Wort genommen – und zur Eintrittskarte gemacht.“
Tsilia schnaubte aus der Küche.
„Wenn Nikoloz es geschafft hat, haben wir alle Chancen der Welt.“
Salome nickte.
„Ich fang halt mit Nägeln an. Wer weiß – vielleicht sitz ich in fünf Jahren an der Zeil, schau auf seine goldene Uhr und denk mir: Alles begann mit einem Huhn.“
Beso grinste.
„Und er wird fragen: Welches Huhn?“
„Unser Ticket zum Neuanfang.“
Tsilia schmunzelte müde. Aber das Lächeln blieb.
Und während sich die Familie gegenseitig tröstete, wusste Salome:
Sie würde jeden Handel eingehen, jedes Opfer bringen – solange es ein kleines Stück ihres Traums wahr machte.
„Manche Geschichten beginnen nicht mit einem Koffer. Sondern mit einem leeren Stall.“
Die Reise zum Geldbaum
Salome stand im kleinen Wohnzimmer ihrer Tante – umgeben von staubigen Regalen, verblichenen Familienfotos und einer mageren Auswahl an Erbstücken, die mehr sentimentalen als materiellen Wert hatten. Es roch nach altem Käse, Zwiebeln und einer Prise Vergangenheit. Doch für Salome zählte nur das Morgen.
„Onkel Valerian“, begann sie vorsichtig, „du weißt doch, dass du mir helfen kannst, oder?“ Sie zwang sich zu einem Lächeln. „Ich brauche noch etwas Geld für das Visum.“
Valerian blätterte in einem zerfledderten Fotoalbum. „Ah, mein Mädchen… nach Deutschland also! Na gut. Aber du versprichst mir was: ein Foto mit Canon – verstehst du? Canon! Nicht diese digitalen Plastikkisten. Ich meine echtes Handwerk.“
Er griff hinter sich und zog triumphierend ein Gerät aus einem Regal.
„Hier! Meine AE-1. Baujahr ’79. Japanische Präzision! Damals hat die ganze Welt davon geträumt. So etwas hält ewig!“
Salome betrachtete die schwere Kamera mit ihren abgegriffenen Rändern, dem klemmenden Rädchen und einem Tragegurt, der nur noch aus Fransen bestand.
„Klar, Onkel. Canon AE-1. Ganz großes Kino.“ Sie grinste – halb gerührt, halb amüsiert.
Später saß sie bei Tante Nino in der kleinen Küche. Der vertraute Duft von Knoblauch und frisch gebackenem Brot hing in der Luft. Nino wirkte wie immer – ruhig, warm, ein bisschen traurig.
„Onkel Valerian hat gesagt, du hättest vielleicht noch ein kleines Sparbuch?“
Salome sprach vorsichtig, fast schüchtern.
Tante Nino nickte langsam. Ihre Augen glänzten – irgendwo zwischen Stolz und Sorge.
„Es ist nicht viel“, sagte sie leise. „Aber es ist unser Beitrag zu deinem Glück.“
Sie stand auf, kramte in einer Blechdose und legte Salome ein altes, abgegriffenes Sparbuch in die Hand. „Denk daran, du bist unsere Hoffnung.“
Salome schluckte. Der Moment war klein – aber er wog tonnenschwer.
„Ich werde dich nicht enttäuschen, Tante“, flüsterte sie, als sie das Buch vorsichtig in ihre Tasche gleiten ließ.
„Und denk an das Foto!“, rief Valerian aus dem Nebenraum. „In Frankfurt. Mit der AE-1. Am besten in Farbe – wenn’s geht mit Sonnenuntergang.“
Salome lachte leise.
„Ich schick dir eins, Onkel. Ganz wie du’s willst. Und vielleicht frag ich einen Deutschen, ob er’s entwickelt.“
„Nur nicht digitalisieren!“, brummte Valerian. „Das macht alles kaputt.“
Als Salome die Schwelle übertrat, spürte sie, wie sich ihre Schultern schwerer anfühlten. Das Sparbuch in ihrer Tasche war leicht – aber die Verantwortung wog tonnen.
Sie ging langsam den Hügel hinunter, das Licht der Nachmittagssonne auf dem Rücken.
Und irgendwann, mitten im Staub der Dorfstraße, lief ihr eine einzelne Träne über die Wange.
„Was bleibt, wenn nichts mehr übrig ist?“, murmelte sie.
Dann hob sie den Kopf. „Hoffnung.“
4. Kapitel: Lichter einer fremden Welt
Die Luft riecht nach Möglichkeiten
Es war ein klarer, frischer Morgen, als Salome und ihre Familie ihre Koffer auf das Dach eines klapprigen Busses hievten – jenes rostige Gefährt, das sie vom georgischen Dorf bis zum Flughafen von Gudauri bringen sollte. Hoffnung lag in der Luft, aber auch etwas anderes: das leise Stechen des Abschieds.
Auf dem Dorfplatz hatte sich eine kleine Traube aus Nachbarn, Freunden und Verwandten versammelt. Manche hielten Körbe, andere Taschentücher, alle hielten inne.
„Deutschland, ha?“, sagte Onkel Valerian mit halb ernster, halb schelmischer Stimme, während er Beso einen Klaps auf die Schulter gab. „Vergiss nicht – eine Canon musst du mir mitbringen. Aber kein billiges Zeug! Ich meine die mit richtigem Zoom!“
„Wenn Beso zurückkommt, kauft er gleich das ganze Dorf“, rief jemand aus der Menge und erntete schallendes Gelächter.
„Papa kriegt bestimmt ein Auto mit Sofa drin!“, fügte Toma stolz hinzu und zupfte mit glänzenden Augen an Besos Hand.
Salome konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, obwohl ihre Kehle eng wurde.
„Und ich? Ich sorge dafür, dass wir eines Tages zurückkommen – aber anders.“
Die Umarmungen waren fest und schwer. Salome drückte Nino an sich, küsste Nana auf die Stirn.
„Vergiss uns nicht, Salome“, flüsterte Nana, während sie sich verstohlen die Tränen wischte.
„Ich werde euch schreiben“, versprach Salome. Und: „Ich vergesse nie.“
Die Busfahrt war ein Mosaik aus aufgeregtem Flüstern, nervösem Kichern und langen, stillen Blicken aus dem Fenster. Als das Dorf hinter einer Kurve verschwand, drehte sich Salome noch einmal um. Der Hügel. Das Feld. Die alte Eiche. Alles wurde kleiner, als schiebe jemand ihr bisheriges Leben in die Ferne.
Am Flughafen änderte sich die Stimmung schlagartig. Die Luft roch nach Reinigungsmittel und nassem Stein. Das Gebäude wirkte abweisend, die Schalter nüchtern, die Durchsagen unpersönlich. Die Welt war plötzlich sehr groß – und sie sehr klein darin.
„Das ist es also“, murmelte Beso und hob die Taschen vom Gepäckraum.
Tsilia straffte die Schultern.
„Deutschland erwartet uns, Familie.“
Toma hielt Salomes Hand fester als sonst. Seine Augen sprangen nervös von Schild zu Schild, von Uniform zu Uniform.
„Mama? Haben die in Deutschland auch Bäume?“
Tsilia lächelte matt.
„Natürlich. Vielleicht sogar größere.“
Toma überlegte kurz.
„Ich mag unsere lieber.“
Salome drehte sich ein letztes Mal um. Ihre Blicke suchten etwas, das längst nicht mehr zu sehen war. Nur zu spüren. Das Dorf war weg, aber nicht fort.
Beim Check-in hielt Beso die Unterlagen so fest, als könne er das Visum mit bloßer Willenskraft sichern.
Salome starrte auf den kleinen Monitor hinter dem Schalter. Ihr Name stand dort – schwarz auf weiß, gedruckt auf ein Ticket in eine Welt, die sie nicht kannte.
Er wirkte fast fremd. Fast wie jemand anderes.
„Wird der Flieger wirklich fliegen?“, fragte Toma leise.
„Natürlich“, sagte Salome. Aber ihre Stimme hatte einen Riss.
Holzklasse mit Haltung
Der Flughafen war ein Betongebilde mit zu viel Licht und zu wenig Seele.
Reinigungsmittel in der Luft, bleiches Neon auf grauem Stein.
Der Geruch von Aufbruch – mit einem Hauch Nervosität.
Salome hielt Toma an der Hand, der seine kleinen Finger nervös an ihrer Jacke rieb. Beso trug die Taschen, als wäre Gewicht plötzlich wieder etwas Reales.
Tsilia hatte ihren Pass umklammert wie ein Schulkind den ersten Aufsatz.
Am Check-in-Schalter wartete eine Dame mit strengem Dutt.
Ordentlich. Nüchtern. Wach.
Sie nahm die Dokumente entgegen, tippte, druckte, schaute kaum hoch.
„Economy“, sagte sie sachlich, fast wie ein medizinischer Befund.
Dann schob sie die Tickets über den Tresen.
Salome wiederholte leise das Wort.
„Economy.“ Fast ehrfürchtig. Als wäre es ein Codewort. Ein Losungswort für die nächste Welt.
Die Frau sah kurz auf.
Nicht unhöflich – aber lang genug, dass der Blick etwas fragte:
„Ist das Sarkasmus? Oder ist das echt?“
Sie nickte knapp.
Aber in ihren Gedanken tauchte ein einziges Wort auf:„Holz.“
Diese Familie hatte nicht viel.
Aber sie trugen das Ticket wie eine Einladung zum Staatsbankett. Als würden sie gleich in Business einsteigen – nur eben mit mehr Haltung.
Beso hob sein Ticket in die Luft.
„Vielleicht steht da auch: Fensterplatz für Träumer?“
Toma blinzelte.
„Was heißt Economy?“
Salome beugte sich zu ihm.
„Das ist, wenn man wenig Platz hat – aber große Ziele.“
Toma nickte.
So, wie Kinder nicken, wenn sie etwas noch nicht verstehen, aber glauben wollen.
Die Tickets wurden zusammengetackert.
Mit einem Geräusch, das mehr nach Akte klang als nach Zukunft.
Die Familie ging.
Langsam. Würdevoll.
Die Frau am Schalter beobachtete sie, wie sie im Gate verschwanden.
Salome drehte sich kurz um, nur mit dem Kopf, als wollte sie sich merken, wie es hier riecht.
Dann ging sie weiter.
Die Frau atmete durch.
Sie sagte nichts.
Aber ganz leise – nur für sich – dachte sie:
„Holz... aber vielleicht Eiche.“
Zwischen Wolken und Weißbrot
Später, im Flugzeug, roch es nach kaltem Kaffee, Plastik und fremden Parfüms – eine Mischung aus Aufbruch und Büro.
Der Boden vibrierte. Die Gurte schnallten. Die Zeit hielt kurz den Atem an.
Salome schloss die Augen. Und zum ersten Mal fragte sie sich nicht, was sie zurückließ. Sondern: Was, wenn wir es wirklich schaffen?
Der Flug begann ruhig – abgesehen von Tomas Fragen im Minutentakt.
„Warum hat das Flugzeug keine Ohren?“
„Wo ist vorne?“
„Darf ich meine Schuhe ausziehen?“
Als die Durchsage auf Deutsch und dann auf Englisch erklang, starrte Beso mit gerunzelter Stirn auf die Lautsprecher.
„Klingt wie ein Zauberspruch“, murmelte er. „Oder wie ein Fluch. Kommt drauf an, was sie sagen.“
Das Bordessen wurde serviert. Ein quadratisches Tablett mit Rätselcharakter: kleiner Salat, kleines Brot, ein Stück Käse, etwas Warmes in Plastik – laut Etikett: „Chicken or Pasta“.
Beso betrachtete die Schale mit Misstrauen.
„Das Huhn sieht aus, als wär es freiwillig gestorben.“
„Ich glaub, das Brot war schon in Rente“, sagte Salome und tunkte es trotzdem in die dünne Soße. „Aber immerhin ist’s warm.“
Beso stand irgendwann auf, murmelte etwas von „Verdauungskontrolle“ und verschwand Richtung Toilette. Als er zurückkam, ließ er sich seufzend in den Sitz fallen, rückte seinen Gürtel zurecht und schüttelte den Kopf.
„Wasserhahn kaputt. Jemand hat den Griff geklaut.“
Salome blinzelte. „Was bitte?“
„Na wirklich! Ich wollt Hände waschen – nix da. Kein Griff. Wer tut sowas? Griff vom Wasserhahn klauen!“
„Vielleicht war das so ein modernes Ding?“, schlug Salome vor und unterdrückte ein Grinsen.
„modernes Ding?“ Beso schnaufte. „Ich hab gedrückt, gepustet, sogar 'Bitte' gesagt. Der Hahn blieb stur wie unser alter Ziehbock.“
Er wedelte mit beiden Händen in der Luft, als würde er sie über einem unsichtbaren Lagerfeuer trocknen.
„Iiiiih! Du hast deine Hände nicht gewaschen?“, riss Tsilia die Augen auf und wich demonstrativ zur Seite.
„Fass mich nicht an, Beso!“
„Was denn – ich hab sie an der Hose abgewischt! Und an dem Papier da.“
Salome lachte so laut, dass der Mann im Sitz davor sich umdrehte. Es war ein älterer Herr mit grau meliertem Haar, der skeptisch die Stirn runzelte.
„Was ist denn da los?“, murmelte er und sah die kleine Familie wie Aliens auf einem fremden Planeten an.
Die ältere Dame öffnete die Bonbondose, nahm ein Bonbon heraus und hielt es Beso hin. Doch als sie seine ungewaschenen Hände sah, zog sie die Dose mit einer leicht hochgezogenen Augenbraue und einem spitzen, fast entrüsteten Mundwinkel zurück – Besos Hand griff ins Leere.
Mit einem feinen, fast aristokratischen Lächeln sagte sie: „Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihnen ein kleines bisschen etitipetiti vorkomme, aber ich bin eben eine Frau, die Wert auf etitipetiti legt.“
Beso räusperte sich verlegen, wischte hastig die Hände ab und murmelte:
„Verstanden... Hygiene.“
Toma kicherte leise:
„Papa, hier haben sogar die Bonbons ihren persönlichen Bodyguard.“
Salome schmunzelte und flüsterte:
„Willkommen in der pickfeinen Welt, Papa.“
Der Koffer, der alles enthält
Der Flughafen wirkte wie aus Glas gegossen. Leuchtschilder in Rot, Blau, Grün blitzten über ihren Köpfen, Türen zischten lautlos auf und zu, Stimmen mischten sich zu einem Summen in hundert Sprachen.
Es roch nach Parfüm, Desinfektionsmittel und etwas, das Salome nicht einordnen konnte – vielleicht Metall, vielleicht Zukunft.
Alles war zu hell, zu glatt, zu schnell.
Toma rieb sich die Augen. Beso stolperte fast über eine glänzende Begrenzung am Boden. Salome blieb einen Moment stehen, als müsste sie das alles erst ins Herz lassen.
Der Flughafen Hamburg war erfüllt von geschäftigem Treiben, fremden Sprachen und dem Klackern von Rollkoffern. Die Gelaschwilis, mit ihren geerbten, abgenutzten Koffern aus den 80ern, fielen sofort ins Auge.
Der Zollbeamte, ein korpulenter Mann mit Schnurrbart, winkte sie heraus.
„Öffnen Sie bitte die Koffer,“ brummte er auf Deutsch.
Tsilia schnappte nach Luft.
„Was soll das? Wir haben doch nichts Illegales dabei!“
Der Beamte nickte gelassen, während Beso den ersten Koffer öffnete. Zum Vorschein kamen ordentlich gestapelte Pakete Maismehl und getrockneten Käses.
„Ah, Vorräte für den Krieg?“ witzelte der Beamte und griff zu einem Vakuumpäckchen. „Oder etwa ein Souvenir?“
„Das ist unser Essen!“ empörte sich Tsilia.
„Haben Sie eine Ahnung, wie teuer Lebensmittel in Deutschland sind?“
Salome kicherte verlegen, während sie Toma zur Seite schob, der gerade versuchte, eine der Süßigkeiten zu retten.
Der nächste Koffer wurde geöffnet. Es folgten ein Stapel abgetragener Kleidung, handgeknüpfte Wollsocken und – zur Überraschung aller – ein antiker Teekessel.
„Fürs Teetrinken unterwegs?“ fragte der Beamte und zog skeptisch an der Schnur des Teekessels. Der Deckel klapperte, und ein Bündel zerknitterter Lari-Scheine purzelte heraus.
„Das ist unsere Reisekasse!“ Beso wurde rot und schnappte nach dem Geld.
„Natürlich,“ murmelte der Beamte trocken und wandte sich dem letzten Koffer zu. Er öffnete ihn langsam und zuckte überrascht zurück. Darin lag ein zerlegter, aber handgemachter Holzstuhl, sorgfältig mit Tüchern umwickelt.
„Was...?“ Der Beamte starrte fassungslos.
„Das ist ein Geschenk,“ erklärte Tsilia stolz. „Für die Deutschen. Sie sollen wissen, dass wir auch Kultur haben!“
Der Beamte schüttelte den Kopf, stempelte die Formulare ab und winkte sie durch.
„Willkommen in Deutschland. Und viel Glück!“ sagte er mit einem Lächeln.
Die Gelaschwilis marschierten weiter, jeder mit gemischten Gefühlen. Toma grinste:
„Mama, denkst du, sie mochten den Stuhl?“
Willkommen heißt nicht Zuhause
Der Hamburger Flughafen überwältigte die Gelaschwilis sofort: Menschenmassen, glänzende Böden, automatische Türen und überall blinkende Bildschirme. Mitten im Gewusel hielt eine junge Frau ein Schild hoch, auf dem in großen Buchstaben stand:
„Willkommen Gelaschwilis!“
„Das sind wir!“ rief Toma aufgeregt, doch Beso packte ihn am Arm. „Nicht so laut, wir sind nicht auf dem Basar.“
Als sie durch die automatischen Glastüren traten, kam ihnen kalte, saubere Luft entgegen. Salome blieb stehen, weil sich ihr Koffergriff verhakt hatte.
Eine Stimme sprach Deutsch in ein Funkgerät. Schuhe klackten auf glattem Boden.
Dann sah sie es: ein handgeschriebenes Schild mit ihrem Namen. Dahinter stand eine Frau mit heller Jacke, rot-blonden Haaren und einem Lächeln, das fast zu warm war für diesen Ort.
Die Frau mit dem Schild bemerkte sie und lächelte freundlich. „Hallo, ich bin Julia von der Diakonie. Sie müssen die Familie Gelaschwili sein. Willkommen in Deutschland!“
„Salome? Willkommen in Deutschland. Ich bin Julia.“ fügte sie hinzu.
Salome musterte Julia misstrauisch. Ihre saubere Kleidung, der dezente Schmuck und die sanfte Stimme wirkten wie aus einer anderen Welt. „Danke,“ murmelte sie schließlich.
Julia führte sie zu einem Kleinbus, der schon wartete. Die Türen schlossen sich mit einem leisen Zischen, und die Fahrt begann.
„Wir haben eine Übergangswohnung für Sie organisiert. Sie liegt in einem ruhigen Viertel, und es gibt Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Außerdem bekommen Sie finanzielle Unterstützung für die ersten Tage.“
„Wie viel?“, lehnte sich Beso interessiert vor.
„300 Euro pro Person“, erklärte Julia geduldig. „Das ist für Essen und Kleidung gedacht.“
„300 Euro pro Kopf?!“, schnappte Tsilia nach Luft. „Das sind fast 4.000 Lari! Damit könnten wir unser ganzes Dorf ausstatten!“
„Mama!“, stupste Salome sie vorwurfsvoll an. „Wir sind hier nicht im Dorf. Das ist anders.“
Julia lächelte nachsichtig. „Ja, das mag für Sie wenig erscheinen, aber das deutsche Sozialsystem ist sehr komplex. Wir versuchen, allen ein gutes Fundament zu geben – aber es ist nicht das gleiche wie Ihre Heimat, wo man sich eher auf Familie und Nachbarn verlässt. Hier sind wir mehr... strukturiert. Regeln, Vorschriften, und manchmal bürokratisch bis zum Erbrechen.“
Sie sah Salome an, als wolle sie ihr Mut machen: „Aber keine Sorge, wir sind für Sie da. Schritt für Schritt.“
Fahrt durch das stille Chaos
Die Fahrt vom Flughafen führte sie hinaus aus dem hellen Trubel und hinein in das große, unbekannte Deutschland. Hinter den Fenstern des Kleinbusses zog eine neue Welt vorbei: endlose Reihen von Hochhäusern, deren Glasfassaden das Licht der Abendsonne reflektierten wie flüssiges Gold.