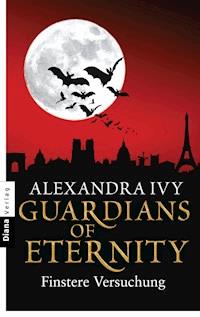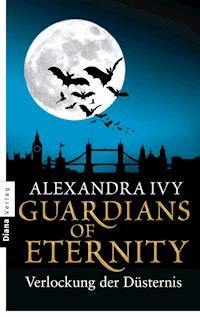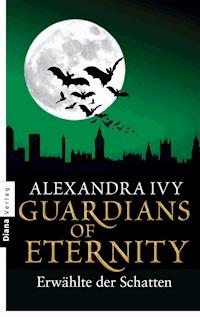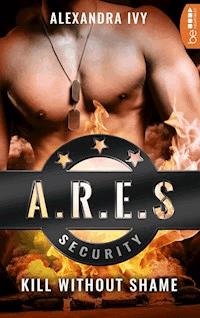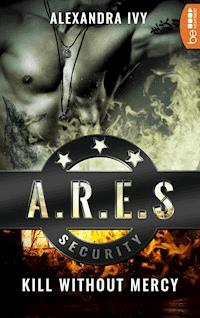
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die ARES-Reihe
- Sprache: Deutsch
Romantische Spannung von der Spiegel-Bestsellerautorin
Rafe Vargas fährt nur nach Iowa, um das Haus seines verstorbenen Großvaters auszuräumen. Zusammen mit vier Kameraden hat der Exsoldat und Spezialist für verdeckte Ermittlungen die Sicherheitsfirma ARES Security gegründet und will so schnell wie möglich zurück an die Arbeit gehen. Doch als er Annie White begegnet, kann er nicht einfach wieder verschwinden - nicht wenn ein Serienmörder junge Frauen im Visier hat und Annie wild entschlossen ist, dem Täter eigenmächtig nachzujagen. Selbst wenn sie dabei zum Opfer wird...
Der Auftakt der spannenden und prickelnden Serie der Spiegel-Bestseller-Autorin Alexandra Ivy um die fünf Männer von ARES Security. Sie sind tough, kompromisslos und würden alles für die Frauen an ihrer Seite geben.
eBook von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert!
Die ARES-Serie:
Nach Monaten in Gefangenschaft werden fünf Spezialeinsatzkräfte der Armee vom Dienst suspendiert und nach Hause geschickt. Um sich abzulenken gründen sie eine Sicherheitsfirma für unmögliche Fälle. Jeder von ihnen ist einschüchternd. Aber gemeinsam sind sie unschlagbar: Die fünf Männer von ARES Security.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Serie
Über den Roman
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Epilog
Leseprobe
Über die Serie
Nach Monaten in Gefangenschaft werden fünf Spezialeinsatzkräfte der Armee vom Dienst suspendiert und nach Hause geschickt. Um sich abzulenken gründen sie eine Sicherheitsfirma für unmögliche Fälle. Jeder von ihnen ist einschüchternd. Aber gemeinsam sind sie unschlagbar: Die fünf Männer von ARES Security.
Über den Roman
Rafe Vargas fährt nur nach Iowa, um das Haus seines verstorbenen Großvaters auszuräumen. Zusammen mit vier Kameraden hat der Ex-Soldat und Spezialist für verdeckte Ermittlungen die Sicherheitsfirma ARES Security gegründet und will so schnell wie möglich zurück an die Arbeit gehen. Doch als er Annie White begegnet, kann er nicht mehr einfach verschwinden – nicht, wenn ein Serienmörder junge Frauen im Visier hat und Annie wild entschlossen ist, dem Täter eigenmächtig nachzujagen. Selbst wenn sie dabei zum Opfer wird …
Dies ist der Auftakt einer neuen Serie der Spiegel-Bestseller-Autorin Alexandra Ivy um die fünf Männer von ARES Security. Freut euch schon auf Band zwei »Kill without Shame« – bald als eBook bei beHEARTBEAT.
Über die Autorin
Alexandra Ivy ist das Pseudonym der bekannten Regency-Liebesroman-Autorin Deborah Raleigh. Mit ihrer international erfolgreichen Guardians-of-Eternity-Reihe stürmte sie die SPIEGEL-Bestsellerliste und baute sich eine große Fangemeinde auf. Mit »ARES-Security« startet die Autorin eine neue Erfolgsserie über fünf Bände. Alexandra Ivy lebt mit ihrer Familie in Missouri.
ALEXANDRA IVY
Kill without Mercy
Aus dem Amerikanischenvon Beate Darius
beHEARTBEAT
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Debbie Raleigh
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP. 119 West 40th Street, NEW YORK, NY 10018 USA
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Kill without Mercy«
Originalverlag: Zebra books
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.deunter Verwendung von Motiven ©thinkstock: Ibrakovic | gemenacom
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-3412-8
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »ARES Security – Kill without Shame« von Alexandra Ivy.
Für die Originalausgabe: Copyright © 2017 by Debbie Raleigh
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Kill without Shame«
Originalverlag: Zebra books
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzung: Beate Darius
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Nur wenige verstanden wirklich, was »die Hölle auf Erden« bedeutete.
Die fünf Soldaten allerdings, die im Taliban-Gefängnis im Süden Afghanistans festgehalten worden waren, hatten sie im wahrsten Sinne des Wortes erlebt. Fünf Wochen brutaler Folter reichten aus, einem Mann beizubringen, dass es schlimmere Dinge gab als den Tod.
Es hätte sie brechen sollen. Selbst abgebrühte Soldaten, die dem härtesten Drill unterworfen gewesen waren, konnten unter dem dauernden psychischen und körperlichen Terror zusammenbrechen. Stattdessen heizte die Folter lediglich ihre kompromisslose Entschlossenheit an, ihren Peinigern zu entkommen.
In den dunklen Nächten schlossen sie sich zusammen.
Rafe Vargas, ein Spezialist für verdeckte Operationen. Max Grayson, ausgebildet auf dem Gebiet der Forensik. Hauk Laurensen, Scharfschütze und Waffenexperte. Teagan Moore, Computergenie. Und Lucas St. Clair, der sprachgewandte Geiselunterhändler.
Die Verbindung zwischen ihnen ging über Freundschaft hinaus. Sie waren eine Familie, ihr Zusammenhalt die grimmige Entschlossenheit zu überleben.
Kapitel eins
Freitagnacht in Houston – das bedeutete überfüllte Kneipen, laute Musik und eiskaltes Bier. Es war eine Tradition, die Rafe und seine Freunde schnell angenommen und ihrem eigenen Geschmack angepasst hatten, als sie vor fünf Monaten nach Texas gezogen waren. Schließlich war keiner von ihnen scharf auf die Dancefloor-Szene. Sie waren zu alt für halb nackte Studentinnen und zufällige One-Night-Stands. Und keiner von ihnen hatte Lust, über dröhnende Beats zu brüllen, um sich vernünftig zu unterhalten.
Stattdessen hatten sie The Saloon gefunden, eine kleine, gemütliche Bar mit jeder Menge poliertem Holz, einer Jazzband, die leise im Hintergrund spielte, und ein paar Einheimischen, die unter den anderen Gästen nicht weiter auffielen. Oh, und dort gab es den besten Tequila der Stadt. Sie hatten sogar ihren eigenen Tisch, der jeden Freitagabend für sie reserviert war. In einer Ecke im hinteren Teil stand er im Halbdunkel der schummrigen Beleuchtung und weit weg von der Bar, die die Länge einer Wand einnahm. Es war der perfekte Platz, um das Geschehen zu beobachten, ohne selber beobachtet zu werden. Und das Beste von allem: Er stand so, dass sich keiner von hinten anschleichen konnte.
Es mochte beinahe zwei Jahre her sein, seit sie aus dem Krieg zurückgekehrt waren, aber keiner von ihnen hatte vergessen, was sie damals durchgemacht hatten. Die eigene Deckung zu vernachlässigen – selbst für eine Sekunde – konnte den Tod bedeuten.
Lektion. Gelernt.
Heute Abend saßen jedoch nur Rafe und Hauk an dem Tisch, beide tranken Tequila und knabberten Erdnüsse aus einer kleinen Schale. Lucas war noch in Washington D.C. und bearbeitete seine Kontakte, die Werbetrommel für ihre neu gegründete Sicherheitsfirma ARES zu rühren. Max war in den frisch angemieteten Büros geblieben, um seinem kostbaren Forensiklabor den letzten Schliff zu geben, und Teagan war auf dem Weg in die Bar, nachdem er ein Computersystem installiert hatte, das bei Homeland Security einen kollektiven Herzinfarkt auslösen würde, wenn sie davon erführen.
Rafe lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, entschlossen, an diesem Abend zu relaxen, nachdem er sich eine ganze Woche mit nervigen Formalitäten herumgeschlagen hatte, was bei der Gründung eines neuen Unternehmens nicht ausblieb. Leider machte er den Fehler, seine SMS-Nachrichten zu checken.
»Fuck.« Er warf sein Handy auf die polierte Platte des Holztischs, seine Stimmung sank gegen null. Auf der anderen Seite des Tisches trank Hauk seinen Tequila und beobachtete Rafe mit hochgezogenen Brauen.
Auf den ersten Blick hätten die beiden Männer nicht unterschiedlicher sein können. Rafe hatte dunkle Haare, die so lang waren, dass sie den Kragen seines weißen Button-down-Hemds berührten, und dunkle, von langen schwarzen Wimpern umrahmte Augen. Er war noch immer tiefbraun, obwohl es schon Ende September war, und sein Körper war mit Muskeln bepackt, die von der Arbeit auf der kleinen Ranch stammten, die er gerade gekauft hatte, und nicht vom Fitnessstudio.
Hauk dagegen hatte das hellblonde Haar seines skandinavischen Vaters geerbt, das er kurz geschnitten trug, und strahlend blaue Augen, in denen eine scharfe Intelligenz lag. Er hatte ein schmales Gesicht mit gut geschnittenen Zügen, die für gewöhnlich ernst waren.
Es war aber nicht nur ihr Äußeres, das sie so verschieden machte. Rafe war impulsiv, leidenschaftlich und vertraute häufig auf seinen Instinkt. Hauk war introvertiert, berechnend und krankhaft ordentlich. Nicht dass er zugeben würde, leicht zwangsneurotisch zu sein. Hauk bezeichnete sich selber gern als detailorientiert. Und genau das machte ihn zu einem so hervorragenden Scharfschützen.
Rafe wiederum war in Kampfrettung ausgebildet worden. Er besaß die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen und Strategien in Sekundenbruchteilen anzupassen.
»Ärger?«, fragte Hauk.
Rafe verzog das Gesicht. »Die Maklerin hat eine Nachricht hinterlassen, dass sie einen Käufer für das Haus von meinem Großvater hat.«
Wie nicht anders zu erwarten, traf ihn Hauks verständnisloser Blick. Seit dem Tod des alten Herrn vor einem Jahr hatte Rafe sich ständig darüber ausgelassen, dass er das Haus seines Großvaters loswerden müsse.
»Sollte das nicht eine gute Nachricht sein?«
»Das wäre es, wenn ich nicht nach Newton fahren müsste, um die Bude zu entrümpeln«, entgegnete Rafe.
»Gibt’s da keine Leute, die du beauftragen kannst, dass sie den Mist zusammenpacken und dir herschicken?«
»Nicht mitten im verdammten Nirgendwo.«
Hauks Lippen verzogen sich zu einem humorlosen Grinsen. »Ich bin mitten im verdammten Nirgendwo gewesen, und das war ganz bestimmt nicht Kansas«, sagte er, sein Blick dunkel von den Schatten der Vergangenheit.
»Newton ist in Iowa, aber ich weiß, was du sagen willst«, räumte Rafe ein. Er bemühte sich, die Erinnerungen in der Vergangenheit zu lassen, wo sie hingehörten. Meistens gelang ihm das. Manchmal weigerten sich die Dämonen, sich an die Kette legen zu lassen. »Okay, es ist nicht das Höllenloch, aus dem wir rausgekrochen sind, aber irgendwie leben dort alle hinter dem Mond. Ich werde selber hinfahren und mich um den Kram von meinem Großvater kümmern müssen.«
Hauk griff nach der Flasche auf dem Tisch, die sie bei ihrem Eintreffen bereits erwartet hatte, um sich noch ein Glas Tequila einzugießen. Wie Rafe trug er ein legeres Hemd, allerdings war seines blau und nicht weiß, und dazu eine schwarze Stoffhose statt einer Jeans.
»Ich weiß, für dich ist es nervig, aber so ist es vermutlich die beste Lösung.«
Rafe funkelte seinen Freund an. Das Letzte, was er wollte, war, tausend Meilen zu fahren, um den Krempel eines streitsüchtigen Alten zusammenzupacken, der es Rafes Vater nie verziehen hatte, dass er aus Iowa fortgegangen war. »Versuchst du, mich loszuwerden?«
»Teufel, nein. Von uns fünfen bist du der …«
»Ich will’s gar nicht so genau wissen«, knurrte Rafe, als Hauk abbrach.
»Der Kitt«, sagte sein Freund schließlich.
Rafe lachte bitter auf. Er war über die Jahre eine Menge Dinge genannt worden. Das meiste unwiederholbar. Aber Kitt war mal was Neues. »Was zur Hölle heißt das jetzt wieder?«
Hauk lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Lucas ist der Redenschwinger, Max ist das Herz, Teagan der Denker, und ich bin der Organisator.« Rafe zuckte mit den Achseln. »Du bist derjenige, der uns zusammenhält. ARES wäre nie zustande gekommen ohne dich.«
Dem konnte Rafe nicht widersprechen. Nach ihrer Rückkehr in die Staaten waren die fünf in unterschiedliche Krankenhäuser eingewiesen worden, um ihre zahllosen Verletzungen zu behandeln. Es wäre ein Leichtes gewesen, sich aus den Augen zu verlieren. Der natürliche Instinkt war, alles zu vermeiden, was sie an den Horror erinnern könnte, den sie durchlebt hatten.
Aber Rafe hatte schnell entdeckt, dass die Rückkehr ins Zivilleben nicht bloß darin bestand, ein Haus zu kaufen und einen Nine-to-five-Job anzunehmen. Die Vorstellung, den ganzen Tag in einem Büro eingesperrt zu sein oder in eine leere Wohnung zurückzukehren, die nie ein Heim sein würde, war ihm unerträglich. Das fühlte sich irgendwie zu sehr nach dem Gefängnis an, dem er mit letzter Not entkommen war.
Außerdem hatte er gemerkt, dass er die Jungs tatsächlich vermisste. Wer sonst könnte seine Frustrationen verstehen? Seine Unfähigkeit, die banalen Probleme von Zivilisten zu begreifen? Seine ständigen Albträume?
Also hatte er einem Impuls nachgegeben und Lucas angerufen. Er hatte gewusst, dass er dessen dicke Brieftasche brauchen würde, um seinen verrückten Plan zu finanzieren. Erstaunlicherweise hatte Lucas nicht einen Moment gezögert, sondern direkt zugesagt. Das Gleiche galt für Hauk, Max und Teagan. Sie alle hatten nach etwas gesucht, das nicht nur ihre umfassenden Fähigkeiten erforderte, sondern das ihnen auch das Gefühl gab, nicht aufs Abstellgleis geschoben zu werden wie ausgediente Veteranen.
Und so war ARES aus der Taufe gehoben worden.
Rafe schüttelte den Kopf bei dem bloßen Gedanken daran, seine Freunde im Stich zu lassen, jetzt da sich ihr Traum endlich erfüllen würde. »Wieso schlägst du mir vor, die Stadt zu verlassen, wo wir so kurz davorstehen, unseren Laden aufzumachen?«
»Weil er dein Großvater war.«
»Schwachsinn.« Rafe schnaubte abfällig. »Der Idiot hat meinen Vater im Stich gelassen, als er der Armee beigetreten ist. Er hat nie einen verdammten Finger für uns gerührt.«
»Und genau deshalb musst du fahren«, insistierte Hauk. »Du musst …«
»Sag jetzt ›einen Schlussstrich ziehen‹, und ich verpass dir eine«, unterbrach Rafe ihn. Er schnappte sich sein Glas und kippte den Tequila in einem Zug herunter.
Hauk ignorierte die Drohung mit der ihm üblichen Arroganz. »Nenn es, wie du willst, aber solange du dem alten Mann nicht verzeihst, wie er mit deinem Vater umgesprungen ist, trägst du das immer mit dir rum.«
Rafe zuckte die Schultern. »Und wenn schon.«
Unvermittelt lehnte Hauk sich vor. Seine Miene war ernst. »Rafe, es dauert ohnehin noch ein paar Wochen, bis wir loslegen können. Erledige deinen Kram und komm zurück, wenn du damit fertig bist.«
Rafes Augen wurden schmal. Es war kein Wunder, dass Hauk ihn bedrängte, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Tief im Herzen wusste er, dass sein Freund recht hatte.
Gleichzeitig konnte er die Schärfe in Hauks Stimme hören, die ihn argwöhnen ließ, dass mehr dahintersteckte als nur der Wunsch, Rafe sollte mit seinen Ressentiments gegenüber seinem Großvater aufräumen. »Was verschweigst du mir?«
»Fuck, es gibt tausend Dinge, die ich dir nicht erzähle«, ätzte Hauk. Ironisch grinsend hob er sein Glas. »Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.«
Ein klassisches Ablenkungsmanöver. Seine Handflächen auf den Tisch gestemmt, neigte Rafe sich vor. »Du nervst.« Seine Stimme war hart, warnend. »Los, spuck’s aus.«
»Du bist echt so was von penetrant.« Hauks Grinsen verschwand. »Also gut. Auf meinem Schreibtisch lag eine weitere Notiz.«
Rafe atmete scharf ein.
Die erste Notiz war wenige Tage, nachdem sie in Houston eingetroffen waren, aufgetaucht. Sie hatte in Hauks Wagen gelegen, mit einer unterschwelligen Warnung, dass er beobachtet werde. Sie hatten das als dummen Streich abgetan. Dann, einen Monat später, klebte eine zweite Nachricht an der Eingangstür der Büroetage, die sie kurz zuvor angemietet hatten. Auf dieser hatte gestanden, dass die Uhr tickte.
Wieder hatte Hauk versucht, so zu tun, als wäre an der Sache nichts dran, aber Teagan hatte sofort das modernste Alarmsystem installiert, während Lucas seinen geballten Charme und seine persönlichen Kontakte bei der örtlichen Polizei eingesetzt hatte, um die Jungs zu überreden, ein Auge auf das Gebäude zu haben.
»Was soll der Mist?«, stieß Rafe zwischen aufeinandergepressten Kiefern hervor, eine Gänsehaut kroch über seinen Rücken. Er hatte ein wirklich, wirklich schlechtes Gefühl bei diesen Drohbriefen. »Hast du das Sicherheitssystem gecheckt?«
»Mensch, verflucht«, meinte Hauk gedehnt. »Wieso bin ich nicht darauf gekommen?«
»Kein Grund, den Klugscheißer raushängen zu lassen.«
Hauk leerte sein Glas Tequila in einem Zug. »Aber das kann ich verdammt gut.«
»Ohne Scheiß.«
Hauk schob sein leeres Glas beiseite und fing Rafes besorgten Blick auf. »Hey, alles, was man machen kann, haben wir gemacht. Teagan hat sich in die Videoüberwachung eingehackt. Wenn unser Besucher kein Geist ist, wird er irgendwann beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes entdeckt. Max untersucht die Nachricht mit seinem forensischen Voodoozauber, und Lucas hat die lokalen Cops auf die benachbarten Unternehmen angesetzt, ob denen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen ist.«
»Das gefällt mir nicht, Hauk.«
»Ist vermutlich irgendein durchgeknallter Idiot, dem ich auf den Sack gegangen bin«, versicherte sein Freund. »Nicht jeder findet mich so umwerfend wie du.«
Rafe entwich ein kurzes, freudloses Lachen. Hauk war intelligent, absolut loyal und der geborene Führer. Er konnte aber auch kalt, arrogant und zum Kotzen rechthaberisch sein. »Kaum zu glauben.«
»Ja, nicht wahr?« Hauk klimperte mit den Wimpern. »Dabei bin ich so ein Schatz.«
»Du kannst ein Arschloch sein, aber außer mir hat keiner das Recht, dir zu drohen«, meinte Rafe. »An diesen Drohungen ist irgendetwas … faul.«
Hauk griff nach der Flasche, um sich einen weiteren Schnaps einzugießen, seine Züge zu einer stummen Warnung verhärtet, dass er mit der Diskussion abgeschlossen hatte. »Wir haben die Sache im Griff, Rafe. Fahr nach Kansas.«
»Iowa.«
»Auch egal.« Hauk schnappte sich das Handy vom Tisch und drückte es Rafe in die Finger. »Kümmer dich um das Haus.«
Rafe stand widerwillig auf. Er konnte argumentieren, bis er schwarz wurde, Hauk würde mit den Drohbriefen auf seine Weise verfahren.
»Ruf mich an, wenn du mich brauchst.«
»Ja, Mutter.«
Rafe verdrehte kurz die Augen, ehe er sich durch die Menge schob, die die Bar füllte. Er ignorierte die einladenden Blicke der Frauen, die ihm wie zufällig in den Weg traten. Er war zwar ein Mann und wusste das Angebot durchaus zu schätzen. Doch nach seiner Rückkehr in die Staaten hatte er gemerkt, dass ihn die Aussicht auf ein flüchtiges Abenteuer kaltließ. Er konnte nicht in Worte fassen, wonach er suchte, nur, dass er es – oder sie – bisher noch nicht gefunden hatte.
Rafe hatte gerade die Tür erreicht, als er auf Teagan traf, der die Kneipe betrat. Der große, muskelbepackte Mann mit dem dunklen Teint, den goldgesprenkelten Augen und den schädelkurz rasierten Haaren sah nicht aus wie ein Computerfreak. Zum Henker, er sah aus, als wäre er Mitglied in der örtlichen Biker-Gang. Und nicht bloß, weil seine Arme mit Tattoos bedeckt waren oder weil er eine Tarnhose und lederne Armeestiefel trug.
Es lag an der Aura von Gewalt, die ihn umgab, und seinem Leg dich nicht mit mir an!-Gesichtsausdruck.
Zugegeben, er war mit dreizehn in den Jugendknast gewandert, weil er sich in eine Bank eingehackt hatte, um den Autokredit seiner Mutter verschwinden zu lassen. Demnach war er nie der klassische Nerd gewesen.
»Ich mach mich vom Acker.«
»So früh?« Teagan spähte in die Menge, die zunehmend lauter wurde. »Die Party fängt doch gerade erst an.«
»Das nächste Mal«, antwortete Rafe. »Ich fahr für ein paar Tage weg.«
»Business?«
»Familie.«
»Fuck«, knurrte Teagan.
Der Mann sprach selten über seine Vergangenheit, aber er hatte nie ein Geheimnis aus der Tatsache gemacht, dass er seinen Vater tief verabscheute. Der hatte seine Mutter fast zu Tode geprügelt, bevor er sie beide verließ.
»Du sagst es«, bekräftigte Rafe. Er neigte sich dicht zu seinem Freund, um nicht von Dritten belauscht zu werden. »Hab mal ein Auge auf Hauk. Ich glaube nicht, dass er die Drohungen ernst genug nimmt.«
»Hast du was im Gefühl?«, wollte Teagan wissen.
Rafe nickte, noch jedes Mal verblüfft, wie locker seine Freunde mit seinem Bauchgefühl umgingen. »Wenn man es auf ihn abgesehen hätte, würden sie ihm keine Warnung schicken«, erklärte er. »Erst recht nicht, wenn er von Freunden umgeben ist, die Experten darin sind, Feinde aufzuspüren und zu vernichten.«
Teagan nickte. »Das ist wahr.«
»Also entweder hat der Bastard Todessehnsucht, oder er spielt Katz-und-Maus.«
»Welchen Grund könnte er dafür haben?«
Rafe hatte keinen blassen Schimmer. Aber man provozierte einen so gefährlichen Mann wie Hauk nicht, es sei denn, man war auf die unvermeidliche Konsequenz vorbereitet.
Einer von ihnen würde sterben.
Rafe reagierte mit einem heftigen Kopfschütteln. »Wir wollen hoffen, dass der Schuldige im Knast sitzt, wenn wir es herausfinden. Andernfalls …«
»Hauk wird schon nichts passieren, Mann.« Teagan packte Rafe an der Schulter. »Nicht solange ich auf ihn aufpasse.«
***
Die kleine, aber stylishe Eigentumswohnung am Rande von Denver bot eine ruhige Nachbarschaft, einen fantastischen Blick auf die Berge und eine Garage, die während der langen, schneereichen Winter Gold wert war. In gedämpften Blautönen gehalten und mit viel Stahl war das Apartment genau die Art Umfeld, wo man eine sozial aufstrebende junge Akademikerin vermutete.
Nicht dass Annie White sozial aufstrebend war.
Nicht nachdem sie ihre Position bei Anderson’s Accounting schon nach sechs Monaten aufgegeben hatte.
Im Augenblick gab sie nämlich einen Scheißdreck auf ihre Zukunft in der Businesswelt. Stattdessen versuchte sie, sich aufs Packen zu konzentrieren. Eine Aufgabe, die leichter gewesen wäre, hätte ihre Pflegemutter sie nicht auf Schritt und Tritt verfolgt, händeringend und das Schlimmste heraufbeschwörend.
»Ich wünschte, du hättest die weite Reise nicht gemacht, Katherine«, sagte Annie zu ihrer Pflegemutter auf dem Weg vom Schlafzimmer in den Wohnraum, um einen Stapel saubere Unterwäsche in ihrem geöffneten Koffer zu verstauen.
Die Angesprochene war ihr dicht auf den Fersen. Mit Mitte fünfzig immer noch eine attraktive Frau, hatte Katherine Lowe von weißen Fäden durchzogenes rotes Haar, das am Hinterkopf zu einem festen Knoten hochgesteckt war, und klare grüne Augen, die Freundlichkeit verströmen oder ein Kind schuldbewusst zusammenzucken lassen konnten.
Sie trug einen jadegrünen Pulli über einer Bundfaltenhose, und ihr schmales Gesicht war angespannt vor Sorge. »Was erwartest du, wenn du mich anrufst und sagst, dass du an diesen entsetzlichen Ort zurückkehren willst?«, gab Katherine zurück.
Annie verschluckte ein Seufzen. Anders als bei ihrer Pflegemutter lockten sich ihre honigbraunen Haare ungebändigt um ihre Schultern, die goldenen Highlights schimmernd in der Septembersonne, das durch das Oberlicht hereinfiel. Ihr blasses Gesicht war frisch und natürlich, ohne einen Hauch Make-up, und ihr schlanker Körper war leger in verwaschene Jeans und ein graues Sweatshirt gekleidet. Mit ihren großen haselnussbraunen Augen schien sie kaum alt genug, den Highschool-Abschluss in der Tasche zu haben, geschweige denn ein Diplom als studierte Wirtschaftsprüferin.
»Ich hätte nicht anrufen sollen«, murmelte sie.
Sie liebte ihre Pflegeeltern. Sie liebte sie wirklich. Es gab nicht viele Menschen, die die zehnjährige Tochter eines Serienmörders bei sich aufgenommen hätten. Besonders nachdem sie mehrere Monate in einer psychiatrischen Einrichtung verbracht hatte. Sie hatten ihr nicht nur eine feste Bleibe auf ihrer Ranch in Wyoming gegeben, sie hatten ihr auch Schutz vor einer Welt geboten, die unersättlich neugierig auf die einzige Überlebende des Newton-Schlächters war. Jetzt wünschte sie sich allerdings, ihre Pflegemutter würde nicht so viel Aufhebens machen.
»Dachtest du, ich würde es nicht herausfinden?«, echauffierte sich Katherine.
Annie zog eine Grimasse. Sie versuchte, die Tatsache zu ignorieren, dass sie, seit sie von der Ranch weggezogen war, auch weiterhin tagtäglich von ihren Pflegeeltern überwacht wurde. Sei es durch abendliche Anrufe oder indem sie sich bei Annies Boss, Mr Anderson, erkundigten, der zufällig ein Freund ihres Pflegevaters war. Sie wollten sich bloß vergewissern, dass mit ihr alles okay war.
»Ich will nicht, dass ihr euch Sorgen macht«, sagte Annie.
Katherine deutete auf den aufgeklappten Koffer. »Dann überleg dir noch mal, ob du wirklich so überstürzt wegwillst.«
Annie ging ins Bad, um ihre Kosmetik zusammenzupacken, und kämpfte damit, ihre Züge zu einer undurchschaubaren Maske zu glätten. Alles in allem betrachtet hatten ihre Pflegeeltern sie immer unterstützt. Sie hatten Annie angehalten, über ihre Vergangenheit zu sprechen, mit ihnen und nicht zuletzt auch mit einer erfahrenen Therapeutin. Sie hatten ihr sogar erlaubt, ein Bild ihres Vaters neben ihrem Bett aufzustellen, trotz der Grausamkeiten, die er begangen hatte. Lediglich eine Sache weigerten sie sich zu akzeptieren, und das war Annies Behauptung, sie habe Visionen der Morde gehabt, während sie verübt wurden.
Damit waren sie nicht allein.
Niemand hatte geglaubt, dass die unheimlichen Bilder, die Annie verfolgt hatten, mehr waren als Auswüchse ihrer überbordenden Fantasie. Über die Jahre hatte Annie versucht, sich selbst zu überzeugen, dass sie recht hatten. Es war verrückt zu denken, ihr Vater und sie wären irgendwie mental verbunden gewesen, während er die Morde beging.
Oder?
Dann, vor zwei Nächten, waren die Visionen zurückgekehrt.
Die Bilder waren bruchstückhaft gewesen. Eine schreiende Frau. Ein dunkler, enger Raum. Das Aufblitzen einer Messerklinge im Mondlicht. Der öffentliche Platz von Newton.
Annie bemühte sich nicht einmal, die Visionen zu verdrängen. Entweder verlor sie den Verstand – oder sie waren real. Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, war, in die Stadt zurückzukehren und sich ihren Albträumen zu stellen.
»Es ist nicht überstürzt«, meinte sie, als sie in den Wohnraum zurückkehrte. »Ich hab mir das reiflich überlegt.«
Katherine ließ ein ungeduldiges Schnauben hören. »Und was wird aus deiner Position bei Anderson’s Accounting?«
»Es ist möglich, dass sie den Job für mich freihalten«, sagte Annie, mental ihre Finger kreuzend.
Das war nicht ganz gelogen. Ihr Vorgesetzter hatte gesagt, dass sie es sich möglicherweise noch einmal überlegten, sie nach ihrer Rückkehr wiedereinzustellen.
»Ist dir bewusst, wie viele Hebel Douglas in Bewegung setzen musste, um dir eine Stelle in so einer renommierten Firma zu besorgen?«, fragte Katherine erkennbar unversöhnlich. »Bei dieser Wirtschaftslage ist es fast aussichtslos, irgendwas Interessantes für Berufseinsteiger zu finden.«
Annie schwenkte herum und fasste die Hände ihrer Pflegemutter. Sie wusste, sie sollte sich schlecht fühlen, weil sie ihren Job hatte sausen lassen. Es war schließlich, was sie gelernt hatte, oder? »Und ich weiß zu schätzen, was er alles für mich getan hat«, versicherte sie der älteren Frau. »Was ihr beide für mich getan habt.«
Katherine schnalzte mit der Zunge. »Wenn das stimmte, würdest du nicht alles wegwerfen, bloß wegen dieser verrückten Idee.«
»Es ist mir klar, dass du das nicht verstehst, aber es ist etwas, das ich tun muss.«
Katherine zog ihre Hände fort, sichtlich verärgert über Annies seltene Weigerung, sich ihrer mütterlichen Autorität zu beugen. »Nichts kann die Vergangenheit ändern«, sagte sie hart.
Annie drehte sich um und strich unnötigerweise die Jeans glatt, die sie eben in den Koffer gelegt hatte. Hier ging es nicht um die Vergangenheit. Die Visionen waren keine Erinnerungen. Sie waren flüchtige Einblicke in die Gegenwart.
»Weiß ich doch«, murmelte sie.
»Bist du dir da sicher?«, bohrte Katherine nach.
»Natürlich.«
Längeres Schweigen folgte, als wenn sich die ältere Frau die beste Angriffsstrategie überlegte. Katherine Lowe war eine wundervolle Frau, aber sie war eine Meisterin der Manipulation. »Hat es mit dem Datum zu tun?«, wollte sie schließlich wissen.
Der Gedanke war Annie auch schon gekommen. In ein paar Tagen wären es genau fünfzehn Jahre, seit das Morden begonnen hatte. Wer könnte ihr verübeln, dass sie von Halluzinationen gequält wurde? Doch ihr Herz sagte ihr, dass es mehr war als das. »Ich glaube nicht«, meinte sie ausweichend.
Katherine presste ihre Handflächen aneinander, ein sicheres Zeichen, dass sie versuchte, ruhig zu bleiben. »Vielleicht solltest du mit deiner Therapeutin reden.«
»Nein.«
»Aber …«
»Ich brauche keinen Therapeuten«, sagte Annie mit ungewöhnlich harter Stimme. Was in ihrem Kopf vorging, ließ sich nicht heilen, indem sie in irgendeinem Behandlungsraum saß und redete. Sie musste fahren und sich selber ein Bild von dem Ganzen machen.
Katherine, die zu begreifen schien, dass sie Annie nicht dazu bewegen konnte, ihre Pläne aufzugeben, funkelte ihre Pflegetochter mit einer Gereiztheit an, die ihre Besorgnis nicht gänzlich verschleierte. »Was hoffst du denn zu finden?«
Annie fuhr zusammen.
Über diese Frage wollte sie nicht nachdenken. Nicht wenn die Antwort lautete, dass sie nicht bei Verstand war. Oder, schlimmer noch, dass ein Killer frei herumlief. »Ich muss einfach wissen, dass …« Ihre Stimme verlor sich.
»Was?«
»Dass es vorbei ist«, hauchte sie. »Wirklich und wahrhaftig vorbei.«
Ein entsetzter Ausdruck weitete Katherines Pupillen. »Wovon redest du? Natürlich ist es vorbei. Dein Vater …« Die ältere Frau bekreuzigte sich hastig, als wollte sie einen bösen Geist abwehren. »… ist tot, Gott möge ihm vergeben. Brauchst du noch mehr Beweise?«
Annie schüttelte den Kopf. »Ich kann es nicht erklären.«
Katherine legte mit betroffener Miene ihre Hand auf Annies Arm. »Weißt du, wie viele Nächte ich aufgewacht bin, weil ich dich schreien gehört habe?«
Annie biss sich auf die Unterlippe. Niemand hätte über die Jahre geduldiger sein können, während Annie darum gekämpft hatte, von dem Trauma geheilt zu werden, das sie durchlebt hatte. Das Letzte, was sie wollte, war, Katherine oder Douglas noch mehr Sorgen zu machen. »Es tut mir leid.«
»Oh Annie.« Katherine zog sie in ihre Arme, umhüllte Annie mit dem vertrauten Duft von Chanel No. 5. »Ich möchte bestimmt nicht, dass du dich schlecht fühlst. Ich will bloß nicht, dass die Albträume zurückkehren.«
»Das sind sie bereits«, flüsterte Annie, ihren Kopf an die Schulter ihrer Pflegemutter gelehnt. »Deshalb muss ich ja fahren.«
Kapitel zwei
Das kleine Café auf der Nordseite vom Town Square hatte ein großes Frontfenster, auf dem der Name Granny’s Home Cooking gemalt stand.
Rafe wusste nicht, ob es dort tatsächlich eine Großmutter gab, die hinter dem Herd stand, aber das Restaurant sah aus, als wäre es schon so lange an diesem Platz, dass die ursprüngliche Granny längst verstorben sein musste. Der wellige, gerissene Linoleumboden stammte noch original aus den Fünfzigern, darauf standen Aluminiumtischchen mit Resopaltischplatten. Die abgehängte Decke war zu einem hässlichen Gelbton ausgeblichen, und das Licht der Neonröhren flackerte so hektisch, als drohte jeden Moment der Totalausfall. Trotz des Fehlens von Lifestyle oder irgendeiner Einhaltung grundlegender Hygienevorschriften war das Essen immerhin halbwegs genießbar, und der Kaffee war heiß und schwarz, so wie er ihn mochte.
Eine gute Sache, nachdem seine Hoffnung, mit der Entrümpelung bei seinem Großvater in ein, zwei Tagen fertig zu sein, in der Sekunde geplatzt war, als er das kleine Haus betreten hatte. Zur Hölle, er hatte es kaum geschafft, die Eingangstür aufzudrücken, ohne die Kisten umzustoßen, die sich vom Boden bis zur Decke stapelten. Zu allem Überfluss gab es auch noch eine Garage und zwei Außengebäude, die ähnlich vollgestellt waren.
Sein erster Impuls war, den ganzen Müll in den Container zu werfen, der gleich nach seiner Ankunft angeliefert wurde. Der alte Mann hatte bestimmt nichts Wertvolles. Das meiste von dem Mist sah aus, als käme es von den örtlichen Flohmärkten. Trotzdem wäre es seinem Vater bestimmt wichtig gewesen, wenn er ein paar Familienfotos oder Andenken aufhob. Also nahm er die nervige Aufgabe auf sich, wirklich jede einzelne Kiste durchzugehen. Was bedeutete, dass er für mindestens eine Woche in Newton festsaß, wenn nicht zwei.
Als er mit seinem French Toast fertig war und auf einen Kaffee-Refill wartete, bemerkte er, wie die Kellnerin, eine Frau mittleren Alters, bei einem Gast stehen blieb. Die junge Frau war hereingekommen und hatte sich an den Tisch gleich neben der Wand gesetzt, während er beschäftigt gewesen war, die Mitteilungen auf seinem Handy zu checken.
Aber … hallo. Wie hatte er eine solche Frau übersehen können, zumal sie bloß ein paar Schritte entfernt saß? Er war kein hormongesteuerter Teenager mehr, aber verdammt, er war nicht tot.
Auf seine Ellbogen gestützt, betrachtete er ihr vollkommenes, etwas blasses Gesicht, das von einer Fülle windzerzauster brauner Haare umrahmt wurde. Nein, Moment mal. Nicht braun. Es war eine aufregende Mischung von Farben. Wie Honig, Gold und Sonnenlicht. Ihre Augen waren groß und dicht bewimpert, allerdings konnte er deren Farbe nicht exakt bestimmen, und ihr Mund hatte einen so üppigen Schwung, dass ein Mann spontan an das Vergnügen dachte, wenn diese Lippen diverse Teile seines Körpers erforschten. Sie war keine perfekte Schönheit, aber ihre ganze Erscheinung war ein umwerfendes Paket, und er fühlte sich unwiderstehlich zu ihr hingezogen. Das war ihm seit Langem nicht mehr passiert.
Die warnende Stimme in seinem Hinterkopf ausblendend, dass ihm keine Zeit für Ablenkungen blieb – Verlockung hin oder her –, lehnte Rafe sich auf seinem Stuhl zurück. Er beobachtete, wie die Kellnerin, auf deren Namensschild »Frances« stand, eine laminierte Menükarte vor der jungen Frau hinlegte.
»Sind Sie länger in der Stadt?«, wollte Frances wissen. Sie war stämmig gebaut, ihr kurzes Haar von grauen Strähnen durchzogen.
Rafe hob die Augenbrauen.
Demnach war die Beauty keine Einheimische.
»Kommt drauf an.« Die Frau schnappte sich die Karte und vertiefte sich demonstrativ darin, als hoffte sie, die aufdringliche Bedienung würde den Wink kapieren und verschwinden.
Rafe hätte ihr den Tipp geben können, dass sie ihre Zeit verschwendete. Frances war eine recht sympathische Person, aber sie kannte keine Scheu, in den Privatangelegenheiten ihrer Gäste herumzuschnüffeln. »Besuchen Sie Verwandte?«, bohrte die ältere Frau nach.
»So was in der Art.«
»Na, sicher tun Sie das. In dem Ort gibt’s sonst nicht viel, was Gäste anzieht.«
Die Fremde hielt den Kopf gesenkt. »Stimmt.«
Völlig unbeeindruckt von den einsilbigen Antworten beugte Frances sich vor, um einen besseren Blick auf das Gesicht ihres Gastes zu haben. »Sie kommen mir bekannt vor«, sagte sie. »Kenne ich Sie von irgendwoher?«
Die junge Frau strich sich mit einer Geste, die seltsam nervös wirkte, eine Haarsträhne hinters Ohr. »Das bezweifle ich«, murmelte sie.
»Sind Sie beim Fernsehen?«
»Nein.«
»Waren Sie mal in der Zeitung?«
»Ich …« Die Frau schien sich in ihren Stuhl zu ducken, als wünschte sie, der Erdboden würde sich öffnen und sie verschlucken.
Bevor er begriff, was er tat, war Rafe von seinem Platz hochgeschossen und mit langen Schritten durch das Café gegangen. Er glitt auf den Stuhl gegenüber der armen, bedrängten Fremden. »Hey, Frances, kann ich noch einen Kaffee haben und einen von Ihren weltberühmten French Toasts für meine Bekannte?«, sagte er und erntete die verblüfften Blicke beider Frauen.
»Bekannte?« Frances’ Brauen zuckten ungläubig nach oben.
Er warf ihr ein unwiderstehliches Lächeln zu. »Absolut.« Er zog die Menükarte aus den widerstandslosen Fingern der jungen Frau und reichte sie der Kellnerin. »Und wir haben’s leider ein bisschen eilig, also wenn es Ihnen nichts ausmacht …«
Die ältere Frau musterte ihn mit zusammengekniffenen Augen. Dann kam sie wohl zu dem Schluss, dass er ihrem hübschen jungen Gast bestimmt nichts anhaben wollte, und schwenkte mit einem Lächeln herum. »Reizender Bursche.«
Kaum dass Frances außer Hörweite war, beugte sich die Frau über den Tisch und funkelte ihn verärgert an. »Was erlauben Sie sich?«, fragte sie.
Rafe lehnte sich lässig zurück und bewunderte ihre großen goldgesprenkelten haselnussbraunen Augen.
Bezaubernd.
So hätten sie jedenfalls ausgesehen, wenn sie nicht von Misstrauen verschattet gewesen wären und die Haut darunter nicht von Müdigkeit gezeichnet.
Sein Spiderman-Spinnensinn war spontan geweckt. Diese Frau war nicht hier, um Verwandte zu besuchen. Sie war auf der Flucht vor irgendetwas. Oder irgendwem. Nach dieser Erkenntnis hätte mit seiner Faszination Schluss sein sollen. Schließlich war er null versessen darauf, sich von dem Trauma irgendeiner Unbekannten vereinnahmen zu lassen. Selbst dann nicht, wenn seine sämtlichen Instinkte ihn beschworen, sie in seine Arme zu schließen und von diesem Ort fortzubringen.
Allerdings war Rafe ein Typ mit einem voll ausgewachsenen Helfersyndrom. Und obwohl er die Symptome erkannte, hätten ihn keine zehn Pferde dazu bewegen können, jetzt zu gehen. Stattdessen hielt er den Blickkontakt mit ihr und schlug einen bewusst lockeren Ton an. »Ich dachte, Sie könnten ein bisschen Unterstützung vertragen, wo Sie doch Frances’ ganz spezielle Art von Verhör über sich ergehen lassen mussten«, scherzte er. »Ich schwöre, die Frau hätte die Spanische Inquisition alt aussehen lassen.«
»Dann sind Sie also bloß so was wie ein barmherziger Samariter?« Ihre Stimme war weich. Himmlisch weiblich.
»Wir sind beide fremd in der Stadt«, führte er aus. »Mir schien, Sie könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ende der Geschichte.«
Er bemerkte eine leichte Veränderung in ihrer Miene. Vorsicht. Argwohn.
»Sie sind nicht von hier?«
»Rafe Vargas. Geboren und aufgewachsen in San Antonio, Texas, und vor Kurzem nach Houston umgezogen.« Er streckte die Hand aus und war kein bisschen überrascht, dass sie nicht einschlug. Sie war so angespannt, als könnte sie jeden Augenblick in tausend Stücke zerbrechen. Außerdem umklammerte sie eine Zeitung, als wäre das eine Rettungsleine. »Und Sie sind?«
Sie zögerte, bevor sie widerwillig ihren Namen nannte. »Annie.«
»Einfach nur Annie?«
»Ja.«
»Sie sind keine Frau vieler Worte.« Sein Grinsen wurde breiter. »Das gefällt mir.«
Sie nahm einen tiefen Atemzug, das Unbehagen in ihren Augen wich Unmut.
Was Rafe ausgezeichnet in den Kram passte. Sie brauchte eindeutig eine Ablenkung von ihren Problemen.
»Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich bin nicht in der Stimmung für Gesellschaft«, gab sie ihm zu verstehen.
Er ignorierte ihre abschlägige Antwort und griff über den Tisch nach der Zeitung, die sie so unnachgiebig umklammert hielt, dass sich ihre Fingerknöchel weiß verkrampften. »Ist die von heute?«
»Das ist meine«, versetzte sie, als er die Titelseite glättete, um die riesige Headline zu enthüllen:
FÜNFZEHNTER JAHRESTAG DES NEWTON-SCHLÄCHTERS
Darunter waren zwei grobkörnige Fotos. Auf einem sah man sieben Tote in einem Leichenschauhaus, ihre Körper mit Decken verhüllt, auf dem daneben stand ein Mann mittleren Alters mit braunen Augen und einem sympathischen Grinsen.
»Furchtbar«, seufzte er.
»Ah.« Frances kehrte an den Tisch zurück. Sie goss Rafe Kaffee nach, dabei tippte sie mit einem Finger auf das Foto des grinsenden Mannes. »Das ist unsere lokale Berühmtheit.«
Rafe zog die Stirn hoch. »Berühmtheit?«
»Yep. Don White ermordete sieben Frauen, bevor er gefasst wurde.« Frances erging sich in einem dramatischen Schaudern. »Eine grauenvolle Geschichte.«
»Ja, das hat Mord so an sich«, sagte Rafe und spähte verstohlen zu seinem Gegenüber am Tisch. Ihr Gesicht war kalkweiß, ihre Hände waren fest ineinander verschränkt.
Was zum Teufel …? War sie mit einem der Opfer verwandt?
»Das mit dem Jahrestag hatte ich glatt vergessen«, fuhr die Bedienung fort. Sie lehnte sich mit einer Hüfte an den Tisch. »Ohne angeben zu wollen, aber ich kannte ihn.«
Rafe hörte nur mit einem Ohr hin, sein Blick fixierte Annie. »Echt?«
»Oh ja. Kam immer zum Frühstück her, vor der Sonntagsschule, pünktlich wie ein Uhrwerk. Brachte seine süße Tochter …« Frances’ Geplapper brach plötzlich ab, sie schnippte mit den Fingern und zeigte auf eine verblüffte Annie. »Das ist es. Das ist es, weshalb ich dachte, dass Sie mir bekannt vorkämen. Ich vergesse nie ein Gesicht, auch wenn es sich mit den Jahren verändert hat«, erklärte sie. »Die kleine Annie White.«
Panik flackerte durch die haselnussbraunen Augen. Ohne ein Wort sprang Annie auf und stürzte zur Tür.
Rafe hatte sich halb erhoben, doch dann setzte er sich wieder. Die Frau flüchtete, weil sie von Fremden nicht behelligt werden mochte. Er wollte ihr auf gar keinen Fall seine Gesellschaft aufzwingen. Er verstand, besser als die meisten, dass es Zeiten gab, wo man verflucht nochmal allein sein wollte.
»Gute Güte. So wahr ich hier stehe«, murmelte Frances, »ich hätte nie gedacht, sie hier noch mal wiederzusehen.«
Eine steile Falte schob sich zwischen Rafes Brauen. »Wieso nicht?«
»Sie ist Annie White. Die Tochter von dem Newton-Schlächter.« Frances zeigte auf den unteren Rand der Zeitung, dort war ein weiteres Foto von Don White abgebildet. Auf diesem stand er vor einer Schule, seinen Arm schützend um ein kleines Mädchen mit geflochtenen Zöpfen gelegt. »Das ist sie mit ihrem Vater.«
Rafe hasste Klatsch und Tratsch. Es war einer der Gründe, warum sein Vater diese Stadt verlassen hatte. Aber sein unerklärliches Bedürfnis, mehr über Annie White zu erfahren, überlagerte seine normale Aversion. »Was ist passiert?«
»Eine entsetzliche Geschichte.« Frances konnte ihre Genugtuung nicht verbergen, als sie ihm die grausige Geschichte enthüllte. Ganz ohne Zweifel hatte sie die über die Jahre zig Mal erzählt. »Zunächst fing alles ganz harmlos an. Als Don White die Johnson Farm kaufte, hätten wir nie vermutet, dass mit ihm irgendwas nicht stimmte. Er war alleinstehend und hatte eine fünfjährige Tochter, also taten wir alles, um den beiden das Gefühl zu geben, hier willkommen zu sein.«
»Er hatte nichts Auffälliges an sich?«
»Überhaupt nicht.« Frances machte eine Pause und legte die Stirn in angestrengte Falten, um sich an die Ereignisse zu erinnern, die mittlerweile fünfzehn Jahre zurücklagen. »Nun, er redete nicht gern über seine Vergangenheit, aber wer hätte ihm das verdenken können?«
»Weswegen nicht?«
»Seine Frau und sein Sohn starben bei einem schlimmen Autounfall.«
Ein bitterer Zug legte sich um Rafes Mund.
Du lieber Gott, Annie war vermutlich noch ein Baby gewesen, als sie Mutter und Bruder verlor. Seine eigene Mutter war gestorben, als er acht gewesen war, und Rafe verstand, wie schmerzvoll das für Annie gewesen sein musste. »Tragisch.«
»Natürlich war es uns zuwider herumzuspionieren.«
Er verkniff sich ein zynisches Grinsen. »Natürlich.«
»Sie lebten fast fünf Jahre hier, und er kam einem völlig normal vor«, fuhr Frances fort. »Und die kleine Annie war zum Anbeißen süß.«
»Ja, das ist sie noch«, murmelte er fast lautlos.
Die Kellnerin schnalzte mit der Zunge und bemühte sich, Mitgefühl zu zeigen. Dabei sonnte sie sich offenbar in dem Wissen, dass ihr die Sensation des Jahrzehnts mal eben so in den Schoß gefallen war. In den nächsten Tagen würden die Bewohner der Stadt bestimmt scharenweise zum Café gepilgert kommen, um sich ihren Bericht von Annie Whites mysteriösem Eintreffen anzuhören. Frances war auf dem Weg, in Newton ein Star zu werden.
»Armes Ding«, flötete sie. »Ich hab keine Vorstellung, was das für eine seelische Belastung sein muss zu wissen, dass dein Vater ein kaltblütiger Frauenmörder war.«
Rafe konnte sich das genauso wenig vorstellen. Aber es war bestimmt nicht angenehm. Er spähte auf das Bild mit dem grinsenden Mann. Dieser Typ sollte ein Serienmörder sein? Nicht zu fassen. Er sah so … durchschnittlich, so normal aus. »Und man war sich sicher, dass er der Täter war?«, hakte er nach.
»Oh ja«, antwortete Frances mit einem heftigen Kopfnicken. »Sie haben ihn auf frischer Tat ertappt, mit den sieben toten Frauen in seinem alten Bunker. Hatte sogar seine eigene Tochter da unten. Gefesselt und mit verbundenen Augen, während er ein Nickerchen hielt.«
»Shit.« Rafe ballte in impulsivem Zorn seine Hand zur Faust. »Wurde er hingerichtet?«
»Könnte man so sagen. Er wurde mit aufgeschlitzter Kehle in seiner Zelle gefunden, nur ein paar Stunden nach seiner Verhaftung.«
»Ein Mitgefangener?«, fragte er. Nicht dass ihn das kümmerte. Der Bastard gehörte an eine Wand gekettet und die nächsten fünfzig Jahre gefoltert. Gleichwohl hielt er es für besser, dass Annie das Trauma eines langwierigen Gerichtsverfahrens erspart geblieben war.
»Wer weiß das schon?« Ein geheimnistuerisches Lächeln streifte Frances’ Lippen. »Gottes Wege sind unergründlich.«
»Was Sie nicht sagen.« Rafe verlor das Interesse an dem toten Serienmörder. »Was ist mit Annie passiert?«
Frances zuckte die Schultern. »Wie ich erfahren hab, war sie für eine Weile in der Klapsmühle.«
Rafe knurrte einen Fluch, seine Miene wurde hart. »Das überrascht mich kaum«, sagte er kalt. »Die meisten von uns hätten eine Therapie nötig, wenn sie von ihrem Vater terrorisiert worden wären.«
Frances wurde hochrot im Gesicht, denn Rafes Vorwurf hatte sie getroffen. »Oh, das war nicht der Grund. Oder zumindest nicht nur«, sagte sie schnell. »Wie ich gehört hab, hat sie den Cops dauernd erzählt, dass sie die Morde gesehen hat.«
»Scheiße. Er hat sie zusehen lassen?«
»Nein. Sie beteuerte, sie hätte die Morde in ihren Träumen gesehen.« Frances machte eine dramatische Pause. »Während sie passierten.«
Rafe blinzelte. Nun, das war nicht das, was er erwartet hatte.
Klar, nach dem, was ihr der eigene Vater angetan hatte, konnte sie von Glück sagen, wenn es nicht mehr als ein paar Albträume waren.
»Sie war seit den Morden nicht wieder in Newton?«
»Nicht dass ich wüsste.« Frances zog abrupt die Stirn hoch. »Schon seltsam, dass sie gerade jetzt auftaucht.«
»Wegen dem Jahrestag?«
»Nein, weil Jenny seit letzter Woche verschwunden ist.«
Bei ihrer Äußerung breitete sich ein ungutes Gefühl in Rafes Magengegend aus. Eine dunkle Ahnung von Gefahr. Warum, wusste er nicht. Frauen verschwanden ständig. Aus allen möglichen Gründen. Das musste noch längst nicht heißen, es hätte irgendwas mit dem Jahrestag eines Serienkillers zu tun. Er hatte jedoch vor langer Zeit gelernt, niemals eine seiner Eingebungen zu ignorieren.
Aus der Küche ertönte ein Klingeln. »Bestellung ist fertig«, rief eine männliche Stimme.
Frances zwinkerte ihm zu. »Die Pflicht ruft.«
Er stand auf, warf genug Geld auf den Tisch, dass es für seine Rechnung und ein üppiges Trinkgeld reichte, und eilte zur Tür. Auf der wenig belebten Straße zog er sein Smartphone aus der Sakkotasche und tippte auf ARES Büro. »Teagan«, sagte er, als sein Freund abnahm, »ich brauche deine Hilfe. Schick mir sämtliche Infos, die du zu einem Serienmörder namens Don White finden kannst. Hier nennen sie ihn den Newton-Schlächter. Danke, Amigo.«
Er drückte das Gespräch weg, bevor der Technik-Freak ihn fragen konnte, ob er nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte. Gefolgt von der Frage, warum zum Henker er sich für einen schon ewig toten Serienmörder interessierte.
In Wahrheit hatte er nichts als eine vage Furcht, dass das Böse nach Newton zurückgekehrt war.
Und dass Annie White in Gefahr war.
***
Annie hielt an der Tankstelle am Stadtrand und tankte, ehe sie Richtung Denver fahren wollte. Gott, war sie dämlich! Sie hatte sich darauf gefasst gemacht, dass es einen weiteren Mörder gab, der sich in der Stadt herumtrieb. Oder sogar, dass ihre Visionen ein Symptom für ihre wachsende mentale Instabilität wären. Aber dass man sie nach all der Zeit wiedererkennen könnte, das wäre ihr nie in den Sinn gekommen.
Jetzt fühlte sie sich entblößt. Ausgeliefert. Und so verletzbar wie seit Jahren nicht mehr.
Gott möge ihr vergeben. Sie wollte kein Feigling sein, aber sie würde die neugierigen, unverfrorenen Blicke kein weiteres Mal durchstehen, und dass man wieder mit dem Finger auf sie zeigte. Oder das unerträgliche Mitleid, das sie nahezu erstickt hatte, nachdem sie zusammen mit ihrem Vater und den Leichen in dem Bunker gefunden worden war.
Ohne ersichtlichen Grund tauchte vor ihrem geistigen Auge das Bild eines schmalen, sündhaft anziehenden männlichen Gesichts auf.
Rafe Vargas.
Er war umwerfend gewesen. So charmant. Und sexy genug, dass ihr Körper vor Begehren geprickelt hatte, auch noch, nachdem sie versucht hatte, ihn zu verscheuchen. Die Sorte Mann, der jede Frau haben konnte, die er haben wollte.
Und jetzt wusste er, dass sie … gebrochen war. Es war grotesk, doch sie schämte sich.
Sie fröstelte, als die frühmorgendliche Luft durch ihr Sweatshirt schnitt. Nachdem sie den Benzinstutzen wieder eingehängt hatte, lief sie zum Tankstellenkiosk. Das Beste wäre, nach Denver zurückzufahren und zu hoffen, dass sie wieder in ihrem früheren Job anfangen konnte.
Ja. Sie würde so tun, als wäre sie nie in Newton gewesen. Und die Visionen … hm, wenn sie sie lange genug ignorierte, würden sie irgendwann verschwinden. Oder? Aber vorher brauchte sie einen Kaffee.
Die Glocke bimmelte leise, als sie die Tür aufdrückte und in die Wärme des Verkaufsraums trat. Im hinteren Teil standen drei kleine Tische, um die sich eine Gruppe älterer Männer scharte, die dort ihren Kaffee tranken und übers Wetter redeten. Sie wich geflissentlich ihren neugierigen Blicken aus und steuerte zu einem Ungetüm von Kaffeemaschine. Sie füllte einen Styroporbecher mit Kaffee, drückte einen Deckel darauf und schlenderte zu dem Ladentresen, wo ein Mann Mitte fünfzig gerade eine Vitrine mit frischem Gebäck füllte.
Wie auf Knopfdruck knurrte Annies Magen, ihr wurde der Mund wässrig beim Anblick der Donuts, ausgebackener Apfelringe und Muffins. Mmh, frittierter Zucker und Fett. Es war genau die Art Versuchung, um die sie normalerweise einen Riesenbogen machte. Aber heute gönnte sie sich einen langen Blick auf die Kalorienbomben. Sie hatte gestern das Abendessen ausfallen lassen, und das Frühstück war alles andere als üppig gewesen.
Warum nicht zuschlagen? Dauernd fettarmer Joghurt brachte es auch nicht.
»Morgen«, dröhnte der Mann, irrsinnig fröhlich trotz der Tatsache, dass es noch nicht einmal sieben Uhr war.
»Guten Morgen.«
»Frisch draußen«, verkündete er unnötigerweise. »Schneit sicher bald.«
Sie hielt den Kopf gesenkt, ihr Blick fokussierte sich auf die Vitrine. »Mmh.«
Als er merkte, dass Annie keine Lust auf Small Talk hatte, besann er sich sofort auf seinen Job. »Möchten Sie irgendwas?«
Sie zeigte auf ihr Lieblingsgebäck. »Einen Blaubeermuffin.«
»Sollen Sie haben.«
Während er den Muffin geschickt mit einer Gebäckzange fasste und in eine Tüte gleiten ließ, trat sie zum Ende der Theke. Sie stellte den Kaffee ab und nahm ihre Kreditkarte heraus, als ihr Blick auf ein Plakat hinter der Registrierkasse fiel.
VERMISST.
Wer hat diese Frau gesehen?
Auf sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung ausgesetzt.
Bitte kontaktieren Sie das
NEWTON POLICE DEPARTMENT.
Annie atmete scharf ein, als hätte ihr jemand einen Schlag in die Magengrube verpasst. »Scheiße«, murmelte sie. In ihrem Innersten war sie zwar darauf vorbereitet gewesen, trotzdem traf es sie wie ein lähmender Schock.
Der Mann stellte die Tüte neben ihren Kaffee. »Stimmt irgendwas nicht?« Er musterte sie mit unverstellter Neugier.
Mit einem Kopfnicken deutete sie zu dem Plakat. »Wird die Frau noch immer vermisst?«
»Yep.« Er verschränkte die Arme über seinem Brustkasten, seine Miene war ehrlich besorgt. »Jenny Brown. Die Kleine ist hier aus dem Ort.«
»Seit wann wird sie vermisst?«
»Seit acht Tagen.« Er kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Sie ist nach Des Moines gefahren und nicht wieder nach Hause gekommen. Die meisten glauben, dass sie mit irgendeinem Kerl durchgebrannt ist, den sie aus dem Internet kannte.«
Annie musterte sein breites Gesicht. Offenbar kaufte er ihnen die Story nicht ab. Sonst hätte er bestimmt kein Plakat mit der Vermissten aufgehängt, oder? »Aber Sie nicht?«, bohrte sie nach.
»Denkbar ist das natürlich schon. Es wäre nicht das erste Mal, dass Jenny vor ihrem Mann wegläuft«, räumte er widerstrebend ein. »Aber es passt nicht zu ihr, den Kleinen alleinzulassen.«
Annie umklammerte den Rand der Theke, ihre Knie fühlten sich merkwürdig weich an. »Sie hat Kinder?«
Er nickte. »Einen kleinen Jungen.«
Sie hatten immer Kinder. Bis auf eine Ausnahme.
Sie betrachtete das Foto in der Mitte des Plakats und fühlte einen Kloß im Hals. »Sie sieht so jung aus«, hauchte sie, als sie das rundliche Gesicht mit den großen braunen Augen betrachtete.
»Jenny hat es nie leicht gehabt«, sagte der Mann wie zur Verteidigung. Dachte er, Annie wollte über die arme Frau urteilen? Sie hoffte nicht. Sie verabscheute Menschen, die das Opfer verurteilten, als hätte es selber Schuld an den Wunden, die ihm zugefügt worden waren. »Sie war erst fünfzehn, als sie ihren Sohn bekam, aber sie hat sich immer bemüht, ihm eine gute Mom zu sein.« Er brach abrupt ab, seine blauen Augen verengten sich mit Argwohn. »Warten Sie. Sie sind doch nicht etwa eine Reporterin, oder?«
»Um Himmels willen, nein«, stritt Annie vehement ab.
Die Presse hatte sie gnadenlos gejagt, bis sie endlich bei ihren Pflegeeltern aufgenommen worden war. Dankenswerterweise hatte Douglas damit gedroht, jeden zu erschießen, den er auf seiner Ranch erwischen würde. Da waren sie letztlich abgezogen.
»Erst gestern hatten wir so einen hier. Der Mistkerl hatte ernsthaft versucht, eine Verbindung zwischen Jennys Verschwinden und dem Newton-Schlächter herzustellen.« Der Mann schüttelte entrüstet den Kopf.
»Wie kann das denn sein?«, fragte sie mit belegter Stimme. »Der Newton-Schlächter ist doch tot, oder?«
Seine Miene verfinsterte sich. »Klar ist er das. Hat sich in seiner Gefängniszelle die Kehle aufgeschlitzt. Der Sheriff behauptet, er bewahrt einen Teil von Don Whites Asche in einer Urne auf, die er auf seinem Schreibtisch stehen hat.«
Sie umklammerte die Ladentheke, bis ihre Fingerknöchel weiß unter der Haut hervortraten.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Sie durfte jetzt nicht an ihren Vater denken. Selbst nach den ganzen Jahren schmerzte es noch zu sehr. »Wie kam der Reporter denn darauf, dass das verschwundene Mädchen irgendwas mit dem Newton-Schlächter zu tun hat?«
»Weil er schlicht drauf aus ist, seine Story zu verkaufen«, knurrte der Mann. »Machte Andeutungen, wir hätten den Falschen festgenommen und dass der Newton-Schlächter noch frei rumläuft.« Er lachte kurz und humorlos auf. »Wir hätten den damals ziemlich schnell und überstürzt eingebuchtet. Dann meinte er, es könnte auch ein Nachahmer sein. Wenn das stimmte, wäre aber schon wieder ein Mädchen verschwunden. Jeder hier weiß, dass der Mörder alle zwei Tage eine Frau entführte. Präzise wie ein Uhrwerk. Na ja, bis auf die Frau vom Sheriff, die ist bloß einen Tag nach Kathy Benson verschwunden.« Er blinzelte, als Annie leise aufstöhnte, und tippte hastig den Preis für Kaffee und Muffin in die Kasse ein. »Ich möchte wetten, wenn wir den Sensationsfuzzi nicht aus der Stadt vertrieben hätten, wäre der als Nächstes auf die Idee verfallen, dass der Geist des Newton-Schlächters Frauen entführt«, brummte er, in dem offensichtlichen Versuch, die Stimmung zu heben.
Annie zog ihre Kreditkarte durch das Gerät, sie wollte nur noch weg von dem blöden Geschwätz des Typen. »Vermutlich.«
»Dann sind Sie also bloß auf der Durchreise?«, wollte der Mann wissen, als er ihr den Beleg reichte.
Annie wollte schon mit Ja antworten. Immerhin hatte sie den festen Entschluss gefasst, Newton zu verlassen. Oder doch nicht?
Jenny war vermutlich durchgebrannt, um sich mit einem anderen Mann zu amüsieren. Vielleicht war sie auch mit einer Freundin in Las Vegas. Es gab absolut keinen Grund, ihr Verschwinden mit den früheren Morden in Verbindung zu bringen. Doch kaum dass sie den Mund aufmachte, war Annie klar, dass sie nicht einfach wegfahren konnte. »Nein«, murmelte sie und schwenkte in Richtung Tür. »Kann sein, dass ich noch bleibe.«
***
Er stand im Obergeschoss des verlassenen Hauses, als sein Blick die schlanke Gestalt einfing, die am Waldrand entlangschlenderte.
Endlich.
Sein Herz flatterte vor freudiger Erregung.
Das Warten war hart gewesen. So entsetzlich hart.
Aber er konnte nicht spielen ohne Annabelle.
»Du bist gekommen, ich habe gebetet, du würdest kommen«, flüsterte er. Mit seiner Hand strich er über die staubige Fensterscheibe. »So ein gutes Mädchen. Ich hab dich vermisst, süße Annabelle. Jetzt können wir unser Spiel fortsetzen. Und dieses Mal, mein Liebstes, beenden wir es. Gemeinsam …«
Kapitel drei
Das Newton Motel war nach praktischen Erwägungen gebaut worden, und nicht im Hinblick auf Komfort. Das L-förmige Gebäude stammte aus den Vierzigern, mit Zimmern, die gerade Platz hatten für ein Doppelbett, einen Schrank und ein winziges Bad. Die Kunden waren Jäger, Straßenarbeiter und solche Leute, die an einer Hochzeit oder einem Begräbnis teilnehmen mussten, aber keine Lust hatten, bei ihrer Familie im Ort zu übernachten. Für einen Gast, der sich länger dort aufhalten würde, waren sie nie geplant gewesen.
Nach sechsunddreißig Stunden, in denen sie nervös im Zimmer umhergelaufen war und auf Neuigkeiten über die verschwundene junge Frau – oder wenigstens auf eine verdammte Vision – gewartet hatte, fiel Annie die Decke auf den Kopf. Sie musste raus.
Sie stieg in den knallgelben Jeep, den ihr Pflegevater ihr zur bestandenen Abschlussprüfung als Wirtschaftsprüferin geschenkt hatte, und fuhr von Newton etwa zwanzig Meilen in südliche Richtung, nach LaClede. Die Stadt war nicht groß, beim besten Willen nicht, aber dort gab es mehrere Kettenrestaurants entlang des Highways, wo Fremde nicht weiter auffielen. Sie mochte klaustrophobisch sein, doch sie war nicht in der Verfassung, Frances mit ihrer fanatischen Neugier zu ertragen.
Sie nahm in einer der Sitzecken Platz und bestellte einen Burger mit Pommes. Ihre Augen hingen unablässig an dem großen Fenster, das einen Blick auf den hell beleuchteten Parkplatz bot. Sie glaubte eigentlich nicht, dass man sie erkennen würde, aber eine junge Frau, die allein unterwegs war, zog immer Aufmerksamkeit auf sich.
Sie hatte fast den ganzen Burger und die Hälfte der Pommes verdrückt, als ein Schatten über das Holzimitat der Tischplatte fiel und eine vertraute Männerstimme das Gedudel im Hintergrund übertönte. »Na, das ist aber eine nette Überraschung.«
Mit einer Arroganz, die wahrscheinlich in seiner DNA angelegt war, glitt Rafe Vargas auf die gepolsterte Bank ihr gegenüber. Er warf ihr ein Grinsen zu, das seine makellos weißen Zähne enthüllte, und der warme Duft von Rasierwasser kitzelte ihre Sinne. »Hallo, Annie.«
Ihre Miene verfinsterte sich, während ihr Magen vor Aufregung flatterte. Verdammt. Er war einfach unverschämt gut aussehend. Es spielte keine Rolle, dass seine dunklen Haare von der frischen Herbstbrise zerzaust waren. Oder dass ein Fünf-Uhr-Bartschatten seine perfekt geschnittenen Züge verdunkelte. Oder dass er sich lässig in einen grauen Hoodie und schwarze Jeans geworfen hatte. Sein verwegenes Aussehen und das raue Charisma zogen jedes weibliche Wesen in dem überfüllten Diner an, wie der Nektar die Bienen.
»Mr Vargas.« Eine Falte schob sich zwischen ihre Brauen, als er sich lässig zurücklehnte und seine Füße ihre unter dem Tisch berührten. »Was machen Sie denn hier?«
»Warum so förmlich? Nenn mich gerne Rafe.« Er hatte seinen Arm über die Rückenlehne gelegt und zwinkerte ihr entspannt zu. Annie erschauderte innerlich, ob vor Empörung oder vor Erregung wusste sie nicht genau. »Um deine Frage zu beantworten: Ich habe mich mit meiner Maklerin getroffen, um irgendwelchen Papierkram zu unterzeichnen.« Er zeigte mit einem Kopfnicken auf eine ältere Frau, die auf halbem Weg zum Ausgang in einen Trenchcoat schlüpfte. »Sie schwärmte, dass sie hier fantastische Kuchen haben. Natürlich hat sie noch nie meinen berühmten Apfelstreusel gegessen, sonst wüsste sie, wie ein guter Kuchen zu schmecken hat.«
Sie ignorierte seinen Flirtversuch. »Du willst ein Haus kaufen?«
»Eins verkaufen.«
»Verkaufen?« Sie wurde spontan misstrauisch. »Sagtest du nicht, dass du in Texas lebst?«
Er zuckte wegwerfend mit den Schultern. »Das Haus gehörte meinem Großvater, Manuel Vargas.«
»Oh.« Annie hatte eine vage Erinnerung an einen hageren, dunkelhaarigen Mann, der einen verbeulten Pick-up fuhr. »Der Name sagt mir was. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er während der Erntesaison bei meinem Vater ausgeholfen hat.« Sie dachte an das mürrische Gesicht des Mannes, als sie ihm die neue Puppe zeigen wollte, die sie damals gerade zum Geburtstag bekommen hatte, und rümpfte die Nase. »Für gewöhnlich hat er vor der Scheune geparkt und ist dann direkt in Richtung Feld verschwunden. Ich glaube, er hat versucht, mir aus dem Weg zu gehen.«
»Ja. Das war typisch für ihn. Er hat sich nie viel aus Kindern gemacht«, murmelte Rafe. Er spähte zu der Bedienung, die eben an den Tisch trat. »Ich nehme ein Glas Bier, irgendeins, das sie im Ausschank haben.«
Über das rundliche Gesicht der jungen Frau mit den langen dunklen Haaren glitt ein Strahlen, ihr Lächeln war ein eindeutiges Angebot. »Sollst du bekommen«, hauchte sie und neigte sich weit vor, um ihre üppige Oberweite zur Schau zu stellen. »Und alles, was du sonst noch an Wünschen hast.«
Eine unangenehme Pause entstand, als die Kellnerin auf Rafes Reaktion wartete. Doch er schien sie gar nicht zu bemerken. Seine Augen waren schweigend auf Annie gerichtet. Schließlich schwenkte die junge Frau herum und stolzierte davon.
Annies Herzschlag setzte für einen Moment aus, als sie den dunklen Blick auffing, der unverstelltes männliches Interesse signalisierte. Er war gut. Gefährlich gut. »Ich wüsste nicht, dass ich dich eingeladen hätte, mir Gesellschaft zu leisten«, sagte sie.
»Ist schon okay.« Er griff über den Tisch und angelte sich ein Kartoffelstäbchen von ihrem Teller. »Ich verzeihe dir dein schlechtes Benehmen.«
»Ich Glückliche.«
»Ich denke, wir haben beide Glück.«
Für eine Sekunde verlor sie sich in dem dunklen, verheißungsvollen Blick. Ein Teil von ihr wünschte sich sehnsüchtig, sich auf einen unbeschwerten Flirt mit diesem Typen einzulassen. Wann war das letzte Mal, dass ein attraktiver Mann versucht hatte, sie zu verführen? Puh, das musste in einem anderen Leben gewesen sein. Aber sie wäre seltendämlich, wenn sie alle Vorsicht in den Wind schießen würde.
Sie wischte abwesend einen Tropfen Kondenswasser von ihrem Glas mit Diätlimonade. »Erwartet dein Großvater dich denn nicht?«
»Nein, er ist letztes Jahr verstorben.«
Sie machte ein zerknirschtes Gesicht. »Das tut mir leid.«
»Das muss es nicht. Ich kannte ihn kaum.« Sein Ton wurde kälter. »Er war nicht begeistert, als mein Vater Newton verließ und zur Armee ging.«
»Wieso?« Die Worte waren heraus, bevor sie sich bremsen konnte. Verdammt. Sie wollte nichts mehr über Rafe Vargas erfahren. Wahrscheinlich würde er heute Nacht ohnehin die Hauptrolle in ihren Träumen spielen. »Entschuldigung, vergiss es. Es geht mich nichts an.«
Rafe angelte sich noch eine Fritte von ihrem Teller und ging über ihre Äußerung hinweg. »Mein Großvater wollte, dass mein Vater bleibt und etwas zum Haushaltseinkommen beisteuert, aber mein Dad wollte nicht sein Leben lang Farmgehilfe sein. Als er fortging, meinte mein Großvater, dass er ihm niemals verzeihen würde.« Er aß die Fritte in zwei Bissen. »Dabei ist es geblieben.«
Annie spähte durch das gut gefüllte Diner zur Tür. Sie sollte gehen. Nicht bloß, weil dieser Mann unverschämt gut aussah, sondern weil sie sich keine Ablenkung leisten durfte. Verdammt. Sie war nicht zu ihrem Vergnügen hier.
Doch sie konnte sich nicht aufraffen.
Sie wollte nicht zurück in das enge Motelzimmer und die Wände anstarren. Noch nicht. Stattdessen trank sie von ihrem Soda und betrachtete sein schmales Gesicht. »Demnach hast du ihn nicht so oft gesehen?«, fragte sie abrupt.
»Zwei Mal. Das erste Mal auf der Beerdigung meiner Großmutter. Und dann vor sechs Jahren, als bei meinem Vater Krebs diagnostiziert wurde.« Sein bitterer Ton blieb ihr nicht verborgen. »Ich hatte irgendeine idiotische Eingebung, ich könnte den sturen alten Sack überzeugen, das Kriegsbeil zu begraben.«
»Und das ist nicht gelungen?«, hakte sie nach.
Um seinen Mund gruben sich ärgerliche Falten. »Er wollte mich ja nicht mal ins Haus lassen.«
»Und dein Vater?«