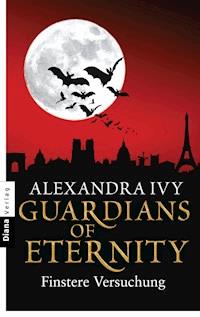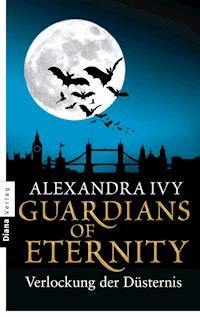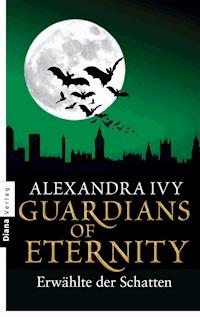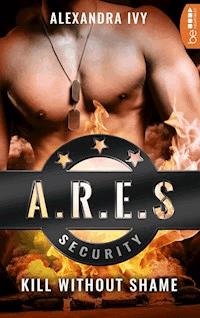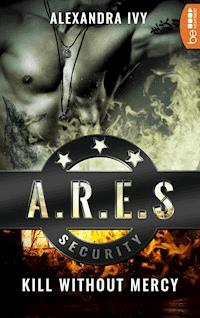4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic-Thriller-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er sieht dich ... Er kennt dich ... Und er wird dich niemals gehen lassen.
Jaci Patterson ist nach ihrem Studium wieder in ihren Heimatort Heron zurückgekehrt. Plötzlich tauchen dort schrecklich zugerichtete Leichen auf - von Menschen, die schon jahrelang vermisst werden.
Eine vertraute Angst macht sich in Jaci breit. Mit sechzehn hatte sie das erste goldene Medaillon auf ihrer Veranda gefunden. Darin ein erschreckender Fund: eine Haarlocke umwickelt mit einem blutigen Schleifenband. Obwohl Jaci noch mehr solche "Geschenke" erhielt, glaubte ihr keiner, dass dies das Werk eines Serienkillers sei - denn es gab keine Leichen.
Jetzt erhält Jaci erneut ein Medaillon, und ihr Albtraum beginnt von vorn. Doch dieses Mal wird er nicht enden, bis der Killer sie in seiner Gewalt hat ... für immer.
Ein packender Romantic-Suspense-Roman der New-York-Times-Bestsellerautorin. eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Jaci Patterson ist nach ihrem Studium wieder in ihren Heimatort Heron zurückgekehrt. Plötzlich tauchen dort schrecklich zugerichtete Leichen auf – von Menschen, die schon jahrelang vermisst werden.
Eine vertraute Angst macht sich in Jaci breit. Mit sechzehn hatte sie das erste goldene Medaillon auf ihrer Veranda gefunden. Darin ein erschreckender Fund: eine Haarlocke umwickelt mit einem blutigen Schleifenband. Obwohl Jaci noch mehr solche »Geschenke« erhielt, glaubte ihr keiner, dass dies das Werk eines Serienkillers sei – denn es gab keine Leichen.
Jetzt erhält Jaci erneut ein Medaillon, und ihr Albtraum beginnt von vorn. Doch dieses Mal wird er nicht enden, bis der Killer sie in seiner Gewalt hat … für immer.
Über die Autorin
Alexandra Ivy ist das Pseudonym der bekannten Regency-Liebesroman-Autorin Deborah Raleigh. Mit ihrer international erfolgreichen Guardians-of-Eternity-Reihe stürmte sie die SPIEGEL-Bestsellerliste und baute sich eine große Fangemeinde auf. »Watching You – Er wird dich finden« ist der erste romantische Thriller der Erfolgsautorin. Alexandra Ivy lebt mit ihrer Familie in Missouri.
Alexandra Ivy
Er wird dich finden
Aus dem Amerikanischen von Birgit Fischer
beTHRILLED
Deutsche Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Debbie Raleigh
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Pretend You’re Safe«
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP., 119 West 40th Street, NEW YORK, NY 10018 USA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Dimedrol68 | NickSorl | Le Chernina | venusty888 | Archeophoto | Krasovski Dmitr
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6261-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Gewidmet Sheriff David Parrish und
dem Sheriffbüro von Lewis County
zum Dank für ihre loyale Hingabe und ihre Bereitschaft,
weit mehr als ihre Pflicht zu tun.
Ich danke ihnen für die unglaubliche Geduld,
mit der sie mich in ihrem Büro aushielten
und meine endlosen Fragen beantworteten.
Jedwede Fehldarstellung ist einzig
der Autorin anzulasten.
Prolog
Frank Johnson hatte schon einige Überflutungen miterlebt. Er war auf einer kleinen Farm am Ufer des Mississippi aufgewachsen, was bedeutete, dass er in den letzten sechzig Jahren immer wieder schlammiges Wasser auf- und absteigen gesehen hatte. Manchmal riss es Ernten und Vieh mit sich und in einem besonders schlimmen Jahr sogar die Scheune, die sein Urgroßvater gebaut hatte.
Der Deich, der vor über zehn Jahren vom Ingenieurskorps der US-Army gebaut worden war, hatte zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit gebracht. Nicht, dass Frank froh gewesen wäre, als sie anrückten und sein fruchtbares Land aufschaufelten, um daraus den Schutzwall zu bauen. Frank war ein typischer Farmer aus dem Mittelwesten, der nichts davon hielt, wenn die Regierung ihre Nase – oder ihre Bulldozer – in seine Angelegenheiten steckte. Doch letztlich musste er zugeben, dass es nett war, nicht bei jedem Regen das Wasser an seine Hintertür schwappen zu sehen.
Dies jedoch war kein normaler Regen.
Am ersten Februar fing es an, und sechs Wochen später ergossen sich die Wolken immer noch auf die kleine Gemeinde. Der Fluss war zu einer tosenden, brodelnden zerstörerischen Naturgewalt geworden, die sich gen Süden bewegte. Frank beobachtete voller Sorge, wie das Wasser immer höher an die Deichkante stieg. Er wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es über die Deichkrone und auf sein hinteres Feld quoll.
Doch als er an diesem Morgen aufwachte, stellte er keineswegs fest, dass der Deich überflutet worden war. Nein. Er war klaffend aufgerissen. Als hätte ihn nachts jemand gesprengt.
Mit der Resignation eines Mannes, der schon sein ganzes Leben von den Launen der Natur abhängig war, hatte er seinen Overall und die Stiefel angezogen, bevor er seinen alten Traktor startete und hinausfuhr, um den Schaden zu begutachten.
Obwohl die Sonne schon aufgegangen war, tauchten die dicken Wolken und der hartnäckige Sprühregen die Farm in ein eigenartiges Zwielicht. Frank klappte den Kragen seines Overalls hoch, um seinen Nacken vor der kühlen Brise zu schützen, und kam sich ein bisschen wie Noah vor. Hatte er das Memo von Gott verpasst, dass er eine Arche bauen sollte?
Kaum war ihm dieser Gedanke gekommen, hielt er den Traktor an. Wie er es sich bereits gedacht hatte, waren seine Felder zu braunen Brackwasserteichen geworden. An einigen Stellen musste das eklige Zeug hüfthoch stehen. Und es fehlte auch nicht das übliche Treibgut aus Laub, Ästen und Unrat, das sich in den Wasserwirbeln verfangen hatte.
Womit er jedoch nicht gerechnet hatte, war dieses lange, dunkle Ding, das mitten auf seiner Weide trieb.
Zuerst dachte er, es handele sich um einen Balken. Vielleicht von irgendeinem Gebäude abgerissen. Doch bei einem Holzbalken würde sich sein Bauch nicht so vor Furcht verkrampfen, oder?
Er stieg von seinem Traktor und griff nach dem Handy in seiner Tasche. Unbewusst ahnte er bereits, dass das, was ihm das Wasser angetrieben hatte, übel war.
Und das war es.
Richtig, richtig übel.
Kapitel eins
Erst kam die Flut. Und dann kamen die Leichen …
Jaci Patterson war spät dran.
Es ging damit los, dass sie wie üblich um vier Uhr morgens aufwachte. Ja, sie wachte wahrlich zu einer unanständigen Zeit auf, und das an fünf Tagen die Woche. An den Wochenenden erlaubte sie sich, bis sechs zu schlafen. Doch als sie an diesem Morgen aus dem Bett stieg, stellte sie fest, dass der Strom ausgefallen war.
Schon wieder.
Der Stromausfall hatte nichts mit den maroden Leitungen zu tun, die zu ihrem abgelegenen Farmhaus im nordöstlichen Winkel von Missouri verliefen. Zumindest diesmal nicht. Stattdessen war der Regen schuld, der Tag um Tag auf den gesamten Mittelwesten niederprasselte.
Als das Licht eine Stunde später flackernd wieder anging, hatte sie sich beeilen müssen. Sie war froh, dass sie den Abend zuvor zwei Dutzend Pfirsichtartes und mehrere Brote gebacken hatte.
So hatte sie es knapp geschafft, ihre Blaubeermuffins und Scones fertig zu bekommen, bevor sie alles hinten in ihren Jeep laden musste. Dann sperrte sie ihre beiden schwarzen Labradore, Riff und Raff, in die Scheune, damit sie das Haus nicht auseinandernahmen, solange sie weg war, und machte sich auf den Weg nach Heron, der Kleinstadt nur zehn Meilen entfernt.
Wie vorauszusehen gewesen war, brauste sie über den Feldweg der kleinen Farm, die einst ihren Großeltern gehört hatte, als sie feststellte, dass die Straße vor der Kreuzung blockiert war. Mist. Offensichtlich war nachts der Damm gebrochen und hatte die aufgestaute Wut des Mississippi aufs Land gelassen.
Kein Wunder, dass der Strom ausgefallen war.
Sie zog eine Grimasse, als sie daran dachte, dass ihre unteren Felder, ebenso wie die meisten Felder ihrer Nachbarn, geflutet sein dürften, und legte den Rückwärtsgang ein. Vorsichtig setzte sie den ganzen matschigen Weg zurück, wobei sie achtgab, in der Mitte zu bleiben. Sobald sie Gelegenheit hatte, wendete sie und fuhr in die entgegengesetzte Richtung.
Der Umweg würde sie eine zusätzliche Viertelstunde kosten, aber wenigstens musste sie sich keine Gedanken über den Verkehr machen. Mit nicht einmal dreihundert Einwohnern war Heron kein Ort, in dem von Stoßverkehr die Rede sein konnte. Tatsächlich begegnete ihr kein einziger Wagen, als sie auf die Main Street bog.
Sie fuhr durch das Ortszentrum, das von einem kleinen Postamt, dem Gerichtsgebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert mit dem neueren Gefängnisanbau im hinteren Bereich, der Bank und dem Friseursalon gesäumt wurde. Auf der anderen Seite waren die Baptistenkirche und daneben ein zweigeschossiger Bau, den die örtliche Berühmtheit, Nelson Bradley, in eine Galerie für seine Fotografien umgebaut hatte. Weiter unten in der Straße befand sich ein neuer Blechschuppen, in dem der Feuerwehrwagen und die Wasserwacht untergebracht waren. An der Ecke stand ein kleiner Diner, der eigentlich Cozy Kitchen hieß, bei den Einheimischen aber unter Bird’s Nest lief, seit Nancy Bird, liebevoll Birdie genannt, ihn vor langer Zeit übernommen hatte.
Jaci fuhr in die schmale Gasse hinter dem Diner, sprang aus ihrem Wagen und schnappte sich den obersten Behälter mit den noch warmen Muffins. Sie bereute sofort, dass sie sich ihre Jacke nicht übergezogen hatte, denn der Sprühregen machte, dass ihr das kurze honigbraune Haar am Kopf klebte, und durchnässte ihr Mizzou-Sweatshirt und die ausgeblichene Jeans, die sich an ihren kurvigen Körper schmiegte.
Fröstelnd lief sie durch die Hintertür und achtete darauf, sich die Gummistiefel gründlich auf der Fußmatte abzutreten, bevor sie in die Küche ging.
Hitze schlug ihr entgegen, die den Raum, im Kontrast zum kalten Wind draußen, fast stickig wirken ließ.
Jaci verzog das Gesicht, als sie auf den Edelstahltisch neben der Grillplatte voller Rührei, Röstis, Würstchen und Bacon zuging, um ihre Muffins abzustellen.
Die große Frau mit den grauen Haaren und dem runden Gesicht wendete gerade geübt eine Reihe von Pancakes, bevor sie einer anderen Frau ein Zeichen gab, die an der Spüle Teller abwusch. Sobald die Küchenhilfe bei ihr war, reichte sie ihr den Pfannenspatel und kam auf Jaci zu.
Nancy Bird, oder Birdie, war fünfzehn Jahre älter als Jaci. Mit siebzehn hatte sie ihre Highschool-Liebe geheiratet und die Schule abgebrochen. Ihr Liebster hatte sich als Arschloch erster Güte entpuppt, war abgehauen und hatte Birdie mit vier kleinen Mädchen sitzengelassen.
Mit einer Entschlossenheit, die Jaci aufrichtig bewunderte, hatte Birdie den alten Diner gekauft und ihn in den letzten zehn Jahren zur besten Adresse im ganzen County gemacht.
So früh am Morgen waren normalerweise nur Farmer, Jäger und Schulbusfahrer hier, die vor Tau und Tag aufstanden.
»Morgen, Birdie.« Jaci trat zur Seite, als die ältere Frau begann, die Muffins auf ein großes Glastablett umzusetzen, das auf den Tresen neben der Kasse gestellt würde. Viele Kunden nahmen sich gerne noch eine Tasse Kaffee und einen Muffin mit, wenn sie fertig gefrühstückt hatten.
»Gott sei Dank, dass du hier bist!«
»Tut mir leid, dass ich so spät komme. Der Strom war fast bis fünf ausgefallen.«
Birdie war fertig und lief hinüber zu ihrer Hilfe.
»Bring das hier nach vorn zur Kasse«, befahl sie, ehe sie sich wieder Jaci zuwandte und die Augen verdrehte. »Die Eingeborenen haben schon mit einem Aufstand gedroht, weil ihre Lieblingsmuffins nicht da waren.«
Jaci lächelte, denn es freute sie, das zu hören. Ihre Großmutter hatte ihr das Backen beigebracht, doch erst nachdem sie die Farm ihrer Großeltern geerbt hatte, war sie auf die Idee gekommen, mit diesem Können ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Sie beugte sich zur Seite und spähte durch die große Durchreiche.
Das Lokal hatte sich in den letzten zehn Jahren nicht verändert. Die ausgeblichene Holzvertäfelung an den Wänden war mit alten Nummernschildern und einem präparierten Fisch verziert, der aus dem nahen Fluss stammte. Der Boden war nach wie vor mit Linoleum ausgelegt, und an der niedrigen Decke leuchteten Neonlichter.
Ein halbes Dutzend Tische standen in dem quadratischen Raum, und an dem hinteren langen Tisch saß eine Gruppe von Farmern, die täglich kamen, um Kaffee zu trinken und den neuesten Tratsch auszutauschen.
Im Moment waren alle Plätze besetzt von Gästen in sandfarbenen Overalls und Tarnjacken und mit Cardinal-Baseballmützen.
Jaci stieß einen leisen Pfiff aus. »Oh Mann, ganz schön was los«, sagte sie, und ein wehmütiges Lächeln umspielte ihre Lippen. Der Regen bedeutete, dass keiner auf den Feldern arbeiten konnte. »So profitiert wenigstens einer von der Flut.«
»Profitiert?« Birdie rang nach Luft und stemmte die Hände in ihre wohlgerundeten Hüften. »Du willst hoffentlich nicht andeuten, dass ich es genieße, an einer Tragödie zu verdienen, Jaci Patterson«, schimpfte sie. »Die Leute wollen zusammenkommen, um über das zu reden, was passiert ist, und ich biete ihnen nun mal den Platz dafür.«
Jaci blinzelte erschrocken, denn sie verstand nicht, warum ihre Freundin so aufbrauste. Dann erst begriff sie, was die Frau gesagt hatte, und verkrampfte sich.
»Tragödie?«, fragte sie.
Birdies Züge wurden weicher. »Hast du es noch nicht gehört?«
Jaci wurde mulmig. Sie hatte ihren Vater durch einen betrunkenen Autofahrer verloren, bevor sie geboren wurde, und dann ihre Großmutter, als sie siebzehn gewesen war. Ihr Großvater war erst vor zwei Jahren gestorben, und sie hatte immer noch mit den Verlusten zu kämpfen.
»Nein, ich habe nichts gehört. Wie gesagt, letzte Nacht ist der Strom ausgefallen, und als er wieder da war, habe ich gebacken. Ist jemand gestorben?«
»Ich fürchte ja.«
»Wer?«
»Wissen sie noch nicht genau«, antwortete Birdie.
Jaci blinzelte verwirrt. »Wie können sie das nicht wissen?«
»In der Nacht ist der Deich gebrochen.«
»Ja, das dachte ich mir schon, als ich sah, dass die Straße gesperrt ist … Oh, verdammt.« Ihr Unbehagen steigerte sich zu echter Furcht. Der Deich war früher schon gebrochen und hatte Felder geflutet, aber ihr südlicher Nachbar hatte erst vor Kurzem ein Haus nahe am Fluss gebaut. »Das Wasser hat doch nicht Franks Haus erreicht, oder?«
Birdie schüttelte den Kopf. »Nein, nur die hintere Weide.«
»Und worüber reden wir dann?«
»Als Frank sich den Deichbruch anschaute, sah er etwas mitten auf seinem Feld treiben.«
Jaci verzog das Gesicht. Armer Frank. Es musste ein gewaltiger Schock für ihn gewesen sein.
»O mein Gott. Das war eine Leiche?«
»Jap. Eine Frau.«
»Hat er sie nicht erkannt?«
Birdie beugte sich vor und senkte die Stimme, als könnte sie bei dem Lärm der Gäste irgendjemand hören – von dem üblichen Geklapper in der Küche ganz zu schweigen.
»Er sagt, dass unmöglich zu erkennen war, ob er sie schon mal gesehen hat oder nicht.«
»Ich schätze, er wollte nicht zu genau hingucken«, sagte Jaci. Würde sie eine Leiche in ihrem überfluteten Feld treiben sehen, würde sie sofort in ihren Jeep springen und wie eine Irre davonrasen.
»Das war es nicht. Er behauptet, die Frau war zu …« Birdie zögerte, offenbar auf der Suche nach einer taktvolleren Umschreibung, als Frank sie benutzt hatte. »… verwest, um das Gesicht zu erkennen.«
»Verwest?« Ein kalter Schauer lief Jaci über den Rücken.
»Das hat er gesagt.«
Jaci blickte gedankenverloren durch die Durchreiche und sah Frank im Lokal sitzen, umgeben von aufmerksamen Zuhörern.
Als Birdie »Leiche« gesagt hatte, war Jaci davon ausgegangen, dass die Flut jemanden mitgerissen hatte. Dass die Frau am Ufer entlanggegangen und in den Fluss gestürzt war. Oder ihr Wagen vom Wasser weggespült wurde, als sie versucht hatte, eine überschwemmte Straße zu überqueren.
Aber dann wäre sie wohl nicht verwest, oder?
»Ich habe gehört, dass Wasser seltsame Dinge mit einem Körper anstellt«, sagte Jaci schließlich.
Birdie zog sie zur Hintertür, als ihre Hilfe an den Kühlschrank wollte. Hinter der Sache steckte eindeutig mehr.
»Die Leiche war nicht das Einzige, was Frank fand.«
Jaci erstarrte. »Da war noch was?«
»Jap«, flüsterte Birdie, als wäre es ein großes Geheimnis. Was lächerlich schien, denn in einer Kleinstadt wie Heron gab es keine Geheimnisse. »Frank rief den Sheriff, und während er auf Mike wartete, schwört er, noch einen menschlichen Schädel im Schlamm nahe dem Weg gesehen zu haben.« Birdie schüttelte sich entsetzt. »Stell dir das vor! Zwei Tote, praktisch in seinem Garten! Ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.«
Jacis Mund wurde trocken. »Hat Frank sonst noch etwas gesagt?«
Birdie zuckte mit den Schultern. »Nur, dass der Sheriff ihm gesagt hat, er soll gehen und nicht darüber reden, was er gefunden hat.« Birdie schnaubte. »Als würde irgendwer nicht darüber sprechen, wenn er eine Leiche und einen Schädel auf seinem Feld findet!«
Eine vertraute Angst regte sich in Jacis Bauch.
Sie war eine Idiotin. Natürlich war sie das. Dies hier hatte nichts mit ihrer Vergangenheit zu tun. Oder mit dem mysteriösen Stalker, der ihr einst das Leben zur Hölle gemacht hatte.
Dennoch …
Sie wurde diese plötzliche Vorahnung nicht los.
»Ist Mike noch draußen bei Frank?«, fragte sie unvermittelt. Gemeint war Mike O’Brien, der Sheriff.
»Ja.« Birdie sah sie fragend an. »Ich glaube, er wartet auf das Ingenieurskorps, damit sie ihm verraten, wie lange es dauert, bis das Wasser wieder abgeflossen ist.« Sie rümpfte die Nase. »Ich schätze, die wollen sicher sein, dass da nicht noch mehr Leichen sind.«
Mehr Leichen.
Nun wurde Jaci unruhig. Sie mochte überreagieren, aber sie wäre erst wieder beruhigt, wenn sie mit Mike geredet hatte.
»Ich muss los.«
»Du hast noch keinen Kaffee getrunken«, erwiderte Birdie.
»Heute nicht, danke, Birdie.«
»In Ordnung.« Die ältere Frau trat zurück. »Ich hole dein Geld und …«
»Schon gut, ich komme später wieder.« Jaci drehte sich um und zog die Tür auf.
Ein kalter Luftschwall wehte herein.
»Wozu die Eile?«, fragte Birdie.
»Ich habe einige Fragen, auf die ich Antworten brauche«, sagte sie.
»Von wem?«, fragte Birdie, als Jaci bereits in die Gasse und zu ihrem Jeep lief. »Jaci?«
Jaci sparte sich die Antwort, sprang in den Wagen und legte den Gang ein. Wasser rann ihr aus dem nassen Haar in den Nacken, aber sie hatte den Motor und die Heizung auf voller Kraft laufen lassen.
Was bedeutete, dass sie zwar nass war, sich jedoch nicht komplett elend fühlte.
Sie stellte das Gebläse so ein, dass die warme Luft auf ihr durchnässtes Sweatshirt traf, in der unsinnigen Hoffnung, so würde es schnell trocknen, trat aufs Gas und machte sich auf den Heimweg. Diesmal kämpfte sie sich allerdings über den schlammigen Weg, der an Franks Land vorbeiführte.
Es waren nicht einmal zehn Meilen, doch bis sie ihren Wagen anhielt, hatte sich ein Angstknoten in ihrem Bauch gebildet.
Es spielte keine Rolle, wie oft sie sich sagte, dass dies nichts mit ihrer Vergangenheit zu tun hatte; die Furcht blieb und wuchs.
Ohne auf die Schaulustigen zu achten, die sich am Rand des Feldes sammelten, eilte Jaci an der Holzabsperrung vorbei, den Blick auf das schlammig braune Wasser gerichtet, das durch den Deich gebrochen war. Zweige und anderes Schwemmgut trieben über das Feld. Aber keine Leiche.
Gott sei Dank.
»Jaci.« Eine Männerstimme riss sie aus ihren Gedanken, und ein hagerer Mann in einer dunklen Uniform stellte sich ihr in den Weg.
Sie rang sich ein Lächeln ab. »Morgen, Sid.«
Der junge Deputy nickte zu dem gefluteten Feld hin und bemühte sich, angemessen ernst zu sein.
»Ich nehme an, du hast es gehört?«
»Ja.« Jacis Blick wanderte über die Schulter des Deputys zu dem Mann, der mit einem Handy ans Ohr gepresst am Straßenrand entlangschritt.
Sheriff Mike O’Brien.
Mit seinen achtundzwanzig Jahren war er nur ein Jahr älter als Jaci, doch seine schwarze Uniform mit dem Stern am Ärmel wies ihn als gewählten Gesetzesvertreter aus. Unter seinem Shirt trug er eine Schutzweste, die seine breite, muskulöse Statur betonte. Sein hellbraunes Haar unter der schwarzen Baseballmütze war militärisch kurz geschnitten, er hatte kantige Züge und verblüffend grüne Augen. So leuchtend wie frische Minze.
Mike war die Art starker, verlässlicher Mann, wie Jaci ihn sich wünschen sollte. Das wusste sie, und das erklärte auch, warum sie in den Monaten nach ihrer Rückkehr nach Heron häufiger mit ihm ausgegangen war.
Doch es hatte einfach nicht gefunkt. Zumindest nicht bei ihr. Mike bat sie weiterhin um Dates. Sie wusste nicht, ob er tatsächlich in sie verliebt war oder sie schlicht eine praktische Wahl war.
In Heron wimmelte es nicht gerade von ledigen jungen Frauen.
»Ich glaube, die halbe Stadt ist hier, um zu gaffen.« Wieder unterbrach Sid mit geschwellter Brust ihre Gedanken. Es kam selten vor, dass hier so viel Aufregung herrschte. Jaci aber wollte zu Mike. Sie ging an Sid vorbei und wich ihm aus, als er ihren Arm zu packen versuchte. »Warte«, befahl er.
Sie marschierte weiter. Der Schlamm zog an ihren Gummistiefeln.
»Ich muss mit Mike sprechen«, sagte sie und stapfte weiter auf ihren Freund zu.
Sid unternahm einen weiteren Versuch, sich ihr in den Weg zu stellen. »Der Sheriff hat diesen Bereich gesperrt. Er sagt, hier soll keiner etwas durcheinanderbringen, bevor er fertig ist.«
Wieder ging sie wild entschlossen an ihm vorbei. »Ich brauche nur eine Minute.«
»Aber …«
»Keine Sorge, Sid«, rief sie ihm über die Schulter zu. »Ich bringe hier nichts durcheinander.«
Da ihm klar wurde, dass er sie schon zu Boden ringen müsste, um sie aufzuhalten, kehrte Sid zu seinem Posten an der Absperrung zurück.
»Der wird meine Eier zum Frühstück braten«, brummelte er.
Jaci konzentrierte sich auf den zunehmend durchweichten Boden vor ihr. Die Erde war bereits vor dem Deichbruch vom Dauerregen ausgewaschen worden. Ein falscher Schritt, und ihr Fuß könnte in einer verborgenen Aushöhlung landen.
Oder, schlimmer noch, sie könnte sich den Knöchel verstauchen.
Zum Glück war Mike von seinem Telefonat abgelenkt. Daher hatte er keine Chance zu fliehen, ehe sie direkt neben ihm stand.
Zu spät bemerkte er, dass er nicht mehr allein war, und wandte sich mit einem verärgerten Stirnrunzeln zu ihr.
»Verdammt.« Er schob das Handy in seine Tasche und verschränkte die Arme. »Ich habe Sid gesagt, er darf niemanden durchlassen«, knurrte er. »Nelson musste ich auch schon vertreiben, als er hier rumschlich und Fotos machte, als wäre das eine Touristenattraktion. Und Andrew fuhr mit seinem Traktor hier runter, bevor ich das Feld absperren konnte.«
Jaci presste die Lippen zusammen. Mike sprach von Nelson Bradley, dem Fotografen, der kürzlich in seine Heimatstadt Heron zurückgezogen war, um eine Galerie zu eröffnen. Und Andrew Porter war ein hiesiger Farmer, der auf Jacis Land Marktfrüchte anbaute.
»Ich bin nicht irgendwer«, entgegnete sie.
»Ach nein? Und warum nicht?«, fragte er. »Nur weil wir einige Male zusammen aus waren, genießt du keine Privilegien.«
Seine schroffe Art ließ sie zusammenzucken. Meinte er das ernst?
»Ich bin nicht hier, weil wir zusammen aus waren.«
Er stockte und holte tief Luft. Sicher hatte er einen stressigen Morgen hinter sich und einen Tag vor sich, der wahrscheinlich nicht besser werden würde.
Noch dazu drohte der Sprühregen zu einem weiteren Starkregen zu werden.
»Tut mir leid, Jaci. Falls du dich um dein Land sorgst, schicke ich dir Sid vorbei, damit er mal nachsehen kann«, lenkte er ein, auch wenn ihm seine Anspannung anzumerken war, als er zu der klaffenden Lücke im Deich blickte. »Oder ich mache das, wenn das verfluchte Ingenieurskorps endlich hier ist.«
Jaci winkte ungeduldig ab. Dachte er wirklich, dass sie ihn störte, damit er jemanden schickte, der nach einigen durchgeweichten Feldern schaute?
»Ich sorge mich nicht um das Land. Ich sorge mich wegen der Toten.«
»Ach so.« Seine Züge wurden weicher. »Schon okay, Jaci. Sie war nicht von hier.«
»Bist du sicher?«
Er zog eine Grimasse. »So sicher, wie ich mir angesichts des stark zersetzten Körpers sein kann.« Kopfschüttelnd zog er sein Handy hervor, das zu summen begonnen hatte. »Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Du musst nach Hause fahren. Ich komme später bei dir vorbei.«
Sie biss die Zähne zusammen. Ein Teil von ihr wollte sich umdrehen und weggehen. Warum nicht akzeptieren, dass es nur ein tragischer Unfall war, der gar nichts mit Heron zu tun hatte? Oder mit ihr.
Sie hatte weiß Gott genug andere Sorgen.
Doch wenn sie eines in den letzten elf Jahren gelernt hatte, dann war es, dass nichts, absolut gar nichts schlimmer war, als nicht Bescheid zu wissen.
»Wie wurde sie getötet?«, fragte sie.
Es entstand eine Pause, als Mike sie prüfend ansah. Er spürte, wie beunruhigt sie war. Dann strich er ihr einige nasse Strähnen aus der Stirn.
»Was ist los?«, fragte er sanft und ignorierte sein summendes Handy.
Sie nagte an ihrer Unterlippe, zögerte, ihm ihre schlimmsten Ängste zu gestehen.
»Was ist, wenn es wieder anfängt?«
»Wieder anfängt?« Er runzelte die Stirn und war sichtlich verwirrt von ihrer Frage. Sekunden später dämmerte es ihm. »Oh Mann, Jaci, tu dir das nicht an.«
Sie zog den Kopf ein. »Ich kann nicht anders.«
Er streckte eine Hand aus, um sie an ihre Wange zu legen. Mike überragte sie mit über einem Meter achtzig deutlich, denn Jaci war nicht mal einen Meter sechzig groß; das machte es ihm leicht, den beschützenden Gesetzesvertreter zu mimen.
»Hör mir zu«, sagte er. »Dies hier hat nichts mit deinen verrückten Theorien über die Vergangenheit zu tun.«
Jaci überkam eine allzu vertraute Wut. Sie war es gewohnt, dass ihre Ängste als »verrückt« abgetan wurden. Der vorherige Sheriff hatte sich nicht einmal entblödet, sie als »hormongeplagt« zu bezeichnen.
Keiner wollte ihr zuhören.
Was vielleicht nicht weiter verwunderlich war.
Sie war gerade sechzehn geworden, als sie das erste goldene Medaillon erhalten hatte. Sie hatte es auf der Verandaschaukel gefunden, als sie von der Schule nach Hause gekommen war. Zuerst hatte sie gedacht, es wäre ein verspätetes Geburtstagsgeschenk ihrer Großeltern. Die beiden hatten sie gern mit kleinen Überraschungen verwöhnt.
Doch als sie es öffnete, ging ihr rasch auf, dass es kein Geschenk war. In dem Medaillon lag eine rote Haarlocke, von einem blutverschmierten Stück Schleifenband zusammengehalten.
Es hatte ihr hinreichend Angst eingejagt, um darauf zu bestehen, dass ihre Großmutter die Polizei rief. Sie taten es als Halloween-Streich ab. Und Jaci hatte versucht, es ebenfalls zu tun. An der kleinen Schule hier hatte es reichlich Fieslinge gegeben, die sie mit Freuden schikaniert hätten. Einschließlich ihres Halbbruders Christopher.
Aber das zweite Medaillon kam nur wenige Monate später. Diesmal war das Haar dunkel, wieder mit blutigem Schleifenband verschnürt. Und wieder hatte Jaci es zum Sheriff gebracht und war ein weiteres Mal abgewimmelt worden.
Die nächsten zwei Jahre erhielt sie immer wieder Medaillons. Manchmal im Abstand von sechs Monaten, manchmal von Wochen. Doch während sie zunehmend sicherer war, dass das Haar in den Medaillons von Frauen stammte, die verletzt worden waren, wenn nicht gar umgebracht, glaubte ihr niemand.
Vielmehr wurde die Geschichte für alle, außer ihren Großeltern, zu einer Art Scherz.
Ihre Großeltern waren die Einzigen, die Mitgefühl für sie aufbrachten, obwohl auch sie nicht glauben konnten, dass in Heron ein Wahnsinniger herumlief, der Frauen ermordete und besondere Andenken für Jaci in goldenen Medaillons auf der Veranda deponierte.
Der Horror hatte aufgehört, als Jaci aufs College nach Mizzou ging, der University of Missouri. Und glücklicherweise war es auch ruhig geblieben, seit sie vor zwei Jahren nach Heron zurückkam.
Aber jetzt …
Sie fröstelte. »Und wie erklärst du dir die tote Frau und den Schädel auf Franks Feld?«
Seine Züge wurden härter, als er in den Cop-Modus zurückschaltete.
»Dafür gibt es tausend mögliche Erklärungen, und keine von ihnen hat irgendwas mit einem Mörder zu tun.«
»Tausend?« Sie zog eine Augenbraue hoch. »Ach ja?«
»Wahrscheinlich ist es die Leiche einer Frau, die bei einem Angelausflug über Bord gegangen ist. Oder sie ist tatsächlich Opfer eines Verbrechens geworden, wurde weiter oben in den Fluss geworfen und nun hier angetrieben.« Er trat einen Schritt zurück und schwenkte eine Hand in Richtung des trüben Wassers. »Chicago ist berüchtigt dafür, dass dort alle Probleme in den Fluss geworfen werden.«
Er hatte recht. Aller Gefahr zum Trotz gab es immer Leute, die bei einer Flut mit Booten herausfuhren. Entweder weil sie dämlich waren, oder weil es zu ihrem Job gehörte.
Und es stimmte auch, dass Jaci schon ihr Leben lang Geschichten von Leichen hörte, die aus Chicago antrieben. Nicht, dass ihres Wissens schon mal eine gefunden worden war, aber es war eine Legende, die alle gerne glaubten.
Es beruhigte sie nicht.
»Was ist mit dem Schädel?«, beharrte sie.
Mike verdrehte die Augen. »Verdammt, hat Frank das allen erzählt?«
»Ja.«
Mike seufzte resigniert. »Hör mal, die vernünftigste Antwort ist, dass beide ertrunken sind. Die jüngsten Überflutungen haben eine Menge unschöner Dinge hochgespült, die im Flussbett versteckt lagen.« Er zuckte mit den Schultern. »Es könnte sogar sein, dass das Wasser einen Friedhof unterspült und den Inhalt einiger Gräber bis zu uns mitgerissen hat.«
Okay, das ergab wirklich einen Sinn. Jaci beruhigte sich ein bisschen.
»Wann wirst du das genau wissen?«
»Die Leiche und der Schädel sind schon vom Coroner abgeholt worden«, antwortete er. »Er bringt sie runter zum Gerichtsmediziner in Columbia, damit der eine Autopsie macht. Bis dahin ist hier alles gesperrt, auch für dich, Jaci.« Er zeigte mit dem Finger auf sie. »Verstanden?«
»Ist gut.«
Sie drehte sich um und stakste durch den Schlamm davon.
»Das ist mein Ernst, Jaci!«, rief er ihr nach.
»Ja doch«, sagte sie und ging am Rand des Feldes entlang.
Sie hatte genug Zeit vergeudet.
Es gab immer noch Lieferungen zu erledigen. Ganz zu schweigen von ihrem täglichen Einkauf, dem Gang zur Bank und zum Postamt und dem Besuch beim Tierarzt, um sich Salbe für Riffs entzündetes Ohr zu holen.
Sie könnte sich später Gedanken um Leichen und fremde Schädel machen.
Ihm blieb die Luft weg, als er beobachtete, wie Jaci Patterson davonging.
Oh, das war herrlich! Pure Erregung explodierte in ihm, brachte sein Herz zum Pochen und ließ seinen Schwanz heftig zucken.
Es fühlte sich an, als würde er mitten in einem Gewitter stehen.
Wie lange war es her? Acht Jahre? Neun vielleicht.
Zu lange.
Er hatte versucht, sie zu ersetzen. Immerhin hatte sie ihn verlassen, als er gerade dachte, er könnte den nächsten Schritt in ihrer Beziehung machen.
Aber die anderen Spielerinnen hatten ihm bestenfalls vorübergehende Befriedigung verschafft, nie diesen Kitzel wie die süße, süße Jaci.
Er verbarg sein Lächeln, weil ihm bewusst war, dass hier Dutzende aufrechter Bürger von Heron jeden Anflug von Mienenspiel bei ihm bezeugen könnten.
Welche Ironie!
Als er den Anruf erhielt, dass die Überflutung seine Begräbnisstätte freigelegt hatte, war er in Panik geraten. Die Leichen könnten eine Aufmerksamkeit erregen, die womöglich alles verdarb.
Nun vergaß er seine Bedenken.
Okay, es könnte kurzzeitiges Interesse aufflammen, aber das würde schnell verfliegen. Vor allem, wenn die meisten seiner Opfer weiter flussabwärts angespült würden.
Und die Neugier nerviger Nachbarn und sogar mögliche Ermittlungen waren nichts weiter als eine Störung, verglichen mit der gleißend aufflammenden Vorfreude, die er empfand, als er sah, wie sich die Vorahnung auf Jacis schönem Gesicht spiegelte.
Sie erinnerte sich an ihr Spiel.
Und sie konnte es nicht abwarten, wieder damit zu beginnen.
Genauso wenig wie er …
Kapitel zwei
Jaci war mit ihren Gedanken woanders, als sie die fünfzehn Meilen nach Baldwin fuhr.
Der Ort war größer als Heron, konnte mit einer Kunsthochschule und mehreren Fachgeschäften aufwarten, schaffte es aber doch, sich den Charme einer Kleinstadt am Fluss zu bewahren.
Jaci hielt an einem Bed & Breakfast, um ihr selbstgebackenes Brot abzuliefern, bevor sie zu dem kleinen Café fuhr, das zwischen einer Eisenwarenhandlung und einer Zahnarztpraxis eingequetscht war.
Sie lenkte ihren Jeep in die nächste freie Parklücke und sprang heraus, ohne darauf zu achten, wer neben ihr einbog. Trina, die Besitzerin von Tea & Cakes, hatte bereits zweimal angerufen und nachgefragt, ob die Obstkuchen rechtzeitig zum Brunch-Ansturm kämen.
Ein großer Fehler.
Jaci öffnete gerade die Heckklappe ihres Wagens, als sie den vertrauten Duft nach Dolce & Gabbana wahrnahm und erstarrte. Oh … Mist. Sie blickte zur Seite, wo sie zu spät den silbernen Mercedes entdeckte, der neben ihr parkte.
Wie ein Reh im Scheinwerferlicht war Jaci nicht in der Lage, sich zu rühren. Wäre sie klug, würde sie in den Laderaum ihres Jeeps steigen und die Tür schließen. Mit ein wenig Turnerei käme sie auf den Fahrersitz und könnte weg sein, ehe es zu einer Begegnung kam.
Stattdessen zwang sie sich, sich langsam umzudrehen und dem kritischen Blick der älteren Frau zu stellen.
»Hallo, Mutter.« Sie setzte ein Lächeln auf.
Loreen Hamilton war eine kleine, schlanke Frau mit rotblondem Haar, das sie zu einem losen Knoten gesteckt trug, um ihr blasses ovales Gesicht und ihre feinen Züge hervorzuheben. Mit Mitte vierzig war sie noch immer eine schöne Frau, der es gelang, trotz des hartnäckigen Regens wie aus dem Ei gepellt auszusehen. Natürlich gab sie ein Vermögen für ihre wöchentlichen Besuche bei der Kosmetikerin, der Maniküre und dem Friseur aus. Und ihr weiter schwarzer Mantel und die hohen Lederstiefel hatten vermutlich mehr gekostet als Jacis gesamte Garderobe.
Hatte man Geld, war es leicht, gut auszusehen.
Mit ihren kalten blauen Augen musterte sie Jaci, vom Haar, das ihr nass am Kopf klebte, über das durchweichte Sweatshirt bis hin zu den schlammverschmierten Gummistiefeln.
Ihr gegenüber kam Jaci sich stets wie eine linkische, klobige Kuh vor.
»Jaci.« Sie zog eine perfekt gezupfte Augenbraue hoch. »Du lieber Himmel, was ist passiert?«
»Nichts.« Jaci blickte verwirrt an sich hinab. »Warum?«
Loreens Lippen wurden schmaler. »Du siehst furchtbar aus.«
Jaci verdrehte die Augen. Sie würde nie verstehen, wie sich die hübsche Loreen mit siebzehn Jahren von einem einfachen Farmjungen hatte schwängern lassen. Natürlich wusste Jaci von Bildern, dass ihr Vater, Samuel, mit seinem goldbraunen Haar und den gemeißelten Gesichtszügen auf verwegene Art gut aussehend gewesen war. Jaci hatte seine Haarfarbe und seine blaugrauen Augen ebenso geerbt wie seine Liebe zur Natur. Leider waren ihre sonstigen Züge nicht annähernd so umwerfend.
Doch Loreen hatte ihren Fehler eiligst wiedergutgemacht.
Nachdem Jacis Vater von einem betrunkenen Autofahrer getötet worden war, hatte sie ihre neugeborene Tochter bei ihren Schwiegereltern abgeliefert und sofort Blake Hamilton geheiratet, damit sie in sein prächtiges Haus auf der Anhöhe mit Blick auf den Ort ziehen konnte.
Sie hatte ihm auch einen hübschen Sohn, Christopher, und eine perfekte Tochter, Payton, geschenkt.
Eine Bilderbuchfamilie.
»Ich arbeite«, antwortete sie.
»Und du hättest dich nicht ein bisschen saubermachen können, bevor du in die Stadt kommst?«
Jaci griff nach dem letzten Tablett mit Pfirsichtartes in ihrem Jeep und vergewisserte sich, dass es vollständig abgedeckt war.
»Ich bin seit Stunden auf und habe noch tausend Sachen zu erledigen«, sagte sie knapp. »Wenn ich wieder zu Hause bin, gehe ich duschen.«
Loreen schnaubte leise. »Kein Grund, patzig zu sein.«
Patzig? Benutzten Leute diesen Ausdruck noch?
»Ich …« Sie verkniff sich ihre wütende Erwiderung. Sie hatte alles versucht, eine Beziehung zu dieser Frau aufzubauen. Sie hatte die folgsame Tochter gespielt, die flüchtige Bekannte, die gleichgültige Fremde. Nichts änderte sich. Ihre Mutter war so kalt und tadelnd, wie sie es gewesen war, als Jaci mit fünf Jahren nicht zur Prinzessin des Mais-Festivals gekürt worden war. Zu Loreens Freude hatte ihre zweite Tochter, Payton, den Preis danach drei Jahre lang in Folge gewonnen. »Wie dem auch sei«, sagte Jaci ächzend. »Ich muss die hier Trina bringen.«
Da sie davon ausging, dass ihre Mutter dieses unerwünschte Aufeinandertreffen schnellstmöglich hinter sich bringen wollte, war Jaci verblüfft, als Loreen auf das Tablett in ihren Händen zeigte.
»Warte«, befahl sie. »Ich nehme zwei von denen.«
Jaci machte große Augen. »Du?«
Loreen wirkte verlegen. »Ich bezahle auch.«
»Das ist es nicht«, entgegnete Jaci, die unter die Plastikfolie griff, um zwei Obsttörtchen hervorzuholen. »Ich habe nur noch nie gesehen, dass du etwas Süßes isst.«
Ihre Mutter zuckte mit einer Schulter und streckte eine Hand nach den Kuchen aus.
»Blake hat ein Meeting mit Klienten in seinem Büro in St. Louis, aber er hat versprochen, rechtzeitig zum Dinner zu Hause zu sein. Und …« Loreens Lippen dehnten sich zu einem Lächeln. »Christopher ist zu Hause.«
»Oh.« Jaci gelang es, keine Grimasse zu ziehen. Sie hasste ihren Halbbruder. Er war schon als arroganter Idiot zur Welt gekommen und dann zu einem dreisten Rüpel herangewachsen, der den Reichtum seiner Familie ausnutzte, um mit allem davonzukommen. Jaci bezweifelte, dass die letzten drei Jahre an der Washington University in St. Louis seine schleimige Persönlichkeit verändert hatten. »Sind Frühjahrsferien?«
»Er ist fertig mit seinen Kursen.«
Hmm. Hätte der Goldjunge tatsächlich seine Collegeausbildung abgeschlossen, würde das mit Pauken, Trompeten und einer königlichen Party gefeiert.
Was bedeutete, dass er das Studium geschmissen hatte. Oder, was wahrscheinlicher schien, rausgeflogen war.
»Wann ist er zurückgekommen?«, fragte Jaci.
»Vor ein paar Tagen.«
Tja, das war vage.
»Hat er vor, hierzubleiben?«
»Vorerst.«
Noch vager. Komisch.
»Sicher bist du froh, ihn wieder zu Hause zu haben.«
»Ja. Ja, das bin ich.« Das Gesicht ihrer Mutter sah für einen kurzen Moment außergewöhnlich emotional aus, ehe es wieder kühl und überheblich wurde. »Was bin ich dir schuldig?«
»Betrachte die Kuchen als Geschenk für den verlorenen Sohn«, antwortete Jaci.
Etwas, was Angst sein mochte, blitzte in den blauen Augen ihrer Mutter auf.
»Warum nennst du ihn so?«, fragte sie spitz.
Jaci runzelte die Stirn. Was soll’s?
Ihre Mutter war ständig spitz. Als wäre sie aus stacheligem karamellisiertem Zucker gemacht. Doch nun sah sie aus, als würde sie jeden Moment zerspringen.
»Er war fort, und jetzt ist er wieder nach Hause gekommen«, erklärte sie genervt. »Sonst nichts.«
Loreen rang sich ein kurzes Lachen ab. »Ja, natürlich.«
Jaci sah ihre Mutter prüfend an. »Ist irgendwas los?«
»Selbstverständlich nicht.« Das Lächeln blieb, wirkte jedoch angestrengt. »Alles ist bestens.«
»Klar. Perfekt.« Ihre Verwunderung wich einem plötzlichen Misstrauen, das Jaci so finster umfing, wie es die Wolken über ihr waren.
Es war ein höllischer Morgen gewesen, und ihr fehlte die emotionale Kraft, mit dieser Frau umzugehen. Mit einem resignierten Kopfschütteln wandte sie sich Richtung Café.
Welche Laus ihrer Mutter auch über die Leber gelaufen sein mochte, es hatte nichts mit ihr zu tun. Und Loreen würde es ihr ganz sicher nicht danken, sollte Jaci sich einzumischen versuchen.
Nein, das wäre das Letzte, was sich ihre Mutter wünschen würde.
Jaci drückte die Tür mit der Schulter auf und betrat das in Rosa und Weiß gehaltene Café mit den Plüschsofas und den niedrigen Tischen.
Trina kam hinter dem Glastresen hervorgelaufen, ein erleichtertes Lächeln auf dem runden Gesicht.
»Gott sei Dank!«
Jaci gab ihr das Tablett, kassierte ihr Geld und eilte zum Jeep zurück, ehe Trina sie in Beschlag nehmen konnte. Jeder wollte über den schaurigen Fund reden.
Jeder außer Jaci.
Sie wollte einfach nur ihre Einkäufe erledigen und nach Hause kommen.
Es war nach elf, als Jaci endlich Baldwin verließ und über die Seitenstraßen zur Farm ihrer Großeltern fuhr. Die enge Straße war abgelegen und von einer Schlammschicht bedeckt. Deshalb rechnete Jaci nicht damit, einem großen schwarzen Geländewagen zu begegnen, als sie um eine Biegung kam.
Sie trat auf die Bremse und beobachtete, wie der Wagen vorbeifuhr, wobei er ihre Stoßstange nur um Haaresbreite verfehlte. Doch noch während Jaci aufatmete, weil sie nicht zusammengestoßen waren, sah sie den Mann hinterm Steuer.
Der ihr allzu gut bekannt war.
Ihr Stiefvater, Blake Hamilton.
Verwundert sah sie dem SUV hinterher, der um die Biegung verschwand.
Der ältere Mann war CEO von Hamilton Enterprises, einem Unternehmen, das er von seinem Vater geerbt hatte. Jaci wusste nicht genau, was das hieß, abgesehen von der Tatsache, dass er haufenweise Geld verdiente. Er nutzte den kleinen Flugplatz nördlich von Baldwin für den täglichen Weg zum Büro in St. Louis. Es waren nur vierzig Minuten Flug, und so konnte er die Vorzüge genießen, in einer Kleinstadt zu leben.
Schließlich war er in der Großstadt nur ein Geschäftsmann von vielen; hier durfte er sich als jemand Besonderes geben.
Doch was machte er hier draußen, mitten in der Pampa?
Und warum glaubte ihre Mutter, dass er erst heute Abend zurückkam?
Kopfschüttelnd trat Jaci wieder aufs Gas.
Der. Schrägste. Tag. Aller Zeiten.
Kapitel drei
Rylan Cooper stieg die enge Treppe hinauf.
Er hatte Grund zu triumphieren.
Nach einer Woche Abdichten, Versiegeln und Wasserpumpen konnte er endlich einen Erfolg vorweisen.
Einen trockenen Keller.
Er betrat die Küche und schloss die Tür hinter sich. Der enge Raum war vor fast hundert Jahren an das alte Farmhaus angebaut worden, was erklärte, warum er sich abschüssig anfühlte. Die Schränke waren abgenutzt, der Linoleumboden an der Hintertür beinahe vollständig durchgewetzt, und die Armaturen hätten schon in den Sechzigern auf den Schrottplatz gehört.
Aber es gab eine Fensterzeile an der rückwärtigen Wand, die einen unbezahlbaren Blick auf den Mississippi bot, und die Luft war erfüllt vom warmen Duft nach Pancakes und Pfeifentabak.
Dem Geruch von zu Hause.
Ein Gefühl der Wärme breitete sich in Rylan aus, auch wenn er es leugnen wollte. Er wollte dieses permanente Wohlgefühl nicht empfinden, nach nur zwei Wochen auf der Farm seines Vaters.
Vielmehr sollte er ungeduldig der Rückkehr in sein Apartment in Kalifornien entgegenfiebern. Es war ein großartiges Designer-Apartment mit einer atemberaubenden Aussicht auf den Strand. Und natürlich war da noch seine florierende Firma, die er mit seinem Freund und Partner Griff betrieb.
Sie hatten sich auf dem hiesigen College in Baldwin kennengelernt. Rylan hatte seinen Abschluss in Strafrecht gemacht und davon geträumt, zum FBI zu geben, während Griff schon damals ein Computer-Nerd gewesen war. Sie begegneten sich, als sie für dieselbe Sicherheitsfirma Alarmanlagen installierten. Gemeinsam hatten sie angefangen, mit einer neuen Datenbank zu experimentieren, die der zunehmenden Cyberkriminalität gewachsen war.
Damals hatte er angenommen, dass es ein Sommerprojekt sein würde, mit dem er sich einige Dollar zusätzlich verdienen könnte. Was kurz vor dem Abschluss praktisch war, denn sein Studienkredit hing wie ein Damoklesschwert über ihm.
Innerhalb weniger Monate jedoch hatten sie ein Interesse an ihrer Arbeit geweckt, das sie sprachlos machte. Diverse Behörden leasten das Programm. Danach fingen die beiden an, mehrere neue Sicherheitssysteme zu konzipieren, für die sie weltweite Lizenzen vergaben.
Rylan lebte den Traum.
Dennoch konnte er nichts gegen dieses Gefühl rastloser Unzufriedenheit tun, das ihn häufiger überkam.
Vermutlich war es zumindest teilweise der Tatsache geschuldet, dass er seinen Vater vermisste. Seit seine Mutter gestorben war, als Rylan zwölf war, waren die beiden ganz auf sich gestellt gewesen. Natürlich fehlte ihm der alte Herr, wenn sie nun einige tausend Meilen trennten.
Er ging über den geneigten Boden zu seinem Vater, der an der Spüle stand und das restliche Frühstücksgeschirr abwusch.
Rylan lehnte sich an die Arbeitsplatte und verschränkte die Arme vor der Brust. Dann betrachtete er das Gesicht, das seinem eigenen so ähnlich war: schmal, ausgeprägte Wangenknochen, eine gerade Nase und eine hohe Stirn. Und beide hatten sie die gleichen goldbraunen Augen.
Einige Unterschiede gab es allerdings. Rylans Haar war zu einem hellen Blond geblichen und sein Teint von den Stunden in der Sonne braungebrannt, während sein Vater dichtes silbernes Haar hatte und sein gegerbtes Gesicht vom langen Winter und dem noch längeren Frühling blass aussah.
Überdies war Elmer so hager, dass er beinahe nur noch aus Knochen und Sehnen bestand. Rylan hingegen war zwar schlank, verbrachte jedoch genug Zeit im Fitnesscenter, dass es am Strand nicht peinlich wurde.
»Fürs Erste hält die Stelle dicht, aber du musst einen Handwerker rufen«, sagte er zu seinem Vater. »Oder, noch besser, bestell ein Umzugsunternehmen und verkauf dieses verdammte Haus, bevor es über dir einstürzt.«
Elmer schnaubte, griff nach einem fadenscheinigen Geschirrtuch und trocknete sich die arthritischen Hände ab. Ein ganzes Leben auf der Farm hatte seinen Tribut gefordert.
»Ich verlasse dieses Haus nur in einem Sarg«, wiederholte er die Worte, die er immer von sich gab, seit Rylan erstmals einen Umzug vorgeschlagen hatte.
»Sturer alter Esel«, sagte Rylan.
Elmer warf das Handtuch beiseite. »Sieh es mal so, mein Sohn. Falls das Dach über mir einstürzt, sollte mich mein Dickschädel hinreichend schützen.«
»Gut möglich«, stimmte Rylan ihm zu. Dann schaute er seufzend hinaus zu dem tosenden Wasser, das nicht mal eine Meile entfernt vorbeirauschte. »Trotzdem würde ich mir wünschen, dass du mitkommst und bei mir bleibst, bis der Flusspegel wieder gesunken ist.«
Achselzuckend tat Elmer den Einwand mit jenem Selbstvertrauen ab, wie es typisch für einen Sechzigjährigen war, der schon so gut wie alles gesehen hatte.
»Anfang nächster Woche soll der Höchststand erreicht sein.«
»Falls es aufhört zu regnen.« Rylan blickte kritisch zu den dunklen Wolken, die so tief hingen, dass sie die Baumwipfel streiften. »Und danach sieht es nicht aus.«
»Hör auf zu unken«, sagte Elmer auf dem Weg zum kleinen Durchgang, durch den man auf die überdachte hintere Veranda gelangte. »Ich komme prima zurecht.«
Rylan folgte seinem Vater bis zum Durchgang, wo er sich mit einer Schulter in die Türzarge lehnte. »Gibt es einen Grund, weshalb du nicht bei mir sein willst?«
Elmer griff nach dem schlammverschmutzten Overall, der an einem Nagel hing. Die enge Veranda hatte einen schlichten Holzboden, und der Dachüberhang und die gerahmten Fliegenfenster hielten zwar das Ungeziefer draußen, nicht jedoch den eisigen Wind.
»In L.A. ist es zu sonnig.«
»Zu sonnig?« Rylan zog eine Augenbraue hoch, die einige Nuancen dunkler war als sein Haar. »Das ist dein Grund?«
»Jap.«
»Dir sind endlose Regentage lieber?«
»Ich mag es, mich beim Aufwachen überraschen zu lassen«, korrigierte Elmer und zog sich einen Overall über die Jeans und das Flanellhemd. »Hier kann es heiß oder kalt sein. Sonnig oder regnerisch. Man hat vielleicht ein bisschen Schnee, oder es kommt plötzlich ein Schneesturm.« Er machte den Reißverschluss zu, bevor er seinen durchdringenden Blick auf Rylan richtete. »Was ist mit dir? Wenn du morgens die Augen aufmachst, ist da nichts als Sonne, Sonne und noch mal Sonne.«
»Es wäre nur für ein oder zwei Monate«, beharrte Rylan. Er würde es genießen, seinen Vater bei sich zu haben, wenn er nach Kalifornien zurückkehrte, außerdem wollte er auch sämtliche Wasser- und Stromleitungen erneuern lassen. Bei einem vor über hundertfünfzig Jahren gebauten Haus standen dauernd Reparaturen an. »Nur lange genug, bis der Wasserstand wieder zurückgegangen ist und hier jemand ein paar Instandsetzungen vorgenommen hat.«
Elmer schnappte sich seine Gummistiefel und setzte sich auf die Kante eines Holzstuhls.
»Ich habe eine bessere Idee«, sagte er, während er mit dem ersten, von einer Thermosocke umhüllten Fuß in einen Gummistiefel schlüpfte.
»Und die wäre?«
»Warum ziehst du nicht zurück nach Hause, wo du hingehörst, und reparierst alles selbst? Computer sind ja gut und schön, aber ein Mann muss hin und wieder mit seinen Händen arbeiten.«
Rylan hätte sich ohrfeigen können. Er war geradewegs in die Falle getappt!
»Meine Arbeit …«
»Lässt sich von überall aus machen«, fiel Elmer ihm ins Wort und zog den zweiten Stiefel an.
»Okay«, sagte Rylan. Es stimmte. Obwohl er ab und zu Kunden treffen musste, bestand seine Arbeit größtenteils darin, sich per Video-Chat mit seinem Partner über Ideen für ihre neuesten Schöpfungen auszutauschen. Rylan machte Vorschläge in puncto Sicherheit und Verbrechensvermeidung, während sein Freund entschied, ob Rylans Vision technisch machbar war. »Doch im Gegensatz zu dir ziehe ich eine Aussicht, zu der ein Strand mit schönen, kaum verhüllten Frauen gehört, dem Blick auf schlammige Kuhweiden vor.«
Elmer stemmte sich hoch und bedachte seinen Sohn mit einem sehr strengen Blick.
»Wir haben hier sehr wohl hübsche Mädels, auch wenn die so klug sind, alles zu bedecken, was Gott ihnen geschenkt hat.«
Rylan stieß ein belustigtes Schnauben aus. »Eine Sünde!«
Elmer schüttelte den Kopf und steuerte die Fliegentür an, die in den Garten führte.
»Apropos hübsche Mädels, ich muss los.«
Rylan stutzte. Er hatte angenommen, dass sein Vater nach draußen wollte, um seinen täglichen Pflichten nachzukommen.
»Wohin?«
Elmer blickte über seine Schulter zurück. »Ich sehe nach Jaci. Sie müsste inzwischen von ihrer Lieferrunde zurück sein.«
Rylan runzelte die Stirn. »Warum?«
Der alte Mann zuckte mit den Schultern. »Das machen Nachbarn eben, wenn Schlechtwetter ist.«
»Wenigstens gibst du zu, dass es schlecht ist.«
Elmer stand in der offenen Tür und blickte mit einem Ausdruck kaum verhohlener Ungeduld zu seinem Sohn. »Kommst du jetzt?«
Rylan verzog das Gesicht. Ihm war nicht danach, in den kalten Regen hinauszulaufen.
»Wieso rufst du nicht an?«
Sein Vater schüttelte sichtlich enttäuscht den Kopf. »Macht ihr das in L.A. so? Redet nur aus der Ferne miteinander, damit ihr euch nicht in die Augen sehen müsst?«
Rylan wurde skeptisch. Der alte Herr war schon den ganzen Morgen in Gedanken.
Irgendwas ging hier vor.
»Na gut, alter Mann«, sagte er. »Was geht dir durch den Kopf?«
Elmers Miene verfinsterte sich. »Frank kam vorbei, ehe du heute Morgen aufgestanden bist.«
Ja, das erklärte die Stimmen, von denen er vor Morgengrauen aufgewacht war.
»Ich wunderte mich schon, dass ich jemanden hier zu so unchristlicher Zeit gehört habe«, sagte er. »Was wollte er?«
»Mir erzählen, dass er früh aufgestanden ist, um nach seinen unteren Feldern zu sehen. Die sind überflutet, weil in der Nacht der Deich gebrochen ist.«
»Und?«
Die Augen seines Vaters verdunkelten sich vor Sorge. Einer Sorge, die er bisher offensichtlich für sich behalten hatte.
»Und er sah eine Tote im Wasser treiben.«
Prompt spürte Rylan eine solche Angst in sich aufsteigen, dass er sich mit einer Hand an der Wand abstützen musste. Er schluckte, denn auf einmal hatte er einen Kloß im Hals.
»Er glaubt doch nicht, dass es Jaci war, oder?«
»Nein«, antwortete sein Vater kopfschüttelnd. »Da war nicht viel Licht, und die Leiche war in keinem guten Zustand, aber er ist sich sicher, dass die Frau langes Haar hatte.«
Rylan zwang sich, tief Luft zu holen.
Diese intensive Furcht war … gruselig.
Was an sich schon seltsam war. Er hatte Jaci höchstens bei einer Handvoll Gelegenheiten gesehen, seit er nach Kalifornien gezogen war. Und selbst als sie jünger waren, waren sie nicht mehr als Nachbarn gewesen. Dafür hatte er gesorgt.
Und natürlich war da noch diese Kleinigkeit, die sie ihm nie verzeihen würde. Er hatte sich geweigert zu glauben, dass sie gestalkt wurde, als er Teilzeit im Sheriffbüro arbeitete.
Nein, sie waren eindeutig nicht die dicksten Freunde, doch ein Teil von ihm wusste, dass seine Welt ein sehr viel finstererer Ort wäre, gäbe es sie nicht.
Er unterdrückte seine Erleichterung. Noch nie hatte er irgendwem von seinen widersprüchlichen Gefühlen erzählt, was Jaci Patterson betraf, und er würde sicher nicht jetzt damit anfangen.
»Und warum machst du dir dann Sorgen?«
»Frank sagte, dass er auch einen Schädel gesehen hat.«
»Oh Mann.« Rylans Aufmerksamkeit war nun vollständig gefesselt. »Hat er den Sheriff gerufen?«
»Natürlich hat er das.«
»Ich verstehe immer noch nicht, was das mit deiner Nachbarin zu tun hat«, sagte er, während er schon nach seiner alten Jacke und den Stiefeln griff, die er immer für seine Besuche hier deponiert hatte.
In Kalifornien brauchte er sie weiß Gott nicht!
»Jaci hat nie geglaubt, dass diese Medaillons, die sie bekam, nur irgendein schlechter Scherz waren«, erklärte Elmer, als sie die Stufen hinuntergingen und den durchweichten Garten durchquerten.
Rylan erschauderte, als ihm der eiskalte Regen ins Gesicht prasselte. Kam die Sonne denn nie wieder raus?
»Kriegt sie die immer noch?«, fragte er.
»Nicht, dass ich wüsste.« Elmer stapfte am Schuppen der Scheune vorbei, in der sein Rasenmäher stand. Dahinter bog er zur Lücke in der Hecke ab, die eine natürliche Grenze zwischen der Cooper- und der Patterson-Farm bildete. Es war sinnlos vorzuschlagen, dass sie den alten Pick-up nahmen, der nur wenige Schritte entfernt parkte. Rylans Vater war der festen Überzeugung, dass Gott ihm aus gutem Grund Füße geschenkt hatte. »Aber eine Leiche, die auf dem Feld ihres Nachbarn treibt, bringt sicher alle Erinnerungen zurück«, fuhr er fort, als sie durch die Hecke und auf eine Weide gingen.
Sie mühten sich durch den Matsch zu dem zweigeschossigen weißen Farmhaus mit der von Pfosten gestützten Veranda und den schwarzen Fensterläden. Das Haus ähnelte vielen anderen in der Gegend, mit Ausnahme der prächtigen Buntglasfenster im oberen Stockwerk, die Jacis Großvater gefertigt hatte.
»Wie es aussieht, kommt sie gerade von ihrer Lieferrunde zurück«, sagte Elmer mit einem Nicken zu dem schwarzen Jeep, der rückwärts vor der vorderen Veranda parkte.
»Welche Lieferrunde?«
»Sie backt Kuchen und Brote und verkauft sie an diverse Läden«, erklärte Elmer. »Sie fertigt auch Kunsthandwerkliches an, mit dem sie zu entsprechenden Messen fährt.«
Rylan nickte. Es schien die ideale Wahl für Jaci. Früher hatte er mal gehört, dass sie als Grafikerin in Columbia arbeiten würde, doch das schien nie zu ihr zu passen.
»Verpachtet sie ihr Land noch an Virgil Porter?«
»An seinen Sohn«, antwortete Elmer, während er Einfahrt und Vorgarten überquerte. »Andrew hat letztes Jahr größtenteils übernommen. Aber wenn der Regen nicht aufhört, kann hier niemand mehr irgendwas ernten.« Beide Männer blieben stehen, als die Frau hinter dem Jeep hervorkam. »Hi, Jaci!«, rief Rylans Vater.
Sie zuckte erschrocken zusammen über das plötzliche Auftauchen der Männer.
»Elmer.« Sie drückte eine Hand an ihre Brust. Dann wanderte ihr Blick zu Rylan, und sie presste die Lippen zusammen, als hätte sie eben einen Gestank wahrgenommen. »Und Rylan. Ich habe schon gehört, dass du zu Besuch bist.«
Rylan konnte nicht anders, als die Frau vor sich zu mustern.
Sie war immer schon auf eine frische Landmädchenart niedlich gewesen. Ihr honigblondes Haar war elfenhaft kurz geschnitten und umrahmte ihr Gesicht. Sie hatte große Augen, die heute eher grau als blau wirkten, und volle Lippen.
Doch während sie als Kind pummelig gewesen war, hatte sie in der Highschool Kurven entwickelt, die einem hormongesteuerten Jungen verwegene Gedanken bescherten. Was nur einer von mehreren Gründen war, weshalb er stets auf Abstand zu ihr geblieben war.
»Ist mir immer wieder ein Vergnügen, Jaci«, sagte er und versuchte, nicht darauf zu achten, wie sich das nasse Sweatshirt an ihre üppigen Brüste schmiegte und wie perfekt ihr Hintern in die enge Jeans passte.
»Ja, sehe ich«, erwiderte sie trocken, drehte sich um und öffnete die Heckklappe ihres Jeeps. Sie griff nach einer Einkaufstasche aus Leinen.
»Lass Rylan dir helfen, die Einkäufe reinzutragen«, befahl Elmer.
Sie griff nach einer zweiten Tasche. »Ist nicht nötig.«
Rylan verdrehte die Augen, trat vor und zog an den Taschenhenkeln in ihrem Klammergriff.
»Ich dachte, mein Dad wäre das sturste Stück Vieh hier in der Gegend«, sagte er.
»Vieh?«, wiederholte sie spöttisch.
Er zuckte mit den Schultern. »Ich wollte Missouri-Dickkopf sagen.«
»Nett.« Kopfschüttelnd drehte sie sich um und nahm einen Stapel leerer Tabletts aus dem Wagen. »Brauchst du irgendwas, Elmer?«
Elmer machte einen Schritt nach vorn, um die Heckklappe des Jeeps zu schließen, und begleitete Jaci zu den Stufen ihres Hauses.
»Ich wollte nur nachsehen, ob du nicht überflutet wurdest.«
»Noch nicht«, beruhigte sie ihn und lächelte den älteren Mann plötzlich an. Wie immer war es ein warmes, ernstgemeintes Lächeln. Als würde die Sonne aufgehen. Es hatte nichts gemein mit dem Lachen, bei dem zu viele und zu weiße Zähne zu sehen waren, wie bei den Frauen, mit denen Rylan in den letzten fünf Jahren ausgegangen war. »Im Keller steht ein bisschen Wasser, aber das erledigt die Sumpfpumpe.«
Rylans Vater nickte. »Ich nehme an, die hinteren Felder sind überflutet?«
»Wahrscheinlich.« Sie verzog das Gesicht, als sie zur Einfahrt blickte, die an ihrem Haus vorbei zu den Nebengebäuden und letztlich zum Land führte, das von den Porters bewirtschaftet wurde, seit Jacis Großvater vor zehn Jahren einen Schlaganfall erlitten hatte. »Wie es aussieht, war Andrew hier, um nach dem Wasser zu sehen, als ich weg war.«
Rylan blickte finster zu den tiefen Furchen, die von schweren Traktorreifen stammen mussten und ihr die Auffahrt ruinierten.
»Warum nimmt er nicht den Feldweg dorthin?«, fragte er.
Sie stieg die Holzstufen hinauf. »Die Brücke ist schon seit fast drei Wochen gesperrt.«
Rylan trat zu ihr auf die Veranda, wobei er weiter zu den tiefen Furchen blickte, in denen sich bereits Wasser sammelte.
»Er macht dir die Einfahrt kaputt.«
»Weiß ich«, sagte sie mit einem resignierten Achselzucken. »Aber dagegen kann ich nicht viel tun, solange es weiter regnet.« Sie streckte eine Hand zum Knauf der altmodischen Fliegentür aus. »Du kannst die Taschen auf die Schaukel …«
Sie verstummte abrupt und wurde plötzlich sehr blass.
»Jaci?« Rylan machte einen Schritt auf sie zu. »Was ist los?«
Die Tabletts fielen ihr aus der Hand und landeten scheppernd auf dem Verandaboden, während sie auf die Tür starrte, als hätte sie einen Geist gesehen.
Erst jetzt bemerkte Rylan, dass etwas an dem Türknauf baumelte. Er beugte sich vor und erkannte, dass es ein goldenes Medaillon an einer dünnen Kette war.
Heiser keuchte Rylan auf, als die Frau neben ihm schwankte und dann das Bewusstsein verlor. Er murmelte einen Fluch, ließ die Taschen fallen und fing Jaci auf, ehe sie auf dem harten Holzboden aufschlug.
Als er in ihr aschfahles Gesicht blickte, war seine Brust wie zugeschnürt.
Jemand hatte ihr ganz bewusst Todesangst eingejagt. Und er würde herausfinden, wer das war.
Kapitel vier
Mike O’Brien kehrte nach Heron zurück und parkte seinen Polizeitruck auf dem Kiesplatz. Einst hatte hier das Gefängnis gestanden, doch vor fünf Jahren war das Gebäude abgerissen und ein neues, modernes hinten an das alte Gericht angebaut worden.
Das neue Gefängnis verfügte über mehrere schicke Zellen und einen Gemeinschaftsbereich, in dem sich die Insassen tagsüber aufhalten konnten, sowie einen Aufnahmeraum mit allem Drum und Dran. In der Mitte hatte ein Deputy seinen Platz, der die Sicherheitsmonitore im Blick behielt. Und dahinter befand sich ein großer Befragungsraum, der gleichzeitig als Sheriffbüro fungieren sollte.
Mike zog jedoch sein abgewohntes ruhiges und altes Büro im Gerichtsgebäude vor.
Der rote zweistöckige Backsteinbau war beinahe zweihundert Jahre alt und hatte noch die ursprüngliche Wandverkleidung, die Holzböden und die Stuckrosetten in den Deckenmitten. Mikes Büro hatte eine Fensterzeile, von der man auf einen kleinen Park blickte, in dem im Sommer die Kinder spielten.
Dieses Büro betonte die Tradition seines Amtes und hielt ihm zugleich eine kostbare Zukunft vor Augen, die zu schützen ihm Pflicht und Ehre war.
Außerdem gab es eine Tür, die ihn von seinem Büro direkt in den neuen Trakt führte.
Es sprach mithin alles dafür, dass er in diesem Büro blieb.
Vor seinem privaten Eingang an der Seite tippte er den Code in das elektronische Schloss ein und ging dann hinein.
Er unterdrückte ein Gähnen, als er über die abgewetzten Dielen schritt. Es war erst Mittag und er schon müde.
Als er zu seinem Schreibtisch blickte, verzog er das Gesicht. Dort lag ein Stapel Papier, der wie von Geisterhand jeden Morgen aufs Neue auftauchte. Dies war der Teil seines Jobs, den er stets verdrängte, bis seine Sekretärin drohte, ihm Schlimmes anzutun. Wie beispielsweise ihn mit Handschellen an seinen Schreibtisch zu ketten, bis er alles durchgearbeitet hatte.
Achselzuckend ging er auf den Tisch in der Ecke zu. Dort schenkte er sich einen kalten Kaffee ein und schnappte sich einen Proteinriegel. Er wusste nicht, wer auf die Marketingidee gekommen war, einen Zuckerriegel mit dem Wort Protein