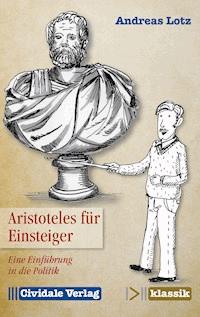
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cividale Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Cividale klassik
- Sprache: Deutsch
Ist die "Politie“ die bessere Demokratie? Dürfen Arme und Tugendlose so viel zu sagen haben wie Reiche und Tugendhafte? Und kann ein Gemeinwesen überhaupt noch stabil sein, wenn die Unterschiede zwischen arm und reich zu groß werden? Wie wichtig ist ein breiter Mittelstand für einen funktionierenden Staat? Erstaunlich aktuell, wenngleich nicht mehr überall modern, sind Aristoteles' vielschichtige Antworten auf diese und viele andere Fragen. Zentrale Fragen des politischen Denkens, die er vor weit über 2.000 Jahren gestellt hat! Andreas Lotz schildert, wie aktuell die politischen Grundgedanken des antiken Philosophen sind - lässt dabei aber auch die großen Unterschiede zum heutigen Gesellschaftsverständnis nicht außer Acht. Die Erläuterung der wichtigsten Aspekte der aristotelischen Politik - etwa, dass der Mensch von Natur aus ein staatenbildendes Wesen sei - wird von historischen Hintergrundinformationen abgerundet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Lotz
Aristoteles für Einsteiger
Eine Einführung in die Politik
Der Autor
Andreas Lotz ist Diplompolitologe und kooptiertes Mitglied im Sonderforschungsbereich "Transformation der Antike" an der Humboldt Universität zu Berlin. Er forscht und lehrt schwerpunktmäßig im Bereich der Politischen Theorie und Ideengeschichte.
1. Auflage
© Cividale Verlag Berlin, 2015
Kontakt: [email protected]
Website: www.cividale.de
ISBN 978-3-945219-10-2
Umschlaggestaltung: Nina und Christoph von Herrath
www.cvh-graphic-design.de
Lektorat: Carola Köhler
Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
1. Einleitung
2. Der Wandel der Gemeinschaftsformen im antiken Griechenland
2.1. Das mykenische Königtum
2.2 Die homerische Gesellschaft
2.3 Krisen und Wandel: Die griechische Welt vom 8. bis 6. Jahrhundert v. Chr.
2.4 Eunomia: Solons Reformen
2.5 Die Reformen des Kleisthenes
2.6 Attische Demokratie: Aufstieg und Niedergang
3. Das vollkommene Leben und der Mensch als „Zoon politikon“
3.1 Die Polis und das gute Leben
3.2 Worin unterscheiden sich die verschiedenen Formen der Herrschaft?
Exkurs: Aristoteles’ politische Ökonomie
3.3 Der Mensch als politisches Lebewesen
4. (Staats-)Verfassungen: Kritik, Analyse, Klassifikation
4.1 Einwände gegen den Lehrer: Aristoteles’ Kritik an Platons Staatsentwurf
4.2. Was ist eine (Staats-)Verfassung?
5. Resümee
6. Inhaltsübersicht und Lektüreempfehlungen
7. Literatur
7.1. Verwendete Primärliteratur
7.2. Kommentierte Sekundärliteratur
7.3 Weitere verwendete Literatur
8. Endnoten
1. Einleitung
Das von dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama zu Beginn der 1990er Jahre vorhergesagte „Ende der Geschichte“ lässt auf sich warten. Seine Zuversicht, es gäbe eine geschichtliche Bewegung hin zur liberalen Demokratie, die eine historisch zwangsläufige Entwicklung sei, mutet mittlerweile absurd an. Der gewissermaßen unvermeidliche historische Ablauf, den er dabei beschreibt, ähnelt einem Inklusionssog: Nach und nach würden die verschiedenen Streitpunkte und Widersprüche im homogenen Universalstaat liberaler Prägung aufgehoben, der sich als das Ordnungsmodell weltweit durchsetzen würde.i Spätestens seit der Banken- und Finanzkrise von 2007 und den darauffolgenden Protesten erweist sich die als notwendig behauptete Verbindung von Demokratie und Kapitalismus jedoch als brüchig.ii Da Demokratie und Kapitalismus jeweils von unterschiedlichen Prinzipien geleitet werden – für Erstere gelten Allgemeinwohlorientierung, politische Gleichheit sowie Verfahren konsensueller oder majoritärer Entscheidungsfindung, während Letzterer für Eigentumsrechte, ungleiche Besitzverhältnisse, individuelle Gewinnorientierung und hierarchische Entscheidungsstrukturen steht – ist die Verbindung zwischen diesen beiden keine „naturgegebene“ (Merkel 2014).
Schon einige Jahre vor dieser weltweiten ökonomischen Krise hatte der britische Sozialwissenschaftler Colin Crouch beschrieben, dass die liberale Demokratie zum Zustand der „Postdemokratie“ hin tendiert. In der Postdemokratie gebe es zwar nach wie vor Wahlen, „die sogar dazu führen, dass Regierungen ihren Abschied nehmen müssen, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle, sie reagieren nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser politischen Inszenierung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten.“iii
Das heißt, bestimmte demokratische Institutionen sind zwar formal weiterhin intakt, doch die politische Kommunikation zwischen Politikern und Bürgern verkommt zu einer Marketingangelegenheit: Nach Crouch greifen die politischen Eliten auf bestimmte Techniken der politischen Manipulation zurück, mit deren Hilfe sie die sogenannte öffentliche Meinung ermitteln können, ohne dass diese Prozesse jedoch durch die Bürger zu kontrollieren sind. Gleichzeitig werden die Parteiprogramme immer oberflächlicher, und die politischen Botschaften ähneln Werbeslogans: „Werbung ist keine Form des rationalen Dialogs. Sie baut keine Argumentation auf, die sich auf Beweise stützen könnte, sondern bringt ihr Produkt mit speziellen visuellen Vorstellungen in Verbindung. […] Ihr Ziel ist es nicht, jemanden in eine Diskussion zu verwickeln, sondern ihn zum Kauf zu überreden. Die Übernahme dieser Methoden hat den Politikern dabei geholfen, das Problem der Kommunikation mit dem Massenpublikum zu bewältigen; der Demokratie selbst haben sie damit jedoch einen Bärendienst erwiesen.“iv In der Konsequenz durchdringt die marktwirtschaftliche Logik nach und nach alle Bereiche des (öffentlichen) Lebens, gestaltet das Denken um und zersetzt die Grundlagen des demokratischen Gemeinwesens.v Durch die Ökonomisierung unterschiedlichster Lebensbereiche verwandelt sich der Bürger in einen Konsumentenvi bzw. wird zu einem „unternehmerischen Selbst“vii umgeformt.
Vor derartigen Prozessen in der politischen Entwicklung eines Gemeinwesens warnte vor mehr als zweitausend Jahren bereits Aristoteles in seiner wichtigsten staatstheoretischen Schrift, der Politik (gr. Politika „Dinge, die das Gemeinwesen betreffen“). Dieses in acht Bücher aufgeteilte, uns nur fragmentarisch überlieferte Werk, das nach der aristotelischen Einteilung der praktischen Wissenschaft zuzurechnen ist, knüpft an Aristoteles’ Nikomachische Ethik an – was die normative Prägung der Politik erklärt – und behandelt solche Themen wie politische Anthropologie, legitime und illegitime Staatsverfassungen oder auch Ökonomie.
Gleich zu Beginn unterscheidet Aristoteles zwischen der „natürlichen“ Hauserwerbsökonomie und der auf (schrankenlose) Geldvermehrung ausgerichteten Handels- und Gelderwerbswirtschaft und zeigt die Gefahr auf, die das Eindringen der Profitlogik in das Denken und Handeln der Bürger darstellt: Wenn Tugenden und Fertigkeiten nur als Mittel zum Gelderwerb gelten, dann werden sie hinsichtlich ihrer sozialen Funktion entwertet – eine Entwicklung, die auf Dauer die politische Gemeinschaft gefährdet (Pol. I, 1257b–1258a).viii An anderer Stelle beschreibt der antike Philosoph die negativen Folgen einer unverhältnismäßigen Vermögensvermehrung durch wenige. Dabei vergleicht er den Staat mit einem Körper und weist darauf hin, dass das übersteigerte Wachstum von Extremitäten nicht nur den Gesundheitszustand eines Wesens gefährden, sondern auch aus dieser überproportionalen Vermehrung unter Umständen ein anderes Lebewesen hervorgehen könne – wodurch ein Umschlagen von Quantität in Qualität erfolge. Dementsprechend bestehe eine der Gefahren für einen demokratisch geprägten Staat in der wachsenden Zahl der Reichen oder in der unverhältnismäßigen Vergrößerung der Vermögen: beide Entwicklungen führten dazu, dass die Demokratie in Oligarchie umschlage (Pol. V, 1302b–1303a).
Die Spaltung innerhalb der polis (urspr. „Burg“, später „Stadt“, „Staat“, für Aristoteles auch gleichbedeutend mit „Bürgerschaft“) verläuft Aristoteles zufolge entlang des Gegensatzes zwischen Arm und Reich (etwa Pol. III, 1279b–1280a; Pol. V, 1301b–1302a). An der Doppeldeutigkeit des Wortes dēmos (urspr. „Dorfgemeinde“) wird sichtbar, dass die polis kein harmonisches Ganzes ist: Denn dēmos bezeichnet einerseits die Bürgerschaft als Ganzes und meint andererseits die Armen bzw. die Vielen.ix Diese sind somit Teil des gesamten Volkes, stehen aber auch für das ganze Volk – mit ihrem gewissermaßen leeren Eigentum der gleichen Freiheit,x an dem nicht nur sie, sondern alle einen Anteil habenxi: „[D]en Reichtum haben wenige, an der Freiheit aber nehmen alle teil“ (Pol. III, 1280a).
Eine strukturell ähnliche Unterscheidung führt Wolfgang Streeck ein, der die Prozesse der „politischen Entmachtung der Massendemokratie“ seit den späten 1970er Jahren beschreibt, die sich seiner Meinung nach auch als „eine Geschichte des Ausbruchs des Kapitals aus einer sozialen Regulierung“ lesen lassen. Im „demokratischen Schuldenstaat“xii, dessen Politik den Ansprüchen zweier unterschiedlicher Kollektive ausgesetzt ist, gibt es auf der einen Seite das Staatsvolk, das aus Bürgern besteht, die national organisiert sowie an ein Staatsgebiet gebunden sind. Sie verfügen über bestimmte, unveräußerliche Rechte, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Dafür sind sie dem demokratischen Staat Loyalität schuldig, einschließlich der Abführung von Steuern. Auf der anderen Seite richtet das Marktvolk seine Forderungen an die staatliche Politik, dessen Mitglieder lediglich vertraglich an den jeweiligen Nationalstaat gebunden sind, „als Investoren statt als Bürger. Ihre Rechte dem Staat gegenüber sind nicht öffentlicher, sondern privater Art: nicht aus der Verfassung resultierend, sondern aus dem Zivilrecht. Statt diffuser und politisch erweiterbarer Bürgerrechte haben sie gegenüber dem Staat spezifische, vor Zivilgerichten grundsätzlich einklagbare und durch Vertragserfüllung ablösbare Forderungen.“xiii Streecks Abhandlung zielt auf die gleiche Spannung, die bereits in Aristoteles’ Analysen zum Ausdruck kommt: Es geht um zwei sich widerstreitende Logiken innerhalb eines Gemeinwesens oder Staates, die jeweils über unterschiedliche Anrechte sowie bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen verfügen und entsprechende Rechte geltend machen, damit jedoch die soziale und politische Stabilität der Gesamtheit gefährden (siehe dazu etwa Pol. III, 1280a; V, 1302a).
Das analytische Rüstzeug, das Aristoteles’ Politik bietet, ist somit bei achtsamer Anwendung keineswegs veraltet. Ebenso aktuell sind sein Hinweis auf die Bedeutung einer breiten Mittelschicht für ein stabiles Gemeinwesen sowie seine Warnungen vor der Erosion der gesellschaftlichen Mitte: „Dass aber ein Staat aus solchen Mittelexistenzen der Beste ist, liegt zutage. Er allein ist frei von Aufruhr; denn wo der Mittelstand zahlreich ist, da entstehen am wenigsten Aufstände und Zwiste unter den Bürgern“ (Pol. IV, 1296a). „Der Gesetzgeber muss aber immer den Mittelstand in seine Verfassung mit aufnehmen; macht er die Gesetze oligarchisch, so muss er ihn mit berücksichtigen; macht er sie demokratisch, so muss er ihn für sie zu gewinnen suchen. Wo die Gesamtheit des Mittelstandes beide Extreme oder auch nur eines von ihnen überwiegt, da kann die Verfassung von Dauer sein“ (Pol. IV, 1296b).
Ähnliche Vorstellungen einer Bedrohung der gesellschaftlichen Mitte kamen in Europa am Ende des 20. Jahrhunderts auf und schlugen sich in einer wachsenden Literatur über die Spaltung der Gesellschaft nieder.xiv Dabei wird nicht zuletzt der gesamtgesellschaftliche Nutzen der Integrationsleistung der Mitte sowie deren Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft hervorgehoben. Denn eine starke und zugleich adaptionsfreudige Mitte ermöglicht es Gesellschaften, den sich verändernden Umständen bzw. Anforderungen auf angemessene Weise zu begegnen. Gerade diese Erkenntnis wird auf Aristoteles zurückgeführt.xv
Die Gegenwartsrelevanz der aristotelischen Politik erschließt sich nicht sofort. Dazu bedarf es einer geduldig-genauen Lektüre sowie der Kenntnisse antiker Gemeinschaftsformen, deren sozialer Konflikte sowie der Regierungsweisen im antiken Griechenland. Da all diese Aspekte in die Abhandlung Aristoteles’ einfließen und von ihm analysiert und kritisch verarbeitet werden, beginnt die vorliegende Einleitung mit einer historischen Darstellung des antiken Griechenlands, die zum besseren Verständnis der Politik beiträgt. Anschließend soll der Zugang zum Text durch eine Betrachtung der konzeptionellen Grundlagen und Argumentationsweisen erleichtert werden. Vor diesem Hintergrund wird auf die Bedeutung der Politik für die Gegenwart abschließend nochmals kurz eingegangen.
2. Der Wandel der Gemeinschaftsformen im antiken Griechenland
2.1. Das mykenische Königtumxvi
Die polis, jene spezifische Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Antike, und das rationale Denken sind hinsichtlich ihrer Genese miteinander verflochten. Die Voraussetzungen für ihre Entstehung wurden auf lange Sicht durch den Untergang des mykenischen Königtums geschaffen, dessen soziopolitische Organisation und dessen Wirtschaftssystem der zentral gelenkten Herrschaftsordnung der großen Königreiche des Vorderen Orients glichen: Alle Fäden des sozialen Lebens liefen im Palast zusammen, der nicht nur der politische und ökonomische Mittelpunkt war, sondern auch eine administrative, militärische sowie religiöse Rolle spielte.xvii
Die Person des Königs umfasste alle Momente der Macht. Seine Autorität dehnte sich auf sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aus, das er mithilfe eines Verwaltungsapparates, der aus Schreibern, königlichen Inspektoren und Würdenträgern des Palastes bestand, kontrollierte und reglementierte. Bis in alle Einzelheiten überwachte und regelte die königliche Verwaltung die Herstellung, den Austausch und die Verteilung der Güter, wodurch der Herrschaftsbereich zu einem Ganzen zusammengefügt wurde. Der Palast bestimmte nicht nur über die Zirkulation von Produkten, Arbeiten und Dienstleistungen, die Verwaltungsbeamten kontrollierten auch das Militärwesen – angefangen bei der Bereitstellung der Waffen bis zur Zusammensetzung der Einheiten. Sie standen in einem persönlichen Gefolgschaftsverhältnis zum Autokraten, zu dessen Befugnissen nicht zuletzt die Aufsicht über das religiöse Leben gehörte. Demnach waren sie nicht im Staatsdienst tätig, sondern dienten dem Königxviii, den sie mit wa-na-ka titulierten – eine Bezeichnung, die bei Homer als wanax vorkommt, wobei das W am Wortanfang meistens wegfällt.
Homer gebrauchte daneben ein anderes Wort für König: basileus, das auf qa-si-re-u zurückgeht.xix Mit diesem Ausdruck wurden Grundherren auf dem Land bezeichnet, die neben den Aristokraten der Hofgesellschaft und der gehobenen Palastverwaltung die lokale Führungsschicht bildeten. Die basileis waren Vasallen des (w)anax und hatten deshalb auch eine gewisse Verwaltungsverantwortung. Einerseits waren sie in den doppelten Kreislauf von Abgaben und Gratifikationen eingebunden. Andererseits agierten sie, im Vergleich zu den Palastbeamten, verhältnismäßig unabhängig, ebenso wie die ländlichen Gemeinschaften. Diese dörflichen dēmen verfügten jeweils über Gemeineigentum und regelten im Einklang mit den Traditionen sowie den örtlichen Hierarchien bestimmte Probleme, wie die Verteilung der Feldarbeit, Nachbarschaftsbeziehungen und Weideverhältnisse. Die relative Autonomie der Dorfgemeinden wurde ferner am Rat der Alten – ke-ro-si-ja – sichtbar, in dem die Vorstände der einflussreichsten Familien saßen. Die einfachen Dorfbewohner, der dēmos





























