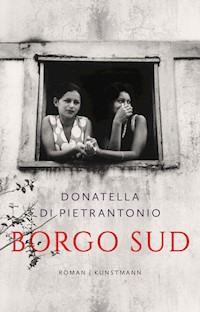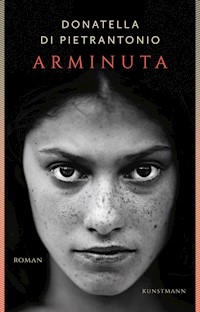
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Dorf nennen sie alle nur Arminuta, die Zurückgekommene. Warum hat man sie zu ihren leiblichen Eltern zurückgeschickt? Wer ist ihre Mutter? Die, die sie geboren hat, oder die, bei der sie aufgewachsen ist? »Als Dreizehnjährige kannte ich meine andere Mutter nicht mehr.« So beginnt die Geschichte, in der ein junges Mädchen mit einem Koffer und einem Sack voller Schuhe bei einer ihr unbekannten Familie abgeliefert wird. Die echten Eltern wollten sie wieder haben, mehr haben ihr die, die sie bisher Vater und Mutter nannte, nicht erklärt. Niemand scheint auf sie gewartet zu haben, alle haben offensichtlich andere Sorgen. Das Essen ist knapp, die Neue muss sich das Bett mit der kleinen Schwester teilen und das Zimmer mit den drei Brüdern. Hier ist alles fremd, die Armut, der Schmutz, die harten Worte. Während sie einen Weg zurück in ihr behütetes Leben in dem kleinen Haus am Strand sucht, entwickeln sich neue Bindungen, zur mutigen Schwester, den Brüdern, der Mutter. Und sie beginnt zu verstehen, wie viele Facetten die Liebe haben kann. Donatella Di Pietrantonio erzählt in dieser ungewöhnlichen Familiengeschichte von Zugehörigkeit und Verantwortung, Verstrickungen und Mutterliebe und davon, was es bedeutet, den eigenen Platz im Leben zu finden. Poetisch, zart und unvergesslich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Im Dorf nennen sie alle nur Arminuta, die Zurückgekommene. Warum hat man sie zu ihren leiblichen Eltern zurückgeschickt? Wer ist ihre Mutter? Die, die sie geboren hat, oder die, bei der sie aufgewachsen ist?
»Als Dreizehnjährige kannte ich meine andere Mutter nicht mehr.« So beginnt die Geschichte, in der ein junges Mädchen mit einem Koffer und einem Sack voller Schuhe bei einer ihr unbekannten Familie abgeliefert wird. Die echten Eltern wollten sie wieder haben, mehr haben ihr die, die sie bisher Vater und Mutter nannte, nicht erklärt. Niemand scheint auf sie gewartet zu haben, alle haben offensichtlich andere Sorgen. Das Essen ist knapp, die Neue muss sich das Bett mit der kleinen Schwester teilen und das Zimmer mit den drei Brüdern. Hier ist alles fremd, die Armut, der Schmutz, die harten Worte. Während sie einen Weg zurück in ihr behütetes Leben in dem kleinen Haus am Strand sucht, entwickeln sich neue Bindungen, zur mutigen Schwester, den Brüdern, der Mutter. Und sie beginnt zu verstehen, wie viele Facetten die Liebe haben kann.
Donatella Di Pietrantonio erzählt in dieser ungewöhnlichen Familiengeschichte von Zugehörigkeit und Verantwortung, Verstrickungen und Mutterliebe und davon, was es bedeutet, den eigenen Platz im Leben zu finden. Poetisch, zart und unvergesslich.
Über die Autorin
Donatella Di Pietrantonio wurde in den Abruzzen geboren und lebt heute in der Nähe von Pescara. Ihre Romane Meine Mutter ist ein Fluss (Kunstmann 2013) und Bella mia (Kunstmann 2015) wurden mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet. Mit ihrem neuen, in zahlreiche Länder verkauften Buch ist ihr der internationale Durchbruch gelungen.
Donatella Di Pietrantonio
ARMINUTA
Roman
Aus dem Italienischenvon Maja Pflug
Verlag Antje Kunstmann
Für Piergiorgio, der nur so kurz da war
Noch heute bin ich in gewisser Weise bei jenem Kindheitssommer stehen geblieben, um den meine Seele weiterhin kreiste und unentwegt anstieß, wie ein Insekt an eine blendende Lampe.
ELSA MORANTE, Lüge und Zauberei
1
Als Dreizehnjährige kannte ich meine andere Mutter nicht mehr.
Mit einem klobigen Koffer und einer Tasche voller durcheinandergeworfener Schuhe stieg ich mühsam die Treppe zu ihrer Wohnung hinauf. Oben angekommen, empfingen mich der Geruch nach Frittiertem und eine Erwartung. Die Tür wollte nicht aufgehen, jemand rüttelte wortlos von innen daran und hantierte am Schloss. Ich beobachtete eine Spinne, die am Ende ihres Fadens hängend im Leeren zappelte.
Nach dem metallischen Klick erschien ein kleines Mädchen mit gelockerten, schon einige Tage alten Zöpfen. Sie war meine Schwester, aber ich hatte sie noch nie gesehen. Sie riss die Tür auf, um mich eintreten zu lassen, und starrte mich mit stechenden Augen an. Damals ähnelten wir uns, mehr als später als Erwachsene.
2
Die Frau, die mich geboren hatte, stand nicht von ihrem Stuhl auf. Das Kind, das sie im Arm hielt, kaute auf einer Seite des Mundes am Daumen, vielleicht bekam es gerade einen Zahn. Beide sahen mich an, und das Baby unterbrach sein eintöniges Gewimmer. Ich wusste nicht, dass ich so einen kleinen Bruder hatte.
»Da bist du ja«, sagte sie. »Stell dein Zeug ruhig ab.« Ich schlug die Augen nieder bei dem Geruch nach Schuhen, der aus der Tasche drang, auch wenn ich sie kaum bewegte. Aus dem hinteren Zimmer, dessen Tür angelehnt war, kam ein angespanntes, lautes Schnarchen. Das Kind fing wieder an zu wimmern und drehte sich zum Busen hin, sein Speichel tropfte auf die schweißnassen Blumen des verwaschenen Baumwollkleids.
»Mach zu, worauf wartest du?«, herrschte die Mutter das kleine Mädchen an, das reglos stehen geblieben war.
»Kommen die, die sie hergebracht haben, nicht rauf?«, wandte die Kleine ein, indem sie mit ihrem spitzen Kinn auf mich deutete.
In dem Moment kam der Onkel, ich musste lernen, ihn so zu nennen, vom Treppensteigen außer Atem zur Tür her ein. In der Hitze des Sommernachmittags hielt er mit zwei Fingern den Kleiderbügel mit einem Mantel in meiner Größe hoch.
»Ist deine Frau nicht mitgekommen?«, fragte meine erste Mutter und hob die Stimme, um das Weinen zu übertönen, das in ihren Armen zunahm.
»Sie rührt sich nicht aus dem Bett weg«, erwiderte er mit einer unwilligen Kopfbewegung. »Gestern bin dann ich losgegangen, um was zu kaufen, auch für den Winter.« Er zeigte ihr das Etikett mit der Marke meines Mantels.
Ich trat ans offene Fenster und stellte mein Gepäck ab. In der Ferne rasselndes Getöse, wie von Steinen, die von einem Lastwagen gekippt werden.
Die Hausherrin beschloss, dem Gast einen Kaffee anzubieten, sicher würde der Duft auch ihren Mann wecken, sagte sie. Nachdem sie das weinende Baby in die Krabbelbox gesetzt hatte, ging sie vom kahlen Esszimmer in die Küche. Das Baby klammerte sich auf der Höhe eines grob mit Schnur geflickten Lochs an das Netz und versuchte, sich aufzurichten. Als ich mich näherte, brüllte es verärgert lauter. Die Alltagsschwester hob es mit einer Anstrengung heraus und setzte es auf den Graniglia-Fliesen ab. Auf allen vieren krabbelte es in Richtung der Stimmen in der Küche. Der Blick meiner Schwester wanderte von dem kleinen Bruder zu mir, blieb aber gesenkt. Brachte die vergoldeten Schnallen meiner neuen Schuhe zum Glühen, stieg an den blauen Falten meines fabrikneuen, noch steifen Kleids empor. Hinter ihr summte auf halber Höhe eine Schmeißfliege und prallte ab und zu gegen die Wand bei dem Versuch, eine Öffnung ins Freie zu finden.
»Hat der da dir auch das Kleid gekauft?«, fragte sie leise.
»Ja, gestern, extra für den Umzug hierher.«
»Aber was ist der eigentlich für dich?«, erkundigte sie sich neugierig.
»Ein entfernter Onkel. Bis heute habe ich bei ihm und seiner Frau gewohnt.«
»Und welche ist dann deine Mama?«, fragte sie entmutigt.
»Ich habe zwei. Eine ist deine Mutter.«
»Manchmal hat sie von einer größeren Schwester geredet, aber der glaub ich wenig.«
Plötzlich fasste sie mich mit gierigen Fingern am Kleiderärmel.
»Das passt dir nicht mehr lang. Nächstes Jahr kannst du’s an mich weitergeben, pass auf, dass du’s mir nicht kaputt machst.«
Barfuß und gähnend kam der Vater aus dem Schlafzimmer. Mit nacktem Oberkörper. Während er dem Kaffeeduft nachging, sah er mich.
»Da bist du ja«, sagte er, genau wie seine Frau.
3
Aus der Küche drangen nur noch vereinzelte, leblose Worte, die Löffelchen klirrten nicht mehr. Als ich Stühle rücken hörte, packte mich die Angst, im Hals. Der Onkel trat zu mir und strich mir zum Abschied flüchtig über die Wange.
»Sei brav«, sagte er.
»Ich habe ein Buch im Auto vergessen, ich gehe mit runter.« Ich folgte ihm die Treppe hinunter.
Mit der Ausrede, im Handschuhfach nachzusehen, stieg ich ein, schlug die Tür zu und drückte die Verriegelung.
»Was machst du da?«, fragte er, schon am Steuer sitzend.
»Ich fahre mit dir zurück, ich werde euch nicht stören. Im Gegenteil, Mama ist krank und braucht meine Hilfe. Hier bleibe ich nicht, ich kenne die da oben doch gar nicht.«
»Fang jetzt nicht wieder an, versuche, vernünftig zu sein. Deine echten Eltern erwarten dich, sie werden dich mögen. Es ist bestimmt lustig, in einem Haus voller Kinder zu leben.« Sein Atem roch nach dem eben getrunkenen Kaffee und nach seinem Zahnfleisch.
»Ich will zu Hause leben, mit euch. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, sag es mir, und ich werde es nicht wieder tun. Lass mich nicht hier.«
»Es geht nicht anders, wir können dich leider nicht mehr behalten, wir haben es dir schon erklärt. Jetzt hör bitte auf mit deinen Zicken und steig aus.« Er starrte vor sich ins Leere. Unter dem mehrtägigen Bart zuckten seine Kiefermuskeln wie manchmal, wenn er gleich wütend wurde.
Ich gehorchte ihm nicht, sondern leistete weiter Widerstand. Da schlug er mit der Faust aufs Lenkrad und stieg aus, um mich aus dem engen Fußraum vor dem Sitz zu zerren, wohin ich mich zitternd verkrochen hatte. Er schloss die Tür auf und packte mich am Arm, die Schulternaht des Kleides, das er mir gekauft hatte, riss ein paar Zentimeter auf. In seinem Griff erkannte ich den wortkargen Vater nicht wieder, mit dem ich bis zu jenem Morgen zusammengelebt hatte.
Auf dem Asphalt blieben die Reifenspuren zurück, und ich. Es roch nach verbranntem Gummi. Als ich den Kopf hob, schaute im zweiten Stock jemand von meiner Zwangsfamilie aus dem Fenster.
Nach einer halben Stunde kam er zurück, ich hörte es klingeln und dann seine Stimme auf dem Treppenabsatz. Augenblicklich verzieh ich ihm und griff freudig und beschwingt wieder nach meinem Gepäck, doch als ich an der Türe war, verklangen seine Schritte schon unten im Hauseingang. Meine Schwester hielt einen Becher Vanilleeis in der Hand, meine Lieblingssorte. Darum war er gekommen, nicht, um mich mitzunehmen. Das Eis haben die anderen gegessen, an jenem Nachmittag im August 1975.
4
Gegen Abend kamen die größeren Jungen heim, einer begrüßte mich mit einem Pfiff, ein anderer bemerkte mich gar nicht. Schubsend stürmten sie in die Küche, um einen Platz am Tisch zu ergattern, wo die Mutter das Abendessen auftrug. Mit Sugo spritzend füllten sie sich die Teller, an meiner Ecke kam nur ein schwammiges Fleischklößchen mit etwas Soße an. Innen war es hell, bestand aus eingeweichtem, alten Brot und wenigen Fleischkrümeln. Wir aßen Brotklößchen und dazu noch mehr in die Soße getunktes Brot, damit der Magen etwas zu tun hatte. Einige Tage später würde ich beim Kampf um das Essen mithalten und auf meinen Teller aufpassen können, um ihn gegen die Luftangriffe fremder Gabeln zu verteidigen. Aber an jenem Tag verlor ich das bisschen, das die Hand der Mutter zu meiner kargen Ration hinzugefügt hatte.
Erst nach dem Abendessen fiel meinen ersten Eltern ein, dass es in der Wohnung gar kein Bett für mich gab.
»Heut Nacht schläfst du bei deiner Schwester, ihr seid ja dünn genug«, sagte der Vater. »Morgen schaun wir mal.«
»Damit wir beide reinpassen, müssen wir verkehrt rum liegen«, erklärte mir Adriana, »der Kopf der einen an den Füßen der anderen. Aber vorher waschen wir sie uns«, beruhigte sie mich.
Wir tauchten sie in dieselbe Schüssel, sie schrubbte ewig, um den Schmutz zwischen den Zehen zu entfernen.
»Pah, ist das Wasser schwarz«, lachte sie, »das waren meine Füße, deine waren eh sauber.«
Sie beschaffte mir ein Kissen, dann gingen wir ins Kinderzimmer, ohne das Licht anzuknipsen, die Jungen atmeten schon wie Schlafende, und der Schweißgeruch war penetrant. Flüsternd legten wir uns Kopf an Füße zurecht. Die mit Schafwolle gefüllte Matratze war weich und vom Gebrauch verformt, ich sank zur Mitte hin ein. Sie roch nach Ammoniak von dem vielen Pipi, das sie durchtränkt hatte, ein für mich neuer, abstoßender Geruch. Die Schnaken suchten nach Blut, und ich wollte mich besser zudecken mit dem Laken, doch Adriana zog in die entgegengesetzte Richtung.
Ein plötzliches Zucken ihres Körpers, vielleicht träumte sie herauszufallen. Vorsichtig nahm ich einen Fuß von ihr und legte meine Wange an die frisch mit billiger Seife gewaschene Sohle. Fast die ganze Nacht schmiegte ich mich an die raue Haut, passte mich den Beinbewegungen an. Ich spürte an meinen Fingern die unregelmäßigen Ränder ihrer gesplitterten Zehennägel. Mein Gepäck enthielt auch ein Nagelscherchen, das konnte ich ihr am nächsten Morgen geben.
Das letzte Viertel des Mondes erschien im offenen Fenster und zog vorbei. Zurück blieb die Sternenspur und das winzige Glück, auf dieser Seite einen nicht von Häusern verstellten Himmel zu haben.
Morgen schaun wir mal, hatte der Vater gesagt, doch dann vergaß er es. Adriana und ich fragten nicht nach. Jeden Abend lieh sie mir eine Fußsohle, um sie an meine Wange zu halten. Sonst hatte ich nichts, in dieser von Atem bevölkerten Dunkelheit.
5
Nasse Wärme breitete sich unter meinen Rippen und meiner Hüfte aus, ich sprang ruckartig auf. Ich fasste mir zwischen die Beine, es war trocken. Adriana bewegte sich im Dunkeln, blieb aber liegen. In eine Ecke gekauert, schlief sie wieder ein oder einfach weiter, als wäre sie daran gewöhnt. Nach einer Weile legte auch ich mich wieder ins Bett, machte mich so klein, wie ich konnte. Wir waren zwei Körper, die die Nässe umrahmten.
Ganz allmählich verdampfte der Geruch, nur ab und zu noch eine kleine, stinkende Wolke. Kurz vor Tagesanbruch bewegte sich einer der Jungen, ich konnte nicht erkennen, welcher, einige Minuten lang immer schneller stöhnend hin und her.
Am Morgen wachte Adriana auf und blieb mit offenen Augen still liegen, den Kopf auf dem Kissen. Dann sah sie mich einen Augenblick lang wortlos an. Das Baby auf dem Arm, kam die Mutter, um sie zu rufen, und schnupperte in der Luft.
»Du hast dich schon wieder vollgepisst, na prima. Damit sie dich sofort richtig kennenlernt.«
»Ich war’s nicht«, antwortete Adriana und drehte sich zur Wand.
»Ach, womöglich war’s deine Schwester, so gut wie die erzogen ist. Beeil dich, wir sind spät dran.« Damit verschwanden sie in der Küche.
Ich war nicht bereit, ihnen zu folgen, und außerdem konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich blieb stehen, mir fehlte sogar der Mut, ins Bad zu gehen. Einer der Brüder setzte sich breitbeinig im Bett auf. Mit einer Hand wog er gähnend seine geschwollene Unterhose. Als er mich im Zimmer bemerkte, runzelte er leicht die Stirn und begann, mich zu mustern. Sein Blick blieb an meinem Busen hängen, der nur von dem Unterhemd bedeckt war, das ich bei der Hitze statt des Pyjamas trug. Instinktiv verschränkte ich die Arme über der Schwellung, die mir erst kürzlich gewachsen war, während unter der Achsel der Schweiß austrat.
»Hast du hier drin geschlafen?«, fragte er mit einer unreifen Männerstimme.
Ich nickte verlegen, während er mich weiter ohne Scham betrachtete.
»Bist du schon fünfzehn?«
»Nein, noch nicht mal vierzehn.«
»Du siehst aber aus wie fünfzehn, sogar älter. Hast dich früh entwickelt«, sagte er abschließend.
»Wie alt bist du?«, fragte ich aus Höflichkeit.
»Fast achtzehn, ich bin der Älteste. Ich arbeite schon, aber heute bin ich nicht dran.«
»Warum?«
»Heute braucht der Chef mich nicht. Er ruft mich, wenn Not am Mann ist.«
»Als was arbeitest du denn?«
»Als Handlanger.«
»Und die Schule?«
»Tja, die Schule! In der zweiten Klasse Mittelschule bin ich abgegangen, sie hätten mich sowieso durchfallen lassen.«
Ich sah die von der Arbeit ausgeprägten Muskeln, die breiten Schultern. Ein kastanienbraunes Gekräusel kletterte seinen sonnenverbrannten Oberkörper hinauf und weiter bis ins Gesicht. Auch er musste schnell gewachsen sein. Als er sich dehnte, roch ich seinen männlichen Geruch, nicht unangenehm. Eine fischgrätenförmige Narbe zierte seine linke Schläfe, vielleicht eine alte, schlecht genähte Verletzung.
Wir sprachen nicht mehr, er betrachtete wieder meinen Körper. Ab und zu verschob er sein Geschlechtsteil mit der Hand so, dass es weniger auffiel. Ich wollte mich anziehen, hatte aber am Vortag meinen Koffer nicht ausgepackt, er stand noch nebenan; um ihn zu holen, hätte ich mich vor seinen Augen umdrehen und einige Schritte gehen müssen. Ich wartete, dass etwas geschah. Sein Blick glitt langsam an meinen mit weißer Baumwolle bedeckten Hüften hinunter bis zu den nackten Beinen, den verkrampften Füßen. Ich würde mich nicht umdrehen.
Die Mutter kam herein und sagte, er solle sich beeilen, ein Nachbar brauche Hilfe bei der Feldarbeit. Im Gegenzug bekämen sie Kisten mit reifen Tomaten, von denen zum Einmachen.
»Du geh mit deiner Schwester zum Milchholen, wenn ihr frühstücken wollt«, befahl sie dann mir, bemüht, ihren Ton zu mildern, doch am Ende des Satzes klang er wieder wie immer.
Im anderen Zimmer war das Baby zu der Tasche mit meinen Schuhen gekrabbelt und hatte sie rund um sich verstreut. An einem kaute es, den Mund bitter verzogen. Adriana kniete auf einem Stuhl am Küchentisch und putzte schon grüne Bohnen für das Mittagessen.
»Du schmeißt viel zu viel weg«, kam pünktlich der Vorwurf.
Sie achtete nicht darauf.
»Wasch dich, dann gehen wir Milch kaufen, ich hab Hunger«, sagte sie zu mir.
Ich war die Letzte im Bad. Die Jungen hatten Wasser auf dem Boden verspritzt und waren hin und her gelaufen, man sah die Abdrücke von Schuhsohlen und nackten Füßen. Bei mir zu Hause hatte ich nie so schmutzige Fliesen gesehen. Ich rutschte aus, ohne mir wehzutun, wie eine Tänzerin. Im Herbst würde ich bestimmt nicht wieder zum Ballettunterricht gehen, und auch nicht zum Schwimmen.
6
Ich erinnere mich an einen Vormittag damals am Anfang, ein fahles Licht kündigte durchs Fenster das Gewitter an, das sich später entladen würde, wie an den anderen Tagen. Rundherum herrschte seltsame Ruhe, Adriana war mit dem Kleinen zu der Witwe im Erdgeschoss hinuntergegangen, und die Jungen waren alle weg. Ich war mit der Mutter allein zu Hause.
»Rupf das Hühnchen«, befahl sie mir und streckte mir das tote Tier hin, das sie an den Krallen hochhielt, mit baumelndem Kopf. Jemand musste es ihr heraufgebracht haben, ich hatte sie auf dem Treppenabsatz reden hören, und zum Schluss hatte sie sich bedankt. »Und dann nimmst du’s aus.«
»Was? Das verstehe ich nicht.«
»Ja, willst du’s etwa so essen? Du musst ihm doch erst die Federn ausrupfen, oder? Danach schneidest du’s auf und holst das Gedärm raus«, erklärte sie mir, wobei sie ihren ausgestreckten Arm leicht schüttelte.
Ich machte einen Schritt rückwärts und wandte die Augen ab.
»Das schaffe ich nicht, da graust mir. Ich kann dafür sauber machen.«
Sie sah mich an und verstummte. Mit einem gedämpften Klatschen knallte sie das tote Tier auf das Ablaufbrett am Spülbecken und fing an, wütend die Federn auszureißen.
»Die kennt Hühnchen einfach nur gebraten«, hörte ich sie zwischen den Zähnen murmeln.
Ich begann eifrig zu putzen, das war nicht schwer. Mit anderen Hausarbeiten kannte ich mich nicht aus, ich war nicht daran gewöhnt. Lange bearbeitete ich den länglichen Kalkfleck am Boden der Wanne mit dem Schwamm, dann drehte ich den Wasserhahn auf, um ein Bad einzulassen. Mit kaltem Wasser, das heiße funktionierte nicht, und ich wollte nicht fragen. Aus der Küche kam ab und zu das Geräusch zerhackter Knochen, während ich weiter über den schmutzigen Sanitäranlagen schwitzte. Zuletzt verschloss ich die Tür von innen mit dem Eisenhaken und stieg in das Wasser. Als ich die Hand nach der Seife auf dem Wannenrand ausstreckte, fühlte ich, dass ich gleich sterben würde. Das Blut wich mir aus dem Kopf, den Armen, der Brust, alles wurde eiskalt. Mir blieben nur noch Augenblicke für ein paar Notwendigkeiten: den Stöpsel ziehen und Hilfe rufen. Ich wusste nicht, wie ich die Aufmerksamkeit der Frau drüben auf mich lenken sollte, es gelang mir nicht, sie Mama zu nennen. Anstelle der Buchstabenfolge aus M und A spuckte ich saure Milchklümpchen in das abfließende Wasser. Ich erinnerte mich nicht einmal mehr an ihren Namen, selbst wenn ich ihn hätte aussprechen wollen. Also schrie ich und fiel dann in Ohnmacht.
Nach ich weiß nicht wie langer Zeit weckte mich der trockene Geruch von Adrianas Pipi. Mit einem Handtuch zugedeckt, lag ich nackt auf dem Bett. Auf dem Boden daneben stand ein leeres Glas, wahrscheinlich war Zuckerwasser drin gewesen, das Heilmittel, das die Mutter bei allen Krankheiten anwendete. Später schaute sie zur Türe herein.
»Kannst du’s nicht gleich sagen, wenn’s dir schlecht wird, statt das Schlimmste abzuwarten?«, fragte sie kauend.
»Entschuldige. Ich dachte, es geht vorbei«, erwiderte ich, ohne sie anzusehen.
Ich habe sie nie gerufen, über Jahre. Seit ich ihr zurückgegeben worden war, steckte mir das Wort Mama im Hals wie eine Kröte, die nicht mehr heraus konnte. Wenn ich dringend mit ihr reden musste, versuchte ich auf verschiedene Weise, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Manchmal, wenn ich das Baby auf dem Arm hatte, kniff ich es in die Beine, damit es weinte. Daraufhin drehte sie sich zu uns herum, und ich konnte mit ihr sprechen.
Lange hatte ich diese kleinen Quälereien vergessen, die ich meinem Bruder angetan hatte, und erst jetzt, da er über zwanzig ist, sind sie mir zufällig wieder eingefallen. Ich saß neben ihm auf einer Bank in dem Ort, wo er nun lebt, und bemerkte einen blauen Fleck auf seiner Haut, der genauso aussah wie die, die ich ihm damals zufügte. Diesmal hatte ihn die Kante eines Möbelstücks erwischt.
Beim Abendessen waren alle ganz aufgeregt wegen der Neuigkeit mit dem Huhn, Adriana fragte sich, ob Weihnachten jetzt im Sommer sei. Ich war hin- und hergerissen zwischen Hunger und Ekel, weil ich das Huhn aufgeschlitzt gesehen hatte, mit den Eingeweiden, die zwischen den schmutzigen Frühstückstassen ins Spülbecken hingen.
»Ein Schenkel für Papa und einen für die da, weil sie heute in Ohnmacht gefallen ist«, entschied die Mutter. Aber die anderen Stücke waren viel kleiner und knochiger, nachdem die Brust für den folgenden Tag aufgehoben worden war. Der, den sie Sergio nannten, protestierte sofort.
»Wenn sie krank ist, soll sie Brühe essen und nicht den Schenkel«, empörte er sich. »Den krieg ich, ich hab heute der von oben beim Umzug geholfen, und dann hast du auch noch das Geld kassiert, das ich verdient hab.«
»Und außerdem hast du wegen der die Badtür kaputt gemacht«, warf ein anderer ein und schüttelte den Zeigefinger in meine Richtung. »Die baut hier nur Mist, könnt ihr sie nicht zurückgeben?«
Mit einem Schlag auf den Kopf brachte der Vater ihn zum Schweigen und drückte ihn mit der flachen Hand wieder auf seinen Platz.
»Ich hab keinen Hunger mehr«, murmelte ich Adriana zu und flüchtete in das Zimmer, wo wir schliefen. Sie kam nach einer Weile nach, mit einer Scheibe Brot mit Öl. Sie hatte sich gewaschen und umgezogen und trug einen zu kleinen Rock.
»Beeil dich, iss das rasch auf und zieh dich an, wir gehen aufs Fest.« Sie hielt mir den Teller unter die Nase.
»Was für ein Fest?«
»Von unserm Heiligen, was sonst? Hast du nicht die Kapelle gehört? Und auf der Piazza fangen sie jetzt grad zu singen an. Aber so weit gehn wir nicht, Vincenzo bringt uns bis zum Karussell«, flüsterte sie.
Keine halbe Stunde später glänzte die Fischgräte an Vincenzos Schläfe im Schein der Lichter auf dem Platz, wo die Zigeuner ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Als einziger von den Jungen hatte er mich beim Streit um den Hühnerschenkel nicht angegriffen, und er hatte seine Brüder auch nicht aufgefordert mitzukommen, nur ich und Adriana durften mit. Er zählte sein wer weiß wie aufgetriebenes Kleingeld und unterhielt sich ein bisschen mit dem Kartenverkäufer; man sah, dass sie sich kannten, vielleicht von den Festen der vergangenen Jahre. Sie rauchten zusammen, wirkten wie Altersgenossen und hatten die gleiche braune Haut. Für die ersten Runden nahm der Zigeuner Geld, danach ließ er uns umsonst fahren.
Ich war noch nie Karussell gefahren, meine Mutter fand, es sei zu gefährlich, der Sohn einer Freundin von ihr hatte sich im Autoscooter den Daumen gequetscht. Adriana, schon Expertin, half mir, auf den Sitz zu klettern, und schloss den Sicherheitsbügel.
»Halt dich an den Ketten fest«, ermahnte sie mich, bevor sie sich vor mich setzte.
Ich flog zwischen ihr und Vincenzo, sie nahmen mich in die Mitte, damit ich keine Angst hatte. Am höchsten Punkt spürte man eine Art Glücksgefühl, was mir in den letzten Tagen passiert war, war am Boden geblieben wie ein schwerer Nebel. Ich schwebte drüber weg und konnte es sogar eine Weile vergessen. Nach ein paar Proberunden kam plötzlich von hinten ein Stoß mit dem Fuß und der Ruf: »Schnapp dir den Schwanz!« – doch der Schwung meines Arms war zu lasch, ich traute mich nicht, die Kette richtig loszulassen.
»Los, streck die Hand aus, Mädchen, nur keine Bange«, spornte er mich an, dann trat er fester zu. Beim dritten Versuch beugte ich mich weit vor ins Leere, fühlte etwas Haariges auf meiner Handfläche und packte es, so fest ich konnte. Ich hatte den Fuchsschwanz errungen, und Vincenzos Begeisterung.
Scheppernd verlangsamte das Karussell die kreisende Fahrt, bis die Sitze schließlich stillstanden. Ich stieg aus, machte zwei unfreiwillige, wackelige Schritte, aus Trägheit. Die Gänsehaut auf meinen Armen kam nicht von Kälte, nach den täglichen Gewittern wurde es immer sofort wieder schwül. Vincenzo trat auf mich zu und sah mir schweigend in die Augen, und seine funkelten. Ich hatte Mut bewiesen. Ich zog das Kleid zurecht, das im Wind durcheinandergeraten war. Er zündete sich eine Zigarette an und blies mir den Rauch des ersten Zugs ins Gesicht.
7
Als wir fast zu Hause angekommen waren, gab uns Vincenzo seinen Schlüssel. Er habe beim Karussell etwas vergessen, wir sollten ihm die Tür angelehnt lassen. Aber er kam und kam nicht, während ich wach lag, noch aufgeregt von dem Höhenflug. Auf der anderen Seite der Wand im Elternschlafzimmer ein rhythmisches Quietschen, dann nichts mehr. Die Stunden vergingen, und meine Beine zuckten unruhig, ich stieß mit dem Fuß gegen Adrianas Gesicht. Später erreichte mich die gewohnte Feuchtigkeit, ich stand auf und legte mich in Vincenzos immer noch leeres Bett. Als ich mich darin bewegte, begegneten mir die Gerüche seiner verschiedenen Körperzonen, Achseln, Mund, Geschlechtsbereich. Ich stellte ihn mir vor, wie er sich vor dem Wohnwagen mit seinem Zigeunerfreund über den Rauch der Zigaretten hinweg unterhielt. So schlief ich schließlich gegen Morgen ein.
Zum Mittagessen tauchte er wieder auf, in Arbeitshosen voller angetrockneter Zementflecken. Niemand schien seine nächtliche Abwesenheit bemerkt zu haben. Als er an den Tisch trat, wechselten die Eltern nur einen Blick.
Eiskalt schlug der Vater zu, ohne ein Wort. Vincenzo verlor das Gleichgewicht, im Fallen landete seine Hand in dem Teller voller Pasta mit Soße aus den Tomaten, die er in den Tagen zuvor bei der Feldarbeit verdient hatte. Auf dem Boden kauerte er sich abwehrend zusammen und wartete mit geschlossenen Augen, dass es vorbei wäre. Als sich die Füße des Vaters entfernten, rollte er ein wenig zur Seite und blieb auf dem Rücken liegen, um sich auf dem kühlen Fußboden zu erholen.
»Los, esst schon, ihr«, befahl die Mutter, das Baby im Arm. Es hatte bei dem Aufruhr nicht geweint, als sei es daran gewöhnt. Die Jungen gehorchten augenblicklich, Adriana etwas lustlos und später, nachdem sie die Tischdecke wieder glatt gezogen hatte. Nur ich war erschrocken, weil ich Gewalt noch nie aus der Nähe gesehen hatte.
Ich ging zu Vincenzo hin. Ein rascher, oberflächlicher Atem hob seine Brust. Aus seinen Nasenlöchern liefen zwei Blutrinnsale in den offenen Mund, und ein Backenknochen war schon leicht geschwollen. An seiner Hand klebte noch Sugo. Ich hielt ihm das Taschentuch hin, das ich einstecken hatte, doch er drehte sich weg, ohne es anzunehmen. Daraufhin setzte ich mich neben ihn auf den Boden, wie ein Punkt neben seinem Schweigen. Er wusste, dass ich da war, und schickte mich nicht weg.
»Das nächste Mal mach ich ihn zu Hackfleisch«, knurrte er zwischen den Zähnen, als er hörte, wie der Vater vom Tisch aufstand. Inzwischen hatten alle fertig gegessen, Adriana fing an abzuräumen, und der Kleine weinte vor Müdigkeit.
»Wenn du nichts essen willst, ist’s deine Sache«, sagte die Mutter im Vorbeigehen zu mir, »aber den Abwasch machst du trotzdem, heute bist du dran.« Sie deutete auf das volle Spülbecken. Sie haben sich nicht einmal angesehen, der Sohn und sie.
Vincenzo stand auf und säuberte im Bad sein Gesicht. Er stopfte sich ein bisschen zusammengerolltes Klopapier in die Nasenlöcher und lief hastig zur Arbeit, die Mittagspause war schon eine Weile zu Ende.
Während sie das Geschirr nachspülte, das ich ihr noch seifig reichte, erzählte Adriana mir von den Fluchten ihres Bruders. Beim ersten Mal, mit vierzehn, war er den Ausstellern nach einem Fest im Nachbardorf gefolgt. Er hatte ihnen geholfen, die Buden abzubauen, und sich, als sie aufbrachen, auf der Ladefläche eines Lastwagens versteckt. Beim nächsten Halt war er herausgekommen, voller Angst, nach Hause zurückgeschickt zu werden. Doch die Zigeuner hatten ihn ein paar Tage behalten, er arbeitete mit ihnen, während sie durch die Provinz tingelten. Als sie ihn dann in einen Bus setzten, der ihn wieder zu seiner Familie bringen sollte, hatten sie ihm zum Andenken ein kostbares Geschenk gemacht.
»Papa hat ihn nach Strich und Faden verprügelt«, sagte Adriana, »aber den Silberring mit den geheimnisvollen Zeichen hat er behalten. Den hat ihm sein Freund geschenkt, den du gestern gesehen hast.«
»Aber Vincenzo trägt doch gar keinen Ring.« »Er hat ihn versteckt. Manchmal streift er ihn über, dann dreht er ihn zwischen den Fingern und versteckt ihn wieder.«
»Wo denn? Weißt du das?«