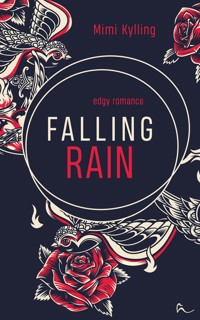4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rinoa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wo Schatten ist, da lauert die Angst. Nash Cohen. Ein umjubelter Rockstar auf dem Gipfel des Erfolgs. Seit frühester Kindheit bestimmen Ängste sein Leben. Ängste, denen er sich stellen muss, denn Nash wird unerwartet Vater. Als die Geburt seiner Tochter in einer Tragödie endet, droht er an dem erneuten Schicksalsschlag endgültig zu zerbrechen. Am Tiefpunkt seines Lebens trifft er auf Hazel. Sie ist die Erste, vor der Nash sich nicht verstecken muss. Die Erste, die all seine Ängste sieht und ihm bedingungslos zur Seite steht. Doch je näher sich Hazel und Nash kommen, desto größer wird die Kluft zwischen ihnen. Zu verschieden scheinen die Welten, in denen sie leben. Denn auch Hazel hat es nicht leicht. Ihr Leben besteht aus unbezahlten Rechnungen, Familienstreitigkeiten und Sorgen um ihren Teeniesohn. Alles spricht gegen sie, doch dieses Mal ist Nash nicht bereit aufzugeben – und trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Inhalt
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Leseprobe
Impressum
© 2023 Rinoa Verlag
c/o Emilia Cole
Pater-Delp-Straße 20, 47608 Geldern
ISBN 978-3-910653-42-9
© Covergestaltung: Coverstube
Korrektur: Lektorat Zeilenschmuck
rinoaverlag.de
mimikylling.de
Alle Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeit zu lebenden Personen ist rein zufällig.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für alle, an die niemand glaubt.
Für alle, deren Kämpfe niemand sieht.
Für alle stillen Held*innen.
Gefunkt! Musiker Nash Cohen und Influencerin Fiona McNeill sind ein Paar
Jetzt ist es raus: Rekordmusiker Nash Cohen und Beauty-Influencerin Fiona McNeill sind ein Paar! Wochenlang waren sie Tuschel-Thema Nummer eins, jetzt zeigen sie allen ihre Liebe auf Instagram. Die Beauty-Queen postete am Samstag ein Foto, das sie händchenhaltend mit Nash Cohen am Strand zeigt. Darunter schrieb McNeill: »Immer nur du. Ich liebe dich zum Mond und zurück.«
Das ist wohl eindeutig. Cohen teilte das Foto auf seinem Account und wurde danach mit Hasskommentaren überschüttet.
Nash Cohen und Fiona McNeill: Liebes-Aus nach nur drei Monaten?
Erst vor Kurzem hatten sich die beiden Stars endlich zu ihrer Liebe bekannt. Jetzt soll schon wieder alles vorbei sein. »Sie sehen sich kaum und streiten viel«, ließ uns ein enger Freund des Paares wissen.
Schock: Influencerin Fiona McNeill (22) ist schwanger.
Alles zu den Babynews und dem Beziehungs-Comeback mit Musiker Nash Cohen hier auf Promiparty.
Endlich!Fiona McNeill gibt Statement zu ihrer Schwangerschaft
»Wir sind überglücklich, verkünden zu können, dass wir eine Tochter bekommen. Wir sind im siebten Himmel.«
Krise im Baby-Heaven? Flirtet Nash Cohen fremd?
Schwerer Schlag für Influencerin und Beauty-Sternchen Fiona McNeill: Noch vor Kurzem gaben sie und ihre On-off-Liebschaft (Rockmusiker Nash Cohen) ihr großes Liebes-Comeback bekannt, jetzt droht der schwangeren Fiona der nächste Schlag ins Gesicht. Cohen wurde am vergangenen Wochenende auf verschiedenen Partys gesichtet – jeweils in fremder Begleitung.
Schwangere Beauty-Influencerin braucht Social-Media-Detox
Influencerin Fiona McNeill braucht eine Pause von den sozialen Netzwerken. Sie wolle mehr für ihre mentale Gesundheit tun und die Beziehung zum Vater ihrer ungeborenen Tochter (Musiker Nash Cohen) retten. Immer wieder sorgt das Paar für Schlagzeilen. Insider fürchten, dass die Beziehung noch vor der Geburt in die Brüche geht.
Tour verschoben – Fans rasten aus
Herber Schlag für alle Fans von Musiker Nash Cohen (24). Wegen der Schwangerschaft seiner Freundin Fiona McNeill (22) verschiebt der Musiker seine US-Tournee. Seine Fans sind enttäuscht und lassen im Netz ihrer Wut freien Lauf. Cohen selbst rief dazu auf, Rücksicht zu nehmen. »Das ist eine besondere Situation für Fiona und mich. Eltern zu werden, ist ein magisches Ereignis. Ich möchte für meine Familie da sein und mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Bitte habt Verständnis.«
Ob seine Anhänger das auch so sehen?
Prolog
Manchmal entgleiten einem die Dinge.
Das, was so gut begonnen hat, driftet ab.
Das, was einem wie der Himmel auf Erden vorgekommen ist, entpuppt sich als Hölle.
Mein Leben begann, als ich zwölf Jahre alt war.
Ich wurde lebendig in dem Moment, in dem meine Finger zum allerersten Mal eine Klaviatur berührten.
Es war ein überwältigendes Gefühl. Als würde jede Farbe um mich herum an Strahlkraft gewinnen, als wäre ich endlich am richtigen Ort angekommen, am Ziel einer langen Reise. Als würde sich eine Tür öffnen, die ich zuvor niemals wahrgenommen hatte.
An diesem Klavier zu sitzen, war pure, reine Lebensenergie.
Und es war verboten.
Im Kinderheim von Reno galten strenge Regeln. Niemand durfte ohne Aufforderung Miss Bloomsburys Musikzimmer betreten.
Trotzdem saß ich da, trotzdem konnte ich nicht aufhören, diese Melodien zu spielen.
Mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde ich mutiger. Ich versuchte die Finger in der Reihenfolge zu bewegen, die ich während Miss Bloomsburys zahlreicher Musikstunden innerlich einstudiert hatte. Immer wieder war ich sie gedanklich durchgegangen. In so vielen Nächten, dass ich sie kaum mehr zählen konnte.
Ich bewegte die Finger anders, schneller und langsamer. Irgendwann schloss ich die Augen, um jede Empfindung ganz tief im Herzen zu fühlen. Es war ein magischer Moment.
Bis eine Tür mit Wucht ins Schloss fiel.
Als ich erschrocken die Augen aufriss, stand unsere Heimleiterin mitten im Raum und starrte mich an, als wäre ich eine himmlische Erscheinung.
Oder der Teufel selbst.
Doch sie schimpfte nicht und sie bestrafte mich auch nicht. Stattdessen gab sie mir von diesem Tag an Klavierunterricht und ließ mich spielen, wann immer ich wollte. Ich verstand damals nicht, wieso sie diese Ausnahme machte und ich fragte auch nicht. Sie sagte immer nur, dass mein Spiel eine Gabe Gottes sei.
Ein paar Wochen später ließ sie mich die Gesangsstunden begleiten und ein halbes Jahr danach den Gottesdienst. Noch ein halbes Jahr danach durfte ich dazu auch singen. Jeden Sonntag zwei Lieder. Irgendwann fragte eine Dame aus unserer Gemeinde, ob ich bei ihrer Hochzeit spielen könnte. Eine andere wollte, dass ich die Beerdigung ihres Vaters begleitete. Ich machte es. Ich machte alles, was mich voranbrachte.
Von da an drehte sich in meinem Leben alles nur noch um die Musik. Jeden Tag sah ich mit meinem Freund Will die Musikvideos an, die sie im Fernsehen zeigten, und träumte vom großen Erfolg. Ich schwor mir, alles dafür zu tun.
Weil ich längst süchtig geworden war nach diesem Gefühl, das ich bekam, wenn die Menschen mich ansahen, während sie im Gottesdienst meine Stimme hörten.
Und dann kam der Tag, der alles veränderte. Der mich vom Ende der Erfolgsleiter direkt in den Himmel katapultierte.
Es war ein regnerischer Montag, als ich außer der Reihe ins Büro von Miss Bloomsbury zitiert wurde.
Da saß ein Mann in einem feinen Anzug und mit teuren Lederschuhen, der mich von Kopf bis Fuß betrachtete, als wäre ich eine seltene Attraktion auf dem Jahrmarkt.
Er sagte Sachen wie »Los Angeles«, »Musikstudio«, »Privatunterricht«. Ich konnte ihm nicht folgen. Miss Bloomsbury auch nicht.
»Aber Mr. Steinfield, wie kommen Sie denn darauf?«, fragte sie.
Mr. Steinfield erwiderte, dass er von einem Kollegen einen Tipp bekommen hätte. Der hätte mich bei einem Empfang gesehen.
»Miss Bloomsbury, ich würde den Jungen gern mal spielen hören. Und singen. Wenn Keeter sagt, dass er eine einmalige Stimme hat, dann ist was dran.« Er wirkte nervös und ich konnte mir keinen Reim darauf machen, also spielte ich einfach. Ein Stück und noch eins. Erst bekannte Popsongs, dann meine eigenen Lieder.
Mr. Steinfield verengte die Augen zu Schlitzen und betrachtete mich lange.
»Und du bist schon vierzehn, ja?«
Ich nickte. Leider sah ich nicht aus wie vierzehn, aber er glaubte mir.
»Hast du das selbst geschrieben?«
»Ja, Sir«, sagte ich. So wie Miss Bloomsbury es uns beigebracht hatte.
»Hast du noch mehr davon?«
Als ich erneut nickte, zeichnete sich auf seinem Gesicht das erste Lächeln ab, das ich jemals von ihm sehen sollte.
Was folgte, war das Paradebeispiel einer Kickstart-Karriere. Mr. Steinfield, Zach, nahm mich als mein Vormund mit nach Los Angeles.
Ich lebte die folgenden Monate mit ihm gemeinsam in einem mikroskopisch kleinen Zimmer in einem riesigen Gebäudekomplex. Er fuhr Tag für Tag mit mir ins Tonstudio. Dort brachte er mich mit anderen Musikern zusammen, nahm Demos auf und ging Klinkenputzen bei jedem Label, das er kannte.
Ein Jahr später erschien mein Debütalbum und die Verkaufszahlen schossen durch die Decke. Mein Leben bestand plötzlich nur noch aus Fernsehinterviews, Radioanfragen, Galas und Konzerten.
Aber so viel Spaß wie es mir machte, so viel Angst hatte ich auch. Es war, als wäre der Nash, der da auf der Bühne stand, ein anderer als der Nash, der nachts im Bett lag und immer noch Albträume hatte, weil er sich verlassen fühlte.
Die ersten Partys folgten. Ein Absturz. Dann noch einer. Die erste Beziehung im Rampenlicht. Die erste Liebe, die nicht still und heimlich zelebriert wurde, sondern vor den Kameras der Paparazzi. Die erste Liebe, die sich als falsche Hoffnung entpuppte.
Das erste Haus und dann das zweite. Das erste war ganz gewöhnlich und lag in einer netten Wohngegend, das zweite in Bel Air mit einem Wachmann am Eingang. Immer, wenn ich in meinem Wohnzimmer saß und auf den hohen Zaun um mein Grundstück sah, fühlte es sich an, als hätte ich mich selbst von der Außenwelt abgeschnitten. War das der Weg, den ich immer vor mir gesehen hatte oder hatte ich die falsche Abzweigung genommen?
Zach produzierte ein Album nach dem anderen. Nie außer Puste geraten. Immer am Ball bleiben. Auf der Erfolgswelle reiten.
Jedes einzelne wurde ein Erfolg. Er trieb mich an und forderte mich. Machte mich groß und berühmt. Aber es fühlte sich kein bisschen so gut an, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich fühlte mich wund und müde, aber die Leute feierten mich, zumindest so lange ich tat, was sie erwarteten. Sie beobachteten jeden Schritt mit Argusaugen. Sie jubelten mir zu und hinter meinem Rücken lästerten sie. Jedes Treffen mit Freunden wurde von der Boulevardpresse kommentiert. Jeder Kuss, jede Party. Ich war ein Teenager, der den Faden verloren hatte, und wurde dafür zerpflückt.
Der nächste Absturz in einer Reihe aus Abstürzen, eine klassische Laufbahn.
Ich bekam Angst, in die Zeitung zu sehen. Oder in die sozialen Netzwerke. Ich bekam Angst vor dem, was sie über mich schrieben und vor dem, was sie nicht schrieben. Dass sie nichts mehr schrieben. Dass es vorbei sein könnte.
Immer am Ball bleiben. Nicht den Anschluss verpassen.
Leichter gesagt als getan.
Kapitel 1
»Hör mir jetzt gut zu, Kid. Ich kann diese Tour um ein paar Monate verschieben, aber ich kann sie nicht komplett absagen. Wie stellst du dir das vor? Wir müssen dieses gottverdammte Album promoten. Und das machen wir mit der Tour. Was glaubst du, was da dranhängt? Ich kann das nicht alles canceln, nur weil du jetzt ein bisschen Daddy spielen willst.« Zachs Stimme bebt. Ich kann es sogar durch die Freisprechanlage des Autos hindurch hören.
»Ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Bieg das irgendwie hin. Ich sage dir das schon seit Monaten. Ich brauche eine Auszeit, Zach. Jetzt tu nicht, als wäre es meine Schuld.«
»Es ist deine Schuld! Ist ja nicht so, dass ich sie gefickt habe und dabei meinen Schwanz nicht unter Kontrolle hatte!«
Ich schnaube und gebe im gleichen Atemzug Gas. Der Sportwagen rast an einem LKW vorbei, dessen Fahrer wütend aufblinkt.
»Kid? Bist du noch dran?«
»Ja. Ich bin gleich beim Krankenhaus«, sage ich und biege von der Hauptstraße auf den Krankenhausparkplatz ein.
»Heilige Scheiße, ich wusste von Anfang an, dass uns diese Beautytante nur Ärger machen wird.«
Uns. Er sagt es, als wären wir eine Person. Manchmal fühlt es sich auch so an. Zach ist wie meine bessere Hälfte. Wie das sortierte und charmante Back-up, wenn ich mal wieder ausfalle. Ohne ihn würde ich heute immer noch in irgendwelchen Altenheimen sitzen und den Leuten dort was vorspielen. Und ich bin ihm ja dankbar dafür, dass er immer für mich da ist, aber manchmal …
»Kid, verfluchte Scheiße!«, brüllt es mir blechern entgegen, während ich vor dem Krankenhaus parke.
»Was denn? Ich muss los. Keine Ahnung, wie lange so eine Geburt dauert. Ich will nicht zu spät sein. Ich … verdammt.«
»Was?«
»Hier … hier ist alles voll mit Presse.«
»Was?«, brüllt Zach wieder und man kann hören, wie Leder knarzt. Ich sehe ihn vor mir, wie er aus seinem Bürostuhl aufsteht, um in dem großen Eckbüro umherzuwandern.
»Woher wissen die das, Zach?«, krächze ich und merke richtig, wie mir die Stimme wegbricht. Es fühlt sich grauenvoll an. Unkontrolliert und panisch.
Weil er die Antwort ebenfalls nicht kennen dürfte, übergeht Zach meine Frage. Wer weiß schon, wo all die Paparazzi ihre Infos herbekommen.
»Ist Rob da?«, fragt er stattdessen nach einer halben Ewigkeit. Ich schüttle den Kopf, aber das kann er nicht sehen. Braucht er vermutlich auch gar nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn er meine Reaktionen an meiner Atemfrequenz erkennen kann. Er kennt mich viel zu gut. Er kann jedes Zucken meines Augenlids und jede meiner Gesten besser deuten als irgendwer sonst. Es ist beängstigend und gut gleichermaßen.
Ich schließe die Augen und versuche, ein paar Sekunden lang ruhig zu atmen, aber es gelingt nicht. Mit Blick in den Rückspiegel warte ich auf den schwarzen Jeep, in dem Rob hinter mir hergefahren ist.
Warum kommt er nicht?
Mein Herzschlag beschleunigt sich weiter, erreicht ein ungesundes Maß und rast in meiner Brust, als wäre die letzte Stunde meines Lebens angebrochen. Ich klammere mich mit schwitzigen Händen immer fester um das Leder des Lenkrads. Im Hintergrund höre ich Zachs Stimme, aber kann seinen Worten nicht mehr folgen. Jeder Gedanke konzentriert sich nur noch auf die Masse an Fotografen und Kameras, die sich vor der Kliniktür das Los Angeles Private Health Center postiert haben.
Vor meinem inneren Auge sehe ich schon die Schlagzeilen, die morgen das Internet fluten werden. Die eine Hälfte davon wird die Wahrheit verdrehen und die andere Hälfte wird gelogen sein.
Als endlich Robs SUV auf den Parkplatz gefahren kommt, drücke ich das Gespräch mit Zach kommentarlos weg. Sein Redeschwall bricht ab, aber die Ruhe verschafft mir heute keine Erleichterung.
Je stiller es ist, desto lauter sind die Gedanken.
Rob steigt aus, ohne eine Miene zu verziehen. Das tut er nie, wenn er im Dienst ist. Nach Feierabend ist Robyn Ashwell ein angenehmer Typ. Wir haben schon den ein oder anderen Abend zusammen verbracht. Er hat eine nette Frau und vier Söhne.
Was auch völlig egal ist, weil es hier und jetzt absolut nichts zur Sache tut. Ich wünschte, ich könnte meine Gedanken mehr auf das fokussieren, was wichtig ist. Im Hier und Jetzt bleiben. Ich schaffe es auch heute nicht. Egal, was ich tue, irgendwann kommt immer der Moment, in dem ich abdrifte. Dann tauche ich in Sphären meines Innenlebens ab, in denen ich Ewigkeiten festhänge. Keine Ahnung, ob das gesund ist.
Als es laut an die Fahrerscheibe klopft, werde ich mit einem Ruck in die Gegenwart zurückkatapultiert.
Rob hat sich vor der Tür des Wagens aufgebaut und steht in bester Bodyguard-Manier da. Er nickt mir knapp zu, als Zeichen, dass ich aussteigen kann.
Ich atme ein letztes Mal durch und öffne die Tür.
»Morgen, Boss«, sagt er. Sein Gesichtsausdruck verändert sich kein bisschen. Der akkurate Bürstenhaarschnitt unterstreicht diesen unbarmherzig harten Ausdruck und der feste Zug um seinen Mund tut sein Übriges.
»Hey, Rob.« Ich deute auf den Pulk an Presseleuten. »Müssen wir da durch?«
Er nickt. »Ja, gibt keinen anderen Eingang, der jetzt spontan besetzt wäre. Und wenn ich da hineinmarschiere, um nach einer Alternativmöglichkeit zu fragen, werden sie auf dem Parkplatz nach dir suchen, sobald sie mich erkennen. Auch nicht besser, was?«
Wir schauen uns einen Moment an, dann ziehe ich meine Sonnenbrille aus dem Ausschnitt. Mein Seufzen klingt erschöpft, aber es ist bei Rob egal. Der hat über die Jahre schon Schlimmeres erlebt als so einen lapidaren Moment der Resignation. Damals, nachdem Zach meinte, dass ich einen Personenschützer brauche, weil die Fans und die Presse zu aufdringlich wurden, sind Rob und ich gar nicht miteinander klargekommen. Es hat mich eingeschüchtert, dass er ständig um mich herum war und mich immerzu so eindringlich angesehen hat. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt.
Als mir bewusst wird, dass ich immer noch mitten auf diesem Krankenhausparkplatz stehe, setzt die Geräuschkulisse wie mit einem gewaltigen Hammerschlag wieder ein.
Motorengeräusche, Stimmen, Kameras, Lachen.
Ich kann es kaum ertragen.
Rob geht vor mir her auf die Glasfront des Krankenhauses zu. Mit jedem weiteren Schritt in Richtung der Paparazzi werden die Geräusche lauter. Sie bauen sich wie eine undurchdringliche Wand vor mir auf.
»Mr. Cohen! Stimmt es? Sind Sie getrennt?«
»Hey, Nash Cohen! Geht es schon los? Kommt das Baby?«
Ich senke den Blick auf den Boden und lasse jede Frage an mir abprallen. Rob schiebt sich durch die Menge und schirmt mich mit seinem massiven Körper ab.
»Hey, Nash! Wie werden Sie Ihr Kind nennen? Sind Sie beide wieder-«
»Wir geben kein Pressestatement. Wenden Sie sich an das Management«, sagt Rob. Ich bin mir sicher, dass die Frage gewesen wäre, ob Fiona und ich glücklich sind.
Ich weiß es nicht. Ich könnte die Frage nicht einmal beantworten, wenn ich wollte.
Dabei ist Fiona alles, was mich noch zusammenhält. Sie ist die mit den guten Ideen und den aufmunternden Sprüchen. Sie treibt mich an und sorgt dafür, dass ich mich nicht hängenlasse. Sie passt auf mich auf, wenn ich keine Kraft mehr dafür habe.
Rob bleibt stehen und schiebt mich mit dem Arm an seinem Körper vorbei. Ich bin so in Gedanken versunken gewesen, dass ich von der Wucht fast zu Boden gehe. Ich stolpere über meine eigenen Füße und werde von Robs kräftigen Händen abgefangen.
»Mr. Cohen? Ein Wort nur …«, höre ich noch und dann aufgeregtes Durcheinanderrufen, weil wir im Gebäude verschwinden. Der Nachhall des Blitzlichtgewitters klingt in meinen Ohren bedrohlich und verstummt abrupt, nachdem die Glasschiebetüren zufahren.
Eine Frau vom Krankenhauspersonal kommt herbeigeeilt. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragt sie charmant und lächelt mich an. Diese Reaktion ist die übliche, egal, wo ich auftauche. Ich glaube, dass es nicht an mir selbst liegt. Es ist das Gesamtpaket, die Fantasie, die ich ebenfalls hatte - bis sie wahr wurde. Glamour und Jetset. Geld und Einfluss. Jetzt finde ich lächerlich, dass ich jemals so naiv sein konnte. Als hätte alles nur eine vergoldete Sonnenseite.
»Wo geht es zum Kreißsaal?«, fragt Rob leise und lässt sich von ihr den Weg beschreiben. In den zweiten Stock, dann den Flur entlang nach links. Wir nehmen die Treppe. Mit jeder Stufe werden meine Schritte schwerer. Auf den Fluren ist es gespenstisch still. Nur vereinzelte Pflegekräfte laufen zwischen den Räumen hin und her.
»Da ist es.« Rob deutet auf ein Schild, das von der Decke baumelt.
Kreißsaal steht darauf. Daneben ist eine stilisierte Frau abgebildet, die ein Baby stillt. In meiner Brust zieht sich alles zusammen und das Gefühl, hier ganz schnell flüchten zu müssen, stellt sich ein. Meine Hände sind genauso schweißnass wie mein Shirt, weil ich sie ständig daran abwische.
Was mache ich hier? Das ist doch der falsche Film.
Nein, ist es nicht. Das hier ist mein Leben.
Ich atme durch und spüre eine schwere Hand auf meiner Schulter. »Du machst das, Nash. Alles wird gut. Nachher freut ihr euch. Ganz sicher.«
Ich schließe die Augen für einen Moment und die Hand verschwindet.
»Ich warte dann hier, ja?«, fragt Rob mehr, als dass er es feststellt.
»Ja, danke. Ich … ich geh jetzt rein.«
»Du gehst jetzt rein.«
Nicken.
Während ich den Finger auf den Klingelknopf drücke, habe ich das Gefühl, dass ich gleich umkippe. Mein ganzer Körper wird taub. Das Schrillen hinter der Tür klingt seltsam fern, kurz darauf knackt es in der Gegensprechanlage.
»Bitte?«, bellt eine unfreundliche Stimme mir entgegen.
»Ähm … Cohen. Ich möchte zu Miss McNeill.«
»Sind Sie der Vater?«
»Von dem Baby? Ja … ja, bin ich.«
Als der Summer geht, schaue ich ein letztes Mal über meine Schulter zu Rob, der mir jetzt aufmunternd zulächelt. Keine Ahnung, woher er seine plötzliche Zuversicht hat.
Im Gang bei den Kreißsälen ist es, als ob man in eine andere Welt eintaucht. Das Licht ist gedimmt und an den Wänden hängen Bilder von glücklichen Babys.
Am Ende des Flures wartet eine Hebamme in einem lindgrünen Kasack. Sie winkt mich zu sich. »Mr. Cohen?«
Ich bekomme keinen Ton heraus.
»Kommen Sie. Es ist alles in vollem Gange. Fünf Zentimeter. Gut, dass Sie so schnell hier sein konnten. Das Neo-Team hat sich schon bereit gemacht.«
Ich habe absolut keine Ahnung, was das bedeuten soll.
»Ist sonst alles gut?«, frage ich und ernte einen Blick, als wäre ich der letzte Mensch auf Erden.
»Na ja, ein paar Wochen mehr wären optimal gewesen. Aber länger konnten wir nicht warten.«
Heute Morgen ist bei Fiona die Geburt eingeleitet worden, weil sie seit Wochen Anzeichen einer Schwangerschaftsvergiftung gezeigt hat. Ihr Blutdruck ist völlig außer Kontrolle geraten und als sie dann noch Migränekopfschmerzen entwickelt hat, wurde die Entscheidung schnellstmöglich getroffen. Zum Glück hatte Zach meine Konzerte schon im Vorfeld verschoben. Eigentlich hätte es mit dem errechneten Geburtstermin haarscharf gepasst, aber mir war das zu heikel. Als ich das entschieden habe, dachte ich wirklich, dass Zach mich kaltmacht. Ich habe ihn selten so wütend erlebt. Er hat einen Aktenordner nach mir geschmissen. Dabei wollte ich doch nur, dass Fiona nicht allein sein muss, wenn das Baby kommt.
»Mr. Cohen? Alles gut bei Ihnen?«
Ich schaue auf und merke, dass die Hebamme schon ein paar Meter weitergegangen ist und vor einer Schiebetür steht.
Ich schließe zu ihr auf und sehe sie das erste Mal lächeln. Für einen winzigen Moment, ehe sie die Tür aufschiebt und ein unmenschliches Stöhnen zu uns durchdringt. Mein Herz pumpt wie kurz vor dem Infarkt.
»Fiona«, keuche ich. Schlagartig überzieht eine schmerzhafte Gänsehaut meinen ganzen Körper, während ich versuche zu erfassen, was hier gerade passiert.
Wie sie da liegt. Ihre Hände so stramm um die Griffe des Bettes gewunden, dass ihre zarten Knöchel weiß hervortreten. Ihr schweißüberströmtes und schmerzverzerrtes Gesicht. Ihre zitternden, nackten Beine.
Ihr Blick findet meinen … und erstarrt.
»Was willst du hier?«, presst sie hervor, bevor ihr Körper von einer übermächtigen Kraft geschüttelt wird. Sie kneift die Augen zusammen und schreit, als würde sie dem Teufel gegenüberstehen.
Ein Schauer geht meinen Rücken hinab. Ohne nachzudenken stürze ich auf sie zu, will ihre Hand nehmen. Sie halten, irgendetwas tun, das ihr hilft.
»Ist das normal?«, hauche ich kaum hörbar, doch die anwesende Hebamme wirft mir lediglich einen nachsichtigen Seitenblick zu.
»Ja, Mr. Cohen. Alles in bester Ordnung. Das liegt am Wehentropf. Die Periduralanästhesie wirkt bald.«
Keine Ahnung, was sie meint. Niemand außer mir sieht ernsthaft besorgt aus. Ich streichle abwesend über Fionas verschwitzte Stirn, doch sie schlägt meine Hand weg.
»Lass das, das ist eklig«, murmelt sie, während sich ihr Körper endlich wieder entspannt.
»Bitte, Baby, ich will dir nur helfen.«
»Und ich habe dir gesagt, dass ich dich anrufe, wenn sie da ist. Das heute Morgen war keine Aufforderung herzukommen.«
»Was? Aber ich … ich kann dich doch nicht allein lassen.«
»Ich will das nicht, Nash. Wenn du mir auch nur ein Mal zugehört hättest … ich will nicht, dass du …« Wieder verzieht sich ihr Gesicht zu einem lautlosen Brüllen. Der Ton folgt ein paar Herzschläge versetzt. Mein Herz. Ich glaube, ich sterbe. Es tut mir so unendlich weh, dass sie meinetwegen leiden muss. Ich wünschte, ich könnte es ihr abnehmen. An ihre Stelle treten.
»Baby, bitte, lass mich dir doch helfen. Wir schaffen das«, flüstere ich, während sie kraftlos ins Kissen sinkt.
»Nein. Nein, ich will das nicht. Ich will nicht, dass du mich so siehst.«
»Aber …«
»Verschwinde, Nash. Ich bekomme jetzt dieses Kind. Ich. Allein. Und dann …« Wieder bricht sie ab. Begleitet von einem Laut des Entsetzens und einem Platschen ergießen sich gefühlte hundert Liter Wasser auf diese Matratze, auf den Boden, überall hin. Es spritzt bis auf meine Jeans.
»Verdammt, geh schon …«, keucht sie. Ich versuche ihren Blick zu finden, aber sie schaut demonstrativ weg. Das kann nicht ihr Ernst sein.
»Sie sollten gehen, Mr. Cohen. Es ist die Sache Ihrer Frau, wenn ich mich einmischen darf. Gehen Sie gemütlich einen Kaffee trinken, bis Ihre Tochter da ist.«
Ich starre die Hebamme an, die mir mütterlich zulächelt und mit den Augen auf die Tür deutet.
Aber … was …
»Verschwinde endlich.« Fionas Stimme ist so verzerrt vor Schmerz, dass ich es kaum aushalten kann.
Warum will sie mich nicht hier haben?
Warum lässt sie nicht zu, dass ich ihre Stütze bin, wo sie doch immer meine ist?
Warum will sie nicht, dass ich sie so sehe?
Warum schließt sie mich aus?
»Mr. Cohen?«
Ich kann sie doch nicht zurücklassen?
Ich kann nicht in einer Cafeteria sitzen und einfach abwarten, obwohl sie leidet?
Während ich noch mitten im Raum stehe, trifft mich ein weiterer zorniger Blick. Gleich darauf fasst die Hebamme meinen Arm und schiebt mich auf die Tür zu.
»Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Cohen. Alles wird gut«, sagt sie eindringlich.
Ich bete dafür, dass sie recht behält.
Kapitel 2
Während die Kaffeemaschine vor sich hin blubbert, nehme ich schon zum dritten Mal an diesem Morgen den feuchten Lappen aus der Spüle, um den Esstisch abzuwischen.
»Moe, kannst du bitte mit dem Müsli aufpassen?«, frage ich meinen völlig verschlafenen Sohn, der halb mit dem Kopf in seinen Frühstücksflocken hängt. »Du weißt, dass Granny damit empfindlich ist.«
Er reagiert nicht. Seine blonden Locken fallen ihm in die Stirn und verdecken jegliche Sicht auf seinen Gesichtsausdruck. Ich trete neben ihn und fahre mit einer fließenden Bewegung hindurch. Er kann das nicht leiden, weil er sich dann total uncool fühlt. Aber manchmal kann ich nicht anders. Manchmal ist er für mich kein vierzehnjähriger Teenager, sondern immer noch mein kleiner Junge. Wenn er Pech hat, wird das für immer so bleiben. Das ist wohl das Vorrecht der Mütter.
»Mom«, grummelt er und hebt nun doch den Blick. Er versucht finster zu schauen, kann sich das Lächeln aber nicht verkneifen.
»Entschuldige, mein Schatz. Ich bin ja schon weg.«
Ich wende mich erneut der Spüle zu und nehme im nächsten Schritt weiteres Geschirr aus dem Schrank, um den Tisch für meine Eltern und meinen Bruder aufzudecken. Seit es Mom gesundheitlich wieder schlechter geht, bleibt sie morgens länger liegen. Ich bin ohnehin auf, weil ich Moe jeden Tag zur Schule fahre und dann zusehen muss, dass ich pünktlich zur Arbeit komme.
Also toaste ich Toast, schneide ein paar schrumpelige Äpfel auf und stelle Marmelade und Butter dazu.
Moe hat unterdessen sein Frühstück beendet und verschwindet wortlos wie ein kleiner Schatten in den Flur.
»Denkst du dran, deine Tasche zu packen? Du hast heute Sport«, rufe ich ihm hinterher und sehe sein kurzes Zögern an dem Zucken seiner schmächtigen Schultern.
Nein, Schatz, ich kann dich nicht schon wieder entschuldigen. Es tut mir so leid.
Er geht weiter, als wäre nichts gewesen, und trifft im Flur auf meinen Dad. Ich kann seine Stimme hören, als er sich mit Moe unterhält und der ihm brav antwortet. Abwesend lausche ich und greife nebenbei nach der zurückgelassenen Frühstücksschüssel, in der noch die Hälfte der Cornflakes schwimmt. Na dann, guten Appetit, Hazel.
Man kann das ekelhaft finden, aber ich bin zu geizig, um jedes Mal so viel vom Essen wegzuschmeißen, nur weil jemand seinen Hunger nicht einschätzen konnte. Leisten könnten wir uns das ohnehin nicht. Mit jedem Jahr weniger. Am Dach müsste mal wieder was gemacht werden und auch mein Auto wird nicht mehr ewig mitmachen. Es ist so alt, dass ich jeden Morgen darauf hoffe, dass es überhaupt anspringt.
Aber seit Dad vor acht Jahren seinen Job verloren hat, leben wir alle nur noch von meinem Gehalt. Mein Bruder hatte noch nie in seinem Leben eine Arbeit, meine Mom ist zu krank und mein Dad hat aufgegeben. Und so leben wir alle zusammen in diesem winzigen Haus im ungemütlichen Inglewood und hoffen auf bessere Zeiten. Ich bete so sehr dafür, dass sie irgendwann kommen werden.
Aber bis dahin müssen wir leider alle den Gürtel etwas enger schnallen.
Noch enger und du erstickst dran.
Ändern könnte ich selbst das nicht.
Ich habe leider keine große Auswahl, was potenzielle Jobs angeht. Ursprünglich wollte ich nach Moes Geburt den Highschool-Abschluss nachholen und eine Ausbildung machen. Geschafft habe ich es nie. Es kam immer etwas dazwischen. Erst die Tatsache, dass ich lange keinen Betreuungsplatz für Moe bekommen habe, Moms Krankheit, dann Dads Entlassung in der Firma, Tylers Inhaftierung und jetzt … jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Ich bin dreißig Jahre alt. Wie lächerlich will ich mich denn machen?
Also tue ich, was ich am besten kann. Weitermachen und nach vorn schauen.
»Was ist das denn?« Die plötzliche Ansprache meines Dads lässt mich zusammenfahren. Er steht in seinem speckigen T-Shirt vor mir und deutet auf die Äpfel.
»Das ist Obst, Dad. Der Arzt hat gesagt, dass du mehr Vitamine zu dir nehmen sollst. Das ist gut für deine Blutwerte.«
Dad schnaubt und schenkt sich kleckernd einen Kaffee ein. Die Flecken versickern auf dem Holz des Esstischs. Ich starre auf ihre Form und versuche, ruhig zu atmen.
»Ja, der Quacksalber meinte aber diese kleinen Pillen aus der Apotheke. Das sind echte Vitamine«, gibt Dad zurück und hat dabei diesen Tonfall drauf, als wäre ich ein bisschen langsam im Kopf.
»Die Vitamine in dem Apfel sind aber kostenlos. Mr. Miller hat gestern einen Eimer gebracht. Sie sind aus dem Garten seines Sohnes.«
»Nehmen wir jetzt Spenden an, ja? Und dann noch von diesem Schmierlappen Miller. Das Bullenschwein braucht sich gar nicht bei uns einschleimen. Oder hast du wieder was mit seinem Sohn am Laufen, hm? Den konnte ich nie leiden. Kannst ja zu denen ziehen, wenn’s dir hier nicht mehr passt«, lästert mein Vater weiter und lässt sich mit einem lauten Rumpeln auf den ausgesessenen Küchenstuhl fallen. Schnaufend zieht er seine Kaffeetasse zu sich. Die Äpfel schiebt er beleidigt fort.
Ich spare mir jeden weiteren Kommentar dazu. Es ist sinnlos, wenn er so drauf ist. Er ist ein Dickkopf. Ich weiß gar nicht, wer von beiden schlimmer ist. Mein Dad oder mein Bruder. Und als könnte der Gedanken lesen, taucht er genau in dem Moment auf, in dem ich mich zur Spüle umdrehe.
»Sag deinem kleinen Scheißer, dass er im Bad schneller machen soll. Ich muss da mal rein«, schnauzt er mich an, noch ehe er durch die Tür ist. Seine Haare stehen zu allen Seiten des Kopfes ab und das sieht bei ihm nicht verrucht und sexy, sondern nur ungeduscht und eklig aus.
»Dir auch einen schönen guten Morgen, Ty.«
»Schieb dir das sonst wohin. Ich hab Kopfschmerzen.«
Dad lacht. Ein ganz anderes Lachen als das, was er immer für mich übrighat. Er klopft meinem Bruder auf die Schulter, während der sich an den Tisch setzt, als wäre das die schwerste Sache der Welt.
»Warst du mit den Jungs unterwegs?«, fragt Dad grinsend und Ty reibt sich die Stirn.
»O Mann, ja. Casey hat ’ne Sonderzahlung in der Fabrik bekommen. Hat einen ausgegeben.«
Wohl nicht nur einen.
Aber auch diesen Spruch verkneife ich mir und spüle stattdessen die mittlerweile leergegessene Müslischüssel von Moe ab. Im Hintergrund raunen sich die beiden Männer weiterhin irgendwelche anzüglichen Bargeschichten zu, die an einem Frühstückstisch rein gar nichts verloren haben. Das Rauschen des Wassers aus dem Wasserhahn dämpft ihre Stimmen und ich bin froh darum. Denn das sind Dinge, die ich nicht hören will. Nicht zum Frühstück und nicht sonst wann.
Während ich mit dem Spülschwamm über die verblichene Bemalung des Porzellans scheuere, driften meine Gedanken ab. Sie schwirren durchs geöffnete Fenster und schweben mit dem Wind davon. Aus diesem schäbigen Haus hinaus, in dem nicht einmal genug Platz ist, dass Moe und ich jeder unser eigenes Zimmer haben können. Das so klein ist, dass man jedes Gespräch und jedes Geräusch der anderen mithören muss. Ohne eine Chance auf Besserung. Ohne einen Ausweg. Immer nur weitermachen. Jeden Tag hoffen, dass irgendwann ein Wunder geschieht. Aber warum sollte eins kommen? Als wäre das hier ein verdammtes Märchen. So ein Schwachsinn.
Es ist manchmal unendlich schwer, wenn die Verantwortung für das Überleben der ganzen Familie allein auf den eigenen Schultern lastet. Wenn alles davon abhängt, dass man selbst immer pünktlich ist, sich nicht gehen lässt, keinen Tag ausfällt.
Es ist eine Abwärtsspirale, die von Tag zu Tag mehr Fahrt aufnimmt.
»Wird das heute noch was oder willst du da ewig mit der Schüssel stehen?«, witzelt mein Bruder. Sein hämisches Lachen holt mich in die Gegenwart zurück. Ich stelle den Wasserhahn ab und die Schale auf das Abtropfgitter, bevor ich mich zu den Männern umdrehe.
»Wie siehts denn bei dir sonst aus, Ty? Haben sich die von der Sicherheitsfirma noch mal bei dir gemeldet?« Es nervt mich, dass immer alle auf mir herumhacken, obwohl ich die Einzige bin, die etwas zum Gemeinwohl beiträgt.
»Ach, die …«, sagt er so dahin und sein Mund bekommt diesen harten Zug, den er immer hat, wenn ihm etwas missfällt. »Die können mich mal, Schwester. Wer nicht will, der hat schon.«
»Hast du überhaupt nachgefragt? Vielleicht ist da etwas schiefgelaufen. Buddy meinte doch, dass du den Job so gut wie sicher hast?«
Er winkt ab. »Der labert viel, wenn der Tag lang ist. Außerdem seh ich’s nicht ein, da immer hinterherzulaufen. Wenn sie mich nicht wollen, werden sie schon merken, was sie davon haben.«
Ich starre ihn für einen Moment kopfschüttelnd an und als er sich wieder seinem Flüstergespräch mit Dad zuwendet, verlasse ich den Raum.
»Mom, du musst mich ehrlich nicht bis vors Tor bringen. Ich kann hier schon aussteigen.« Moe rutscht im Autositz umher und schaut immer wieder unter seinen Locken hervor in meine Richtung. Er knetet seine Hände im Schoß und wirkt dabei unendlich nervös.
»Schatz, ist alles okay?«
Er nickt. »Ja klar, Mom. Kannst du jetzt bitte einfach anhalten?«
»Warum? Ich habe dich doch immer ans Tor gebracht?«
»Bitte, Mom.« Sein Blick bekommt etwas so Flehendes, dass mein Herz sticht.
»Okay, du kannst allein ans Tor gehen. Aber ich warte, bis du drinnen bist.«
Er deutet ein Nicken an und steigt aus dem Auto. Ohne einen letzten Blick, ohne wirklichen Abschied.
Ich sehe ihm nach, wie er sich mit hängenden Schultern in die Massen an Schülern einreiht. Wie der erste ihn schubst und dann der zweite. Wie er immer kleiner wird und den Rücken krumm macht. Am liebsten würde ich aussteigen und seine Mitschüler allesamt am Hemdkragen packen. Ich würde sie anschreien und schütteln. Sie fragen, was mit ihnen falsch ist und warum sie sich nicht um ihre eigenen Probleme kümmern können.
Es würde alles nur schlimmer machen.
Ich wünschte, die Welt wäre anders. Dummerweise stehen Menschen wie mir oder Moe solche Wünsche nicht zu.
Als Moe im Gebäude verschwindet, starte ich den Motor. Während der halbstündigen Fahrt zur Arbeit vermischen sich die Bilder vom heutigen Morgen mit sämtlichen anderen aus den letzten vierzehn Jahren. Ich sehe mich in Gedanken, wie ich mit fünfzehn weinend in meinem Zimmer liege und die Decke anstarre. Wie Mom und Dad sich gegenseitig anschreien. Wie Mom in mein Zimmer kommt, um mir zu versichern, dass alles wieder gut wird und mich im Anschluss zu Ashton Coopers Haus schleppt. Wie sie dessen Mom ins Gewissen redet. Wie Ashton und ich uns gegenüberstehen und beide nicht wissen, wie das passieren konnte.
So sehr ich Moe auch liebe, man muss es leider sagen, wie es ist: Seine Zeugung war ein dummer Unfall, der im jugendlichen Leichtsinn passiert ist. Ein Klassiker. Ashton Cooper glaubte mit sechzehn scheinbar, sich so sehr unter Kontrolle zu haben, dass er der erste Mann auf dieser Erde ist, der keine Kondome benutzen muss. Ich habe gar nichts gedacht. Ich wollte bloß von ihm gemocht werden.
Ein paar Wochen später mochte er mich kein bisschen mehr. Ich habe ihm in der Schule diesen Test gezeigt. Er hat mich nur angestarrt und dann gemeint, dass das ja gar nicht sein könnte und ich bloß eine Schlampe wäre, die es ohnehin mit jedem treibt. So ein Blödsinn. Alles, was ich damals wollte, war er. Ich war furchtbar verliebt in ihn, aber er meinte nur, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will.
Als ich meiner Mutter unter Tränen von der Schwangerschaft erzählt habe, hat sie mich zu einem Arzt gebracht, unter dessen Blicken ich mich geschämt habe wie nie zuvor in meinem Leben. Sie wollte einen Ultraschall, er sprach bloß davon, dass es Möglichkeiten gäbe. Auch unter der Hand, weil ich ja schon so weit wäre. Dann schob er verstohlen einen Zettel mit einer Adresse über den Tisch.
Und auch wenn man es heute kaum glauben würde, aber damals war meine Mutter eine willensstarke Frau.
»Was erlauben Sie sich, meiner Tochter so einen Eingriff zu empfehlen?«, hat sie gefragt, mich geschnappt und auf direktem Wege diese Praxis verlassen. Den Zettel hat sie nicht angerührt.
Ein paar Monate später kam Moe auf die Welt.
Ashton Cooper habe ich niemals in meinem Leben wiedergesehen.
Als ich am Ende meiner Fahrt auf den Parkplatz unserer Firmenzentrale einbiege, sehe ich schon Debbies Auto, das im Schatten der Bäume parkt, die den kleinen Fußweg zum Haupteingang säumen. Sie steht daneben und raucht eine Zigarette.
»Morgen, Süße!« Ihre Worte gehen in ein bedenkliches Husten über. Immer wenn ich Debbie sehe, denke ich darüber nach, dass sie eigentlich ihre Berufung verfehlt hat. Sie sieht in ihrer Motorradweste und den derben Stiefeln aus wie eine Truckerin oder die gealterte Braut von einem Bikerclub-Boss.
»Na, was macht die Brut?«, fragt sie weiter. Und der Unterschied zwischen ihr und allen anderen Menschen in meinem Umfeld ist, dass sie sich für meine Antwort auf diese Frage wirklich interessiert.
Aber ich habe heute keine Kraft, mich über Moes Schulsituation oder die Befindlichkeiten meiner Familie auszulassen. Also winke ich nur ab und zucke mit den Schultern. Debbie brummt eine wortlose Zustimmung und hakt sich dann bei mir unter, während wir auf den Gebäudeeingang der Reinigungsfirma zuhalten.
»Aber eine Sache musst du mir trotzdem verraten, Hazel. Was machst du überhaupt hier? Denke, du bist bei Mister Sexy und Miss Nervig?«
»Keine Ahnung, warum ich herkommen sollte. Heute Morgen hat mich Mr. Brown mit einem Anruf aus dem Bett geklingelt und gemeint, dass es etwas Wichtiges zu bereden gibt. Vielleicht hat mich Miss McNeill jetzt ein für alle Mal feuern lassen.«
Debbie lacht. »Ach, die hat gerade ganz andere Sorgen. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen, dass sie gestern die Geburt eingeleitet haben … Wenn das Baby erst mal da ist, wird die bestimmt zur Schmusekatze. Ich weiß noch, wie ich Peter immer rumkommandiert hab, als ich schwanger war. Ich war richtig eklig.«
Ich nicht. Weil ich niemanden hatte, den ich kommandieren konnte.
»Stell dir Mister Sexy mal als Daddy vor«, sinniert sie weiter und ist damit wieder einmal bei ihrem Lieblingsthema angekommen. Als ich für den Haushalt von Mr. Cohen eingeteilt wurde, ist Debbie fast durchgedreht. Ich dachte für einen kurzen Moment, dass sie mich um die Ecke bringen wird, damit sie meine Stelle einnehmen kann. Wenn es den Ausdruck gibt, dann ist sie so etwas wie ein Super-Fan. Sie besitzt jedes seiner zahlreichen Alben und kennt stets den neusten Klatsch und Tratsch. Ich glaube, wenn Nash Cohen bei ihr klingeln und sie entführen würde, würde sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ihren Mann und ihre Familie zurücklassen.
Dabei ist Mr. Cohen das genaue Gegenteil von Peter. Der ist ein Bär von Mann, mit langem Rauschebart und Tattoos auf jeder erdenklichen Körperstelle. Mr. Cohen hingegen ist von Bikercharme weit entfernt. Keine Ahnung, warum alle Welt ihn für ein Sexsymbol hält. Für mich wirkt er mit diesen filigranen Gesichtszügen und dem melancholischen Blick eher wie ein verlorener Junge. Aber ich werde mich hüten, das laut auszusprechen. Nicht, dass Debbie den Rest des Weges für einen weiteren Monolog über Mr. Cohens neueste Skandale nutzt. Als die Schwangerschaft von Miss McNeill bekannt wurde, hat sie das wochenlang beschäftigt. Es war eine harte Zeit.
Vor der Tür von unserem Chef verabschieden wir uns schließlich und Debbie geht weiter, um im Aufenthaltsraum bei den anderen Kolleginnen zu warten, die als Springerinnen eingesetzt werden.
Ich schaue ihr noch einen Moment hinterher und klopfe dann an Mr. Browns Büro. Als ich seine Stimme höre, drücke ich die Klinke herunter. Er lächelt mir entgegen, aber wirklich zufrieden wirkt er heute nicht.
»Ah, Miss Lewis. Gut, dass Sie schon da sind. Pünktlich wie immer. Kommen Sie herein.«
»Morgen, Mr. Brown. Was gibts denn?«
Bitte, mach, dass ich nicht gefeuert werde. Bitte.
Er seufzt. »Tja nun, einem unserer Klienten ist bedauerlicherweise etwas … zugestoßen, das unserer strengsten Geheimhaltung bedarf. Setzen Sie sich doch bitte.«
Tragödie im Kreißsaal – Celebritysternchen Fiona McNeill verstirbt bei der Geburt ihrer Tochter.
Die Geburt ihrer Tochter sollte der schönste Tag im Leben von Fiona McNeill werden, doch er wurde ihr letzter. Alle Hintergründe zur dramatischen Geburt und wie Musiker Nash Cohen auf die Todesnachricht reagierte.
Kapitel 3
Manchmal reichen Worte nicht aus, um den Schrecken zu beschreiben, den man in sich spürt. Es ist, als würde das eigene Herz für einen unendlichen Moment lang stehenbleiben. Und wenn es dann mit Wucht weiterschlägt, glaubt man, den Schmerz nicht auszuhalten. Als wäre der eigene Körper zu klein für die Masse an Gefühlen, die hindurchrollen.
Es war nur ein kleiner Satz, der alles zum Einsturz brachte. Ich saß mit Rob im Vorzimmer des Kreißsaales. Die halbe Nacht schon und jede vorbeigehende Hebamme betrachtete uns mit einem Argwohn in den Augen, als hätte ich nur dort gesessen, weil ich nicht stark genug war, meiner Frau beizustehen. Dabei hat Fiona mich einfach weggeschickt. Sie lag da vor Schmerz gekrümmt und hat lieber auf meinen Beistand verzichtet, als sich vor mir die Blöße zu geben, für einen Moment nicht perfekt zu sein. Dabei ist es doch das, was man tut, wenn man liebt, oder? Man öffnet sich und vertraut sich. Man steht sich bei. Ich könnte gar nicht sagen, was ich in diesem Moment gefühlt habe.
Resignation, weil es das gleiche Spiel wie immer war?
Wut, weil sie mir diesen wichtigen Moment vorenthalten hat?
Erleichterung, weil ich es auf diese Weise nicht aushalten musste, sie leiden zu sehen?
Wir hörten ihr Schreien durch die geschlossene Tür hindurch und ich zuckte bei jedem Mal heftiger zusammen. Es war grausam. Rob legte seine Hand auf meine Schulter und lächelte aufmunternd.
»Ist bald geschafft, Nash«, sagte er. »Wenn sich‘s so anhört, dauerts nicht mehr lang.« Und das wusste er nur, weil er bei der Geburt all seiner Kinder dabei war. Ich fühlte so einen beißenden Neid in der Brust.
Dabei wollte ich das Baby anfangs gar nicht. Nicht unter diesen Umständen. Ich weiß noch, wie aufgeregt Fiona war, als sie mit dem Teststäbchen vor meiner Nase herumgewedelt hat.
»Jetzt wird alles gut zwischen uns«, hatte sie gesagt. »Jetzt werden wir endlich eine Familie sein. So, wie du es dir immer gewünscht hast.«
Ich war im Gegensatz zu ihr vermutlich weiß wie eine Wand gewesen. Weil ich schockiert war. Weil ein Kind zu bekommen außerhalb jeglicher Vorstellung lag, die ich mir jemals um uns gemacht hatte.
Wir waren gerade erst seit ein paar Wochen wieder zusammen. Unsere Trennung hatte mit Fionas Social-Media-Manager Chris zu tun. Aber das war schnell vorbei und eines Abends hatte sie erneut vor meiner Tür gestanden. Sie hatte geweint und gesagt, dass dieser Seitensprung der größte Fehler ihres Lebens gewesen war. Sie würde mich lieben, wir sollten das nicht einfach wegwerfen. Sie meinte, dass wir eine Paartherapie machen könnten. Wir würden unsere Probleme in den Griff bekommen, da war sie sich sicher. Ich hatte mich an ihre Worte geklammert, weil ich so sehr wollte, dass sie wahr werden. Mehr als alles andere. Sie meinte, sie hätte mich nur betrogen, weil sie sich ungeliebt gefühlt hatte. Ich hätte nie Zeit für sie gehabt und immer nur an mich gedacht. Sie wäre keine Betrügerin, aber ich hätte ihr keine Wahl gelassen.
Zach ist außer sich gewesen, als Fiona wieder bei mir eingezogen ist. »Das wird dein Untergang sein«, hatte er geflucht. Ich legte einfach auf.
Ich wollte das nicht hören.
Weil es Schwachsinn ist.
Zach weiß gar nichts über Fiona und mich.
Hektische Stimmen katapultierten mich aus diesen Erinnerungen zurück in die Realität. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, wo ich war. Rob neben mir stand auf und schaute besorgt auf mich hinab. Und dann sah ich es auch. Eine Hebamme, die auf uns zueilte. Sie sagte, dass es Komplikationen gegeben hätte. Die Herztöne des Babys seien mehrfach stark abgefallen. Sie sagte, dass sie jetzt einen Kaiserschnitt machen würden. Ich solle mir keine Sorgen machen, alles würde gut werden.
Ich nickte bloß. Obwohl ich Tausend Fragen im Kopf hatte, stellte ich keine einzige davon. Manchmal ist es besser, Dinge nicht zu wissen, weil man sich ihnen auf diese Weise nicht stellen muss.
Ich konnte nicht ahnen, dass dies die letzten Minuten sein würden, in denen Fionas Herz schlug.
Dass sie, während ich hier draußen auf dem Flur herumsaß und wartete, ein paar Türen weiter um ihr Leben kämpfte.
Als das erste Licht des Tages durch das Fenster auf den Linoleumboden fiel, kam endlich eine Ärztin zu uns. Mit gemessenen Schritten und einer Miene wie aus Stein gemeißelt. Es würde ihr leidtun, sagte sie. Unstillbare Blutungen. Man könne in solchen Fällen manchmal nichts machen. Meine Tochter sei auf die Neo-Intensiv-Station verlegt worden. Sie drückte meinen Arm, nickte mir zu und ließ mich dann mit dem Wissen zurück, dass soeben meine komplette Welt unter ihren Händen zum Einsturz gebracht worden war.
Ich sollte jetzt am Bett meiner Freundin stehen und gemeinsam mit ihr unsere Tochter im Leben willkommen heißen.
Stattdessen stehe ich allein vor einem Inkubator und betrachte das kleine Wesen darin. Das zarte Gesicht, die winzigen Händchen, die rote Haut.
Unsere Tochter, die plötzlich nur noch meine Tochter ist, weil es ihre Mutter nicht mehr gibt.
Der Gedanke, dass jemand von jetzt auf gleich diese Welt verlässt, fühlt sich zu groß für mich an. Als könnte ich ihn nicht zu Ende denken, weil er so gewaltig ist, dass es nicht in meinen Kopf geht.
Das Letzte, was ich von Fiona jemals gehört habe, ist, dass ich verschwinden soll.
Nicht, dass sie mich liebt.
Nicht, dass ich auf unsere Tochter aufpassen soll.
Nicht, dass wir uns irgendwann wiedersehen.
Wäre ich nur dageblieben.
Hätte ich darauf bestanden.
Hätte ich doch nur ihre Hand gehalten.
Jetzt ist sie mit zweiundzwanzig Jahren ganz allein in einem Operationssaal gestorben. Das Leben ist nicht fair. Ich wünschte, dass ich mit ihr tauschen könnte. Es fühlt sich an, als hätte ich das schon längst getan. Als wäre jedes Fünkchen Energie aus mir gewichen und hätte Platz gemacht für eine alles umfassende Leere. Als wäre das hier ein Traum, aus dem ich morgen früh aufwache. Wenn die Sonne ein weiteres Mal aufgeht und durchs Fenster hineinscheint. Auf Fionas Körper, der in meinem Bett liegen würde. Auf ihr verschlafenes Gesicht, das sich wohlig verziehen würde, wenn ich meine Arme um sie schlinge.
Mein Atem zittert so sehr, dass ich für einen Moment die Augen zusammenkneifen muss, um nicht völlig die Kontrolle zu verlieren. Dann spüre ich, wie Rob hinter mich tritt und seine Hand auf meine Schulter legt. Schwer. Das Versprechen, dass er da ist. Ich starre nur weiterhin dieses Baby an, das mit den Ärmchen rudert und im nächsten Moment Geräusche von sich gibt, die mein angehaltenes Herz mit einer kolossalen Wucht weiterschlagen lassen. Es klingt so furchtbar verzweifelt, dass sich mir alle Nackenhaare aufstellen. Rob drückt die Klingel, während in meinem Inneren Panik ausbricht. Es ist der erste Moment, in dem mir klar wird, dass der Tag kommen wird, an dem ich mit diesem Kind nach Hause gehen muss. Allein. Wie soll ich das machen? Das ist nichts für mich. Das ist nicht mein Leben. Das will ich nicht. Das kann ich nicht.
»Nash, atme durch. Ganz ruhig.« Rob legt auch seine zweite Hand auf meine Schulter.
»Ich muss hier weg«, hauche ich, doch er hält mich fest.
»Nein, musst du nicht.«
Die Tür fliegt auf und eine Krankenschwester kommt herein. Ihr Lächeln ist so glatt wie ihre ganze Erscheinung.
»Mr. Cohen?«, fragt sie leise, während das Babyweinen immer lauter wird. Die Geräusche türmen sich wie eine Welle auf. Verstärken sich immer weiter, bis nichts als ein hochfrequenter Piepton übrigbleibt. Ich kann meine Augen nicht mehr fokussieren. Die Krankenschwester bleibt vor mir stehen und schaut mich besorgt an. Alles sieht aus wie in einem Strudel. Auch ihr Gesicht wirkt seltsam verzerrt.
»Mr. Cohen?« Es klingt wie durch Watte, weil das Blut in meinen Ohren rauscht. Ich …
»Verdammt, Nash«, höre ich verschwommen und fühle im nächsten Moment, wie die Welt sich dreht und mein Kopf hart auf dem Boden aufschlägt.
»Nash. Hey … Nash? Hörst du mich?« Jemand klatscht mir einen nassen Lappen ins Gesicht. Langsam komme ich wieder in meinem Körper an.
»Was …«, frage ich und schaue Rob an, dessen Gesicht direkt vor meinem ist. Beim Versuch, mich hinzusetzen, wird mir sofort schwarz vor Augen. Es dauert ein paar wummernde Herzschläge lang, bis sich mein Sichtfeld klärt. Neben Rob kniet noch eine weitere Krankenschwester, die genauso besorgt aussieht wie die erste.
»Sorry«, stammle ich. Meine Stimme klingt wie von ganz fern. Als würde ich sie zum ersten Mal hören.
»Alles gut, Mr. Cohen. Sie sind nur kurz ohnmächtig geworden. Es war eine harte Nacht für Sie.«
Sie beugt sich zu mir herüber und nimmt mein Handgelenk, um den Puls zu fühlen.
»Nimmt er irgendwelche Medikamente?«, fragt sie an Rob gewandt und runzelt die Stirn.
»Nein, ich nehme nichts«, sage ich schnell. »Ich will auch nichts.«
Sie nickt so bedächtig, als würde sie mir kein Wort glauben. Dabei ist es die Wahrheit. Ich nehme keine Tabletten. Niemals wieder.
»Dann hole ich Ihnen trotzdem mal ein Glas Wasser.« Damit kommt sie aus der Hocke hoch und verlässt den Raum. Auch Rob steht auf. Ich bleibe sitzen.
»Gehts, Mr. Cohen?«, fragt die andere Krankenschwester, die mit meiner Tochter auf dem Schoß in einem Sessel sitzt. In der Hand hält sie ein kleines Milchfläschchen.
Ich nicke und halte den Blick starr auf das nuckelnde Baby gerichtet. Nichts geht. Gar nichts.
In meinem Kopf blitzen Momentaufnahmen auf, die mein völlig umnachtetes Hirn mir vorspielt. Fiona, wie sie mit dem Baby im Arm auf dem Bett sitzt. Wie sie glücklich lächelt und über die dunklen Haare streichelt.
Niemand sagt etwas. Zumindest so lange, bis die zweite Schwester wieder da ist. Sie tritt an mich heran und drückt mir ein Wasserglas in die Hand. Ich kann ihren Blick auf meinem Gesicht spüren, aber schaffe es nicht, sie anzusehen. Ich wünschte, ich könnte einfach weg von hier. Morgen früh aufwachen und feststellen, dass alles nur ein schlechter Traum gewesen ist.
»Mr. Cohen, hören Sie mich? Wenn Sie lieber einfach nach Hause fahren wollen, dann machen Sie das. Tun Sie bitte, was sich richtig anfühlt. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie heute nicht hierbleiben können. Ihre Kleine ist bei uns gut versorgt. Nehmen Sie sich einen Moment, um das alles zu verarbeiten.«
Ich schaue weiter an ihr vorbei aus dem Fenster. Meine Augen haben jeglichen Fokus verloren.
»Ich bringe ihn nach Hause. Wir kommen später wieder«, bestimmt Rob. Vielleicht haben sie beide recht. Vielleicht sollte ich gehen. Was soll ich hier schon ausrichten? Als wüsste ich, was so ein Baby braucht. Als wäre ich hier eine Hilfe für irgendwen.
Also rappele ich mich auf. Mein Körper ist so schwer, dass ich kaum aufrecht stehen kann.
»Komm.« Rob schiebt mich zur Tür. Ich schaffe es nicht, noch einen Blick auf mein Kind zu werfen. Nicht weil ich nicht will, sondern weil ich nicht kann. Ich will sie nicht hassen. Ich will dieses Baby lieben, aber gerade ist da nur dieses ätzende Gefühl, dass sie an allem schuld ist.
Als hätte ein Leben das andere aufgewogen.
Als hätte sie mir Fiona weggenommen.
Wie soll ich das überleben?
Auf der Fahrt nach Hause ist mein Kopf leer. Merkwürdige Gedankenfragmente wabern umher, alles ist wie in Watte gepackt.
»Wie plant man eine Beerdigung, Rob?«
»Das musst du nicht. Das kann jemand anderes tun. Du solltest dich auf dich konzentrieren. Wenn ich dir einen Rat geben darf, dann nimm dir Zeit, Nash. Komm auf die Füße und ordne dich neu. Es tut mir so leid, was heute passiert ist.«
»Wie soll ich denn mit einem Kind leben? Ich kann das nicht. Ich kann mich nicht um ein Kind kümmern.«
Er biegt in meine Auffahrt ein, hält vor dem Eisentor und wartet, bis der Pförtner es öffnet.
»Du kannst das. Alle Eltern können das.«
Eltern. Ich bin der Vater von diesem Kind. Für immer. Heiße Panik macht sich in mir breit. Wie ist man als Vater? Was muss man da tun? Wie erkenne ich, wann das Baby Hunger hat, wann es müde ist … das … ich …
Rob hält vor dem Haus und umrundet das Auto. Er öffnet meine Tür und schaut mich wieder nur an.
Ich steige mechanisch aus.
»Soll ich noch mit reinkommen?« Sein Blick heftet sich auf mein Gesicht, doch mehr als ein Kopfschütteln bringe ich nicht zustande.
»Sicher?«
Nicken.
Er scheint einen Moment zu überlegen, setzt sich dann aber in Bewegung. »Ich komm trotzdem mit rein. Du siehst nicht aus, als wäre es schlau, dich allein zu lassen.«
Damit geht er an mir vorbei und gibt die Zahlenkombination für die Tür ein.
Irgendwann später kommt Zach dazu und Rob macht Feierabend. Er fährt jetzt zu seiner Frau nach Hause. Isst zu Abend. Sagt seinen Kindern gute Nacht. Wie in einer anderen Welt. In meiner Welt tut niemand solche Dinge.
Weil du kein verdammtes Kind mehr bist.
Ist es verwerflich, wenn ich mich manchmal immer noch so fühle? Ich habe doch auch keine Ahnung, was ich jetzt alles machen muss. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passieren wird und was mit meinem Leben geschehen ist.
Zach hat Essen dabei und stellt die Kartons auf dem riesigen Esstisch im Wohnbereich der unteren Etage ab.
»Hey, Mann, mein Beileid«, sagt er, während er mich an sich drückt. »Sonst alles klar?«
»Nein, Zach, was ist das für eine Frage?«
»Sorry, Gewohnheit.« Er nimmt sich ein Stück Pizza und setzt sich mir gegenüber an den Tisch. An seinem und meinem Platz stehen jeweils ein Teller und ein Glas Wasser, das er eben aus der Küche geholt hat. Er benutzt den Teller allerdings nicht, sondern isst die Pizza mit der Hand. Mir wird schon von dem Geruch schlecht.
»Ich habe mit ihren Eltern gesprochen. Sie werden sie überführen lassen und in Connecticut auf ihrem Hillbilly-Friedhof begraben.«
»Was?«
»Na, die Beerdigung. Ihre Eltern wollen das bei sich im Ort abhalten.«
»Aber …«
»Ist doch besser so. Was willst du hier mit einem Grab? Blumen pflanzen?«
Seine Stimme ist geschäftsmäßig wie immer. Wie kann er das nur? Wie kann er einfach immer weitermachen? Ich erinnere mich noch an den Tag, an dem sein Vater gestorben ist. Er stand abends wieder neben mir im Backstagebereich der Arena. Als würde er vor allem weglaufen, was in ihm ist. Ich habe das auch versucht, aber ich bin nicht schnell genug gerannt.
»Was ist mit der Kleinen? Wann kann sie aus dem Krankenhaus entlassen werden?«, fragt er kauend weiter.
Ich starre auf meinen Teller. Meine Muskeln sind so verkrampft, als könnte ich niemals wieder lockerlassen.
»Ich kann das alles nicht«, flüstere ich. Kaum hörbar und doch reicht es, dass Zach schnaubt.
»Wie meinst du das bitte?«
»Ich kann kein Vater sein. Ich weiß gar nicht, wie das geht.« Ich klinge erbärmlich. »Ich bin kein guter Vater. Ich bin nie hier. Ich will das nicht. Ich kann nicht. Kannst du nicht Fionas Familie fragen, ob die sie nehmen?«
»Bist du irre, Kid? Was glaubst du, was dann los ist? Du hast eh keinen guten Stand. Solche Spielereien kannst du dir nicht erlauben. Du wirst da schön jeden Tag ins Krankenhaus fahren und dieses Kind besuchen.«
»Ich weiß nicht.«
Zach beugt sich über den Tisch. »Wie, du weißt nicht? Was ist los mit dir, verdammt?« Seine Stimme überschlägt sich fast.
»Ich trauere, Zach.«
Er winkt ab und schnaubt schon wieder. Als könnte er nicht fassen, dass er sich mit jemandem wie mir herumschlagen muss.
Ich stütze die Ellenbogen auf den Tisch und lege die Handballen vor die Augen. »Zach, ich bin nicht bereit dafür. Ich schaffe das nicht.«
»Das fällt dir ja früh ein, was? Du hast dir das selbst eingebrockt, Kid. Weil du nicht auf mich gehört hast. Weil du nie auf mich hörst, wenn ich dir was sage. Und dann erwartest du, dass ich dir den Arsch rette.«
»Meine Freundin ist heute gestorben.«
Er steht einfach auf. »Ja, ich weiß. Aber du lebst. Also muss es für dich weitergehen.« Seine Hand landet so hart auf meinem Rücken, dass die Luft aus meiner Lunge entweicht. »Ich kann dir eine Nanny ranschaffen, aber du wirst dieses Kind hierbehalten und du wirst dich damit in der Öffentlichkeit zeigen. Das kann ich dir gleich sagen. Wir müssen Pluspunkte sammeln nach dieser ätzenden Schlammschlacht um eure Trennung. Die Leute mögen keine Typen, die schlechte Väter sind oder die so tun, als wären sie gar keine. Und mal unter uns - du müsstest ja außerdem am besten wissen, wie es sich anfühlt, wenn man keinen hat, oder?«
Damit verlässt er den Raum. Ich zucke richtig zusammen, als mir seine Worte bewusst werden. Sie liegen mir bleischwer im Magen. Aus dem Flur höre ich noch ein: »Und Kid? Wenn ihre bescheuerten Eltern hier anrufen, lass dich nicht bequatschen. Dein Anwalt hat heute mit denen Kontakt gehabt. Die wollen Kohle. Das sollen sie mit ihm klären. Denen steht gar nichts zu.«
Ich starre durch die geöffnete Tür in den Flur und habe gar keine Worte für das, was ich gerade empfinde. Ich kann fühlen, wie die Mauer in mir immer höher wird, immer bedrohlicher. Ich will, dass Zach von hier verschwindet, und gleichzeitig habe ich solche Angst vor dem Alleinsein. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich damals so über Fionas Einzug gefreut habe.
Weil endlich jemand da war.
Sonst bin ich jeden Abend durch die Räume gewandert, habe alle Fenster zwei Mal abgeschlossen und die Lichter angelassen. Und wenn ich dann im Bett lag, habe ich nur gehofft, dass die Sonne schnell wieder aufgeht. Ich hatte schon immer Angst vor den Schatten, die der Mond an die Wände wirft. Sie sind wie bedrohliche Monster. Und wenn die Uhren um Mitternacht auf den nächsten Tag umspringen, dann können sie nach deiner Seele greifen. Der Gedanke daran lässt mein panisches Herz jede Nacht rasen. Eigentlich ist es nur eine dumme Geschichte, aber mein Körper glaubt heute noch daran.
Als ich abends in der Dusche stehe und der heiße Dampf mich einhüllt, halte ich den Kopf unter das rauschende Wasser und stelle mir vor, dass der Strom aus Tropfen alles aus mir herauswaschen könnte. Alle Emotionen und Gefühle. Meine Gedanken springen hin und her. Es fühlt sich noch immer an, als wäre das heute gar nicht passiert. Als wäre es gar nicht mehr heute. Es ist viel zu viel für einen einzelnen Tag. Während ich die Augen wieder öffne und mein Blick auf Fionas Nachthemd fällt, das hinter der Tür an einem Haken hängt, schlägt die Erkenntnis mit Wucht ein.
Fiona ist tot.
Tot.
Für immer.
Sie wird niemals mehr wiederkommen. Ich werde für immer hier zurückbleiben. Egal, was ich tue, ich kann sie nicht wiederhaben. Egal, wie sehr ich es will, sie wird immer fortbleiben. Nichts und niemand kann das ändern. Keine Paartherapie, keine Auszeit, kein Baby.
Mit einem Mal ist in meiner Lunge kein Platz mehr. Ich schnappe nach Luft und bekomme keine.
Ich werde an dem Gedanken ersticken.
Langsam und qualvoll.
Ich suche an den Wandfliesen nach Halt, aber da ist keiner.
Sie ist tot.
Ich gehe auf die Knie.
Sie ist tot.
Ich sinke auf den Boden, schlinge die Arme um meine Beine, wippe vor und zurück.
Tot. Tot. Tot.
Eine fremde Macht schüttelt meinen Körper und schnürt mir alles ab. Ich atme flach und angestrengt, aber es reicht nicht. Es ist nur noch ein Röcheln. Tränen schießen in meine Augen, der Druck in meiner Brust ist unaushaltbar.
Diese Nacht kann ich unmöglich überleben.
Das hier ist das Ende.
Kapitel 4
Dass die Welt am nächsten Morgen besser aussieht, ist die größte Lüge des Lebens.
Am nächsten Morgen scheint zwar wieder dieselbe Sonne, aber es kommt mir nicht vor wie eine zuversichtliche Geste des Universums, sondern nur wie der größte Hohn überhaupt.