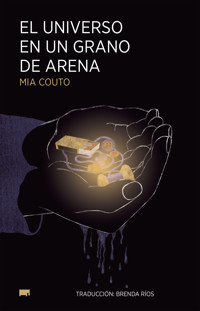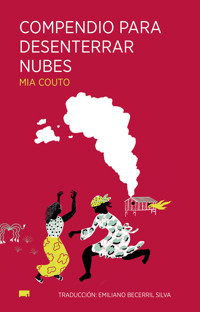19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die junge Imani kümmert sich aufopfernd um ihren Geliebten Germano, der sich schwer versehrt in ein abgelegenes Dorf am Flussufer gerettet hat. Währenddessen tobt der Krieg zwischen der portugiesischen Krone und dem mosambikanischen Herrscher Ngungunyane immer erbarmungsloser: Die schwer bewaffneten, aber entmutigten Portugiesen, die weder die Sprache noch das Land verstehen, auf der einen Seite und das riesige Heer des Ngungunyane, der selbst einen Krieg gegen das eigene Volk führt, auf der anderen. Schließlich fasst Imanis Vater einen verzweifelten Entschluss: Er will Imani dem Herrscher zur Frau anbieten – damit sie ihn tötet. Sprachgewaltig lässt Mia Couto ein einschneidendes Kapitel der mosambikanischen Geschichte und portugiesischen Kolonialzeit wiederauferstehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2021