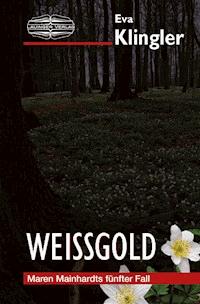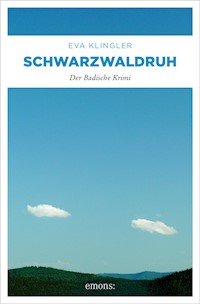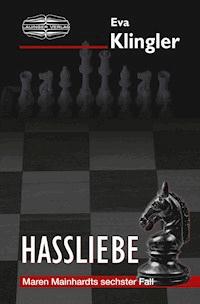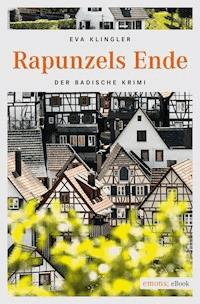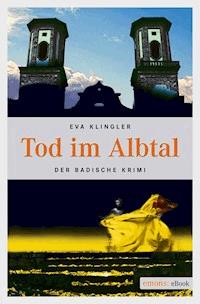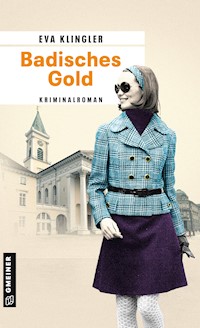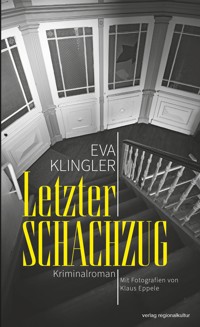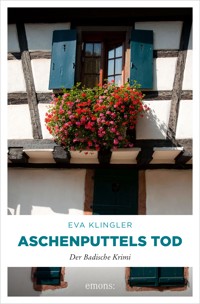
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Der Badische Krimi
- Sprache: Deutsch
Das Outlet-Center an der deutsch-französischen Grenze ist das Schreckgespenst der Boutiquen in der Umgebung von Baden-Baden, Karlsruhe und Rastatt. Doch dass es auch Menschenleben fordert, will die Polizei zunächst nicht glauben. Aber bringt sich eine Frau um, die auf der Warteliste für eine limitierte Louis-Vuitton-Tasche steht? Nein, meint Modeberaterin Swentja Tobler. Sie ist überzeugt, dass Eva Mondrian umgebracht wurde, doch erst als weitere Morde geschehen, beginnt man ihr zu glauben. Dabei ist der Täter zu allem entschlossen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eva Klingler, 1955 in Gießen geboren, lebt als Autorin in Karlsruhe und Selestat (Frankreich). Sie studierte Germanistik und Anglistik in Mannheim, absolvierte ein Volontariat beim Südwestrundfunk in Baden-Baden, arbeitete als Journalistin für Tageszeitungen, als Bibliotheksleiterin und als Dozentin in der Erwachsenenbildung. Die meisten ihrer zahlreichen Veröffentlichungen – oft Krimis – spielen in Baden oder im Grenzgebiet zum Elsass. Eva Klingler war Stipendiatin der renommierten »Reemtsma Stiftung für Nachwuchsautoren«. Im Emons Verlag erschien »Tod im Albtal«.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2013 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/age Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-224-1 Der Badische Krimi Originalausgabe
Prolog
EINS
Gleich vorweg: Ich bin nicht besonders beliebt. Wäre ich eine Romanfigur, erhielte ich massenweise schlechte Bewertungen.
So bin ich kein Veilchen im Moose, nicht bescheiden, nicht sonderlich großzügig und nur eingeschränkt hilfsbereit. Nein, ich würde eben nicht nachts zur Autobahnraststätte fahren und irgendeine gestrandete Freundin abholen. Wenn sie Glück hatte, würde ich ihr ein Taxi rufen.
Dennoch besitze ich so etwas wie ein Gerechtigkeitsgefühl, und das sagt mir unüberhörbar, dass Mörder nicht frei herumlaufen sollten, sondern eingesperrt gehören. Schließlich entfernt man ja auch ein Hornissennest, wenn es sich in der Nähe des eigenen Schlafzimmers befindet.
»Hornissen sind nützliche Tierchen«, höre ich schon einige meiner biologisch-dynamischen Bekannten streng einwenden. So als ob es auch »gute« Mörder gäbe, die die Gesellschaft von unsympathischen Zeitgenossen befreiten.
Nicht so im Fall des einige Zeit zurückliegenden Todes der armen, harmlosen Friederike Schmied, die niemandem etwas zuleide getan hatte. Außer mir, denn sie hatte mein Geschäft als Stilberaterin ruiniert, das sich nach ihrem gewaltsamen Ableben nie mehr wirklich erholt hatte.
Außer vielleicht in Ländern wie Nicaragua und Sizilien gilt nämlich eine recht simple Regel: Baust du ein neues Gewerbe auf und einer deiner ersten Kunden wird in deinem Beisein ermordet, so kannst du das getrost als eine Art Todesurteil für dein junges Unternehmen betrachten und deine Kundenkartei löschen sowie das Notizbuch mit den nützlichen Telefonnummern verbrennen.
Aus. Finito.
Deiner Bankberaterin magst du aus dem Wege gehen und dich wieder darauf konzentrieren, eine brave badische Hausfrau zu werden, die nichts anderes im Sinn hat, als ihren Mann zu verwöhnen, die T-Shirts verwöhnter Töchter zu bügeln und die Wohnung zu putzen, was sie hierzulande »aufwische« oder, noch schlimmer, »nauswische« nennen.
Wie oben beschrieben war es mir vor etwa zwei Jahren mit meinem Geschäft ergangen, nur dass ich nicht zurück an den Putzeimer musste, da ich sowohl dafür als auch fürs Bügeln jemanden bezahle. Bliebe das Verwöhnen des Mannes, doch dies ist zumindest für mich keine sinnstiftende Angelegenheit.
Gerade hatte ich mich aus der Oberflächlichkeit meines Steueranwaltsgattinnendaseins befreit und als Einkaufsberaterin selbstständig gemacht, da wurde eine meiner ersten Kundinnen fein säuberlich in einer Ettlinger Umkleidekabine erwürgt aufgefunden. Und zwar während ich unweit davon wartete, dass sie mit ihrem neuen Unterhemd herauskäme.
Unsere hübsche Fachwerkkleinstadt Ettlingen versank in eine Art Schockstarre, und man begann, mich subtil zu meiden und zu schneiden. Ein Spielchen, das die bessere badische Gesellschaft, ein Überbleibsel der Beamten und Kleinadeligen aus der alten Residenz, hervorragend beherrscht.
Der Mord an Friederike war schließlich mit meiner Hilfe aufgeklärt worden, doch geblieben waren mir ein schlechter Ruf, eine latente Freude am Detektivspielen sowie die schwelende Liebschaft mit Kriminalkommissar Hagen Hayden. Hagen arbeitet als Kriminalbeamter auf dem Revier in Ettlingen und war seinerzeit mit dem Mordfall Friederike Schmied befasst gewesen.
Obwohl wir keineswegs Seelenverwandte, sondern im Gegenteil wie Feuer und Wasser beziehungsweise wie C&A und Armani waren, so schrammten wir doch haarscharf an einer Beziehung vorbei.
Und tun es noch. Vorsichtig. Lustvoll. Mit fast schüchterner Vorfreude auf das, was kommen könnte.
Unweigerlich eines Tages kommen musste.
Ich fragte mich selbst, warum ich nicht längst einfach ein paarmal mit ihm ins Bett gegangen war und meine Neugier auf seinen Körper, auf seinen Geruch, auf den Geschmack seines Schweißes nach dem Sex und nach dem Ausdruck in seinen Augen, wenn er mich hinterher in den Arm nahm, befriedigt hatte.
Womit die Sache im Normalfall erledigt wäre.
Ich hatte es nicht getan, weil er mir überdeutlich gesagt hatte, dass er keiner für nebenher war. Hagen war zu stolz für die Zweitbesetzung.
Trotzdem konnten wir nicht voneinander lassen.
So begegneten wir uns etwa um zehn Uhr morgens am Marktplatz im Café. Oder beim Spazierengehen mit Hagens hässlichem Hund, der mich mit seinen tiefen dunklen Augen immer ansah, als durchschaute er mich und meine uneingestandenen Wünsche. Diese Treffen schienen zufällig, doch sie waren es nicht. Wir stritten dann genussvoll. Redeten atemlos, als würde uns die Zeit zu kurz. Berührten uns und sehnten uns nacheinander.
Meist reisten wir mit getrennten Autos an, und verlegen verabschiedeten wir uns, ohne dass wirklich etwas passiert war.
Ich trug für diese Anlässe meistens ganz schlichte, eher preiswerte Sachen von Jil Sander oder von Olsen: Hersteller, die ich normalerweise meide wie die Pest, da jedermann sie sich leisten kann und ich sie schon deshalb nicht haben will.
So wie die kleine Bluse von Marlene Birger für nur knapp einhundertfünfzig Euro, bei der es trotzdem ärgerlich gewesen war, dass der Ketchup von Hagens heiß geliebter und von mir verabscheuter Currywurst darauf gelandet war. Es war ein nettes Teil gewesen, und – mein Gott – man kann schließlich auch mal günstig kaufen.
Einmal waren wir zusammen zum Rhein gefahren. Wir hatten am Rappenwörtbad geparkt und waren spazieren gegangen. Wenn man die Augen schließt und nur hört, wie die Wellen glucksen und wie es riecht, dann kann man dort fast vergessen, dass dies hier nicht das Meer, sondern nur der Rhein ist und dass das pfälzische Ufer auf der anderen Seite schon zum Greifen nah erscheint. Doch ich liebe den Rhein und seine Promenaden in Basel, in Straßburg, in Mainz und in Düsseldorf, und das nicht nur, weil man in all diesen Orten gut einkaufen kann.
Es ist mehr. Dieser breite Fluss mit seinen vielgestaltigen Ufern ist für mich ein Symbol unserer Kultur und Lebensweise, mit jahrtausendealter Tradition von Handel und Wandel und der beruhigenden Gewissheit, dass all das auch mein Leben überdauern wird. Kaum jemand in meinem Kreis würde der oberflächlichen, hübschen Frau von Dr.Tobler überhaupt solche Gedanken zutrauen. Ich bin mir dessen bewusst, doch mein mieser Ruf stört mich nicht. Ich lebe mit ihm schon so lange, dass er mir vertraut ist wie ein alter Bekannter. Schlimmer wäre es für mich, wenn die Leute sagten, meine Schuhe passten nicht zum Outfit oder mein Pony sei nicht perfekt geschnitten.
Wir waren also am Rhein gewesen, und das nicht etwa bei schönem Wetter, nein, das wäre Hagen zu einfach. Der liebt die Herausforderung. Vielmehr war es gewittrig, stürmisch gewesen, Wolken spielten am Himmel miteinander Verstecken, und ein unruhiges Wellenspiel kräuselte das graue Wasser.
Mein Schal, ein Seidenteil von Gucci in Rostfarben und ein Mitbringsel aus Italien (es muss nicht immer Hermès sein, meine Damen!) war davongeflattert wie ein zerrupfter Vogel. Blitzschnell, mit der Reaktionsfähigkeit eines echten Polizisten, hatte Hagen ihn eingefangen und mir wieder um den Hals gelegt.
Die Geste hatte sich gut und behütend angefühlt. Eine Weile hatte er mich noch festgehalten, dann mit den Lippen meine Wange und meinen Hals gestreift. Ich hatte mich an seinen muskulösen Oberarm geklammert, doch er hatte sich energisch frei gemacht.
»Du bestimmst, wann es Zeit dafür ist!«, sagte er ernst. »Du kennst die Regeln.«
»Du hast sie gemacht«, erwiderte ich. »Du könntest sie also auch brechen.«
Er sah mich ernst an, streichelte mir kurz übers Gesicht, zeichnete die Konturen meiner Lippen nach.
»Es sind gute Regeln«, sagte er ruhig. »Sie haben sich bewährt. Erst musst du frei sein, dann sehen wir weiter.«
* * *
Zurückzukehren an Schminktisch und Herd war also nicht so einfach gewesen. Nicht etwa wegen des Geldes.
Mein Mann, meistens abwesend und gleichgültig, teilte sein Bett, aber vor allem sein Konto mit mir – das heißt, ich konnte mir kaufen, was ich wollte und was auch immer es kostete. Gestern erst waren eine schwarze, hautenge Cambio-Jeans in Größe 38 und ich an der Kasse eines Modehauses in Karlsruhe zum Nachteil meiner Kreditkarte zusammengetroffen.
Ein klassischer Fehlkauf übrigens. Cambio ist normalerweise perfekt in Hosen, doch zu Hause und in Ruhe in meinem Ankleidezimmer von hinten betrachtet, saßen sie etwas zu eng, was mir Sorgen bereitete. Ich hatte also zugenommen. Kein Wunder.
Meine Tochter weilte im Ausland, mein Mann war zwar körperlich anwesend, aber gedanklich weit weg, die Versuchung wartete in Ettlingens Polizeihauptquartier – das heißt, ich aß zu viel, um innere Leere und Konflikte zum Schweigen zu bringen.
Keine Kohlehydrate mehr nach zwölf Uhr mittags! Dieses eiserne Gesetz hatte ich in diesem Monat schon zweimal abends mit Pasta und einem Reisgericht in einem chinesischen Restaurant gebrochen.
Dass dies in Gegenwart meiner Bridgefreundinnen geschehen war, die keinen Anstoß daran nahmen, machte die Sache nicht besser. Es handelte sich dabei um ältere Damen, die sich weltweit ähneln in ihren weit geschnittenen Blusen und Kasacks zum Drüberhängen und denen es vermutlich egal ist, wie sie nackt aussehen.
Ich verabscheue diese Einstellung. Beinahe wie in der Unterschicht! Sich vollstopfen. Aufquellen. Und dann ab mit einer Tüte Chips vor den Fernseher. »Britt am Mittag« gucken. Ein RTL2-Leben. Ferngesteuert bis zur Verblödung.
Nicht mit mir!
Ich hatte immer eine vorbildhafte Figur gehabt, und ich plante auch, mein geschmackvolles Totenhemd von der Firma »Last Design. New York, Paris, London« in Größe 38 noch überstreifen zu können. Oder vielmehr würde man es mir überstreifen. Kein schöner Gedanke, wie jemand meine Arme und Beine bewegen würde wie die einer Puppe. Das Handgelenk roh abknickte, weil mir ja nichts mehr wehtat.
Doch bevor es so weit war, dass ich in meinem Luxussarg zur ewigen Ruhe käme, musste ich mich irgendwie beschäftigen.
Arbeit kam mir in diesem Zusammenhang allerdings nicht in den Sinn. Wozu auch?
Hat sich mal irgendjemand Gedanken darüber gemacht, dass Reichsein durchaus auch ein Fluch sein kann? Vor allem für schwache Charaktere, welche nur auf einem Strom von Einladungen und Teepartys dahintreiben, irgendeinem Ende entgegen.
Nun war ich aber kein schwacher Charakter, und deshalb würde ich schon etwas finden, das einen Hauch interessanter war, als morgens die Blumenerde auf Feuchtigkeit hin zu überprüfen und zuzusehen, wie meine Perle die Bilderrahmen abstaubt. »Bitte, Danusza, auch oben, sehen Sie, da … Ja, genau da, wo man nicht hinsieht.«
Es gab ja glücklicherweise in unseren Kreisen noch ausreichend andere sinnarme Tätigkeiten. In diesem Winter war der Job der Kassiererin in Ettlingens feinstem Tennisclub vakant geworden. Ich bräuchte nur die Hand danach auszustrecken, und er wäre mein.
Die Damen, die dort in weißen und lachsfarbenen Höschen und Röckchen herumturnten, waren zu fast hundert Prozent wohlhabende hauptberufliche Ehefrauen wie ich. Singles gab es nicht, und wenn, dann waren es Witwen, die sich zögernd auf diese Weise wieder ins gesellschaftliche Leben einklinkten.
Die zu den Ehefrauen gehörigen Männer waren vielfach Kunden meines Mannes, des Steuer(hinterziehungs)anwalts. Sie behandelten mich vorsichtig, denn wahrscheinlich nahmen sie an, ich wüsste alles über die schwarzen Konten ihrer Männer.
Was nicht der Fall war, denn mein Mann und ich pflegten gesprächehalber höchstens so engen Kontakt wie ich zu meiner seit Jahren vertrauten Eierfrau auf dem Markt. Deren starkes Pfälzisch verstand ich nicht immer, doch sie strahlte eine gewisse Herzlichkeit aus, die meinem Mann gänzlich abging.
Schon mit meinem Friseur Raoul in Achern teilte ich mehr Geheimnisse als mit meinem Ehemann. Beispielsweise, dass ich kürzlich sieben graue Haare in meinem strohblonden Haar entdeckt hatte. Entsetzt hatte ich es unter dem Vergrößerungsspiegel untersucht. Ich bin eine halbe Schwedin. Wir ergrauen nicht frühzeitig, sondern unser Blond wird einfach nur blasser.
»Es sind deine dummen Gene«, hatte Raoul geklagt. »Italiener und Schweden sollten haartechnisch gesehen keine Kinder zeugen. Italiener werden furchtbar schnell grau. Das hast du nun von deinen italienischen Vorfahren, Swentja!«
Zu spät! Meine Eltern hatten sich auf halber Strecke derart heftig ineinander verliebt, dass es für beide Teile nicht mehr möglich gewesen war, sich an das jeweils andere Ende von Europa zurückzuziehen.
Manchmal sehnte ich mich nach solch einer irrationalen Liebe. Dann dachte ich an Hagen, machte mir die Konsequenzen, die er forderte, klar und versuchte, schnell wieder vernünftig zu werden. Es gab für mich keine Alternative zu der Ehe, die ich führte.
Zurück zu meiner Notwendigkeit, mich irgendwie zu beschäftigen.
Ich hatte absolut keine Lust, Kassiererin im Tennisclub zu werden und Beiträge von Frauen einzutreiben, die zu dämlich waren, einen Dauerauftrag auszufüllen.
Ich selbst hatte übrigens höchst selten mit richtigem Geld zu tun.
Überall bezahlte ich mit Kreditkarten oder mit dem guten Namen meines Mannes, das heißt, es gab irgendwelche Konten, von denen diskret abgebucht wurde: Tiefgarage, Friseur, Fußpflege, Kosmetikerin, sogar beim Bäcker stempelte die ewig unausgeschlafen aussehende Verkäuferin eine Karte ab, die sie dann in ein Kästchen einordnete. Nur bei meinen schicken, gesellschaftlich erwünschten Besuchen auf dem Ettlinger Wochenmarkt vor dem Rathaus nehme ich Münzen in die Hand.
Ich war privilegiert, doch auch das wird zur Routine, und die machte sich in meinem Alltag breit wie ein grauer Hut, den ich jeden Morgen aufsetzte. Ich verbrachte keine Zeit, ich suchte nach Möglichkeiten, sie gewaltsam totzuschlagen.
Im Bridgeclub war die Position der Mittwochslady auszufüllen. Die letzte Mittwochslady war auf Mallorca an einem Herzinfarkt gestorben. Mittwochsladys organisieren den Spielort und die Verpflegung an den Mittwochnachmittagen, suchen den Blumenschmuck aus und laden ein. Letzteres ist eine diffizile Aufgabe, denn man kann sich kaum mehr Feinde machen als mit dieser idiotischen Einladerei.
Der Spruch »Viel Feind, viel Ehr« war jedenfalls nicht in Ettlingen entstanden, denn hier ist es keine Ehre, viele Feinde zu haben. Hier zählen die lächelnden Gesichter, die Anrufe und die Einladungen.
Auf der anderen Seite der Münze lauern janusköpfig allzu oft Neid und Kleinlichkeit. Und kalter, berechnender Snobismus.
Ganz allmählich wurden die Tage kürzer und kühler. Man konnte nicht mal mehr im Café Pierrod an der Martinskirche herumsitzen und warten, bis Bekannte vorbeikamen. Das Leben wurde ruhiger, und immer noch war kein Silberstreif einer Beschäftigung am Horizont zu sehen.
Jemand wie ich konnte sich nicht mal irgendwo bewerben. So etwas ginge sofort herum wie ein Kugelblitz in unserer kleinen elitären Welt. Ich war also zu ewiger Untätigkeit, ewiger Schönheit und ewigem Shopping verdammt.
Ich ertappte mich immer öfter dabei, wie ich in Karlsruhe und Baden-Baden durch die Läden streifte und mir überlegte, was ich denn noch brauchen könnte.
Etwa eine Handtasche!
Die Jagd nach der perfekten Handtasche ist für meinesgleichen eine lebenslange Aufgabe und so aussichtslos wie das Streben der Menschheit zu wissen, was vor dem Urknall war.
In Frage kommende Taschen müssen sich immer an einem nicht existierenden Idealbild messen lassen: Sie sind zu klein, haben zu viele, zu wenige oder die falschen Fächer, das Leder ist zu weich, es fällt in sich zusammen, es ist zu starr und macht die Tasche zu schwer.
Die Verkäuferinnen eilen hektisch herbei, wenn ich das Papier, mit dem man sie stopft wie Weihnachtsgänse, herausnehme. Böse Blicke treffen mich angesichts des Häufchens Leder, das für vierhundert Euro dann noch bleibt.
Mir egal. Ich habe aufgegeben, mich dafür zu entschuldigen. Ich mache es wie die Queen: Never complain, never explain. Oh, ich mag diese würdevolle kleine Frau mit ihren immergleichen veilchenpastillenartigen Kostümen, die sitzen wie eine eiserne Uniform.
Gerade, als ich mich fragte, ob ich vielleicht doch meine Abneigung gegen den stechenden Geruch von Mottenkugeln überwinden könnte und im Diakonieladen als Verkäuferin Gutes tun sollte, fiel mir eine ungewöhnliche Annonce in den Badischen Neuesten Nachrichten ins Auge:
»Soziologin sucht für geplantes Buchprojekt modebewusste, intelligente Dame mittleren Alters.«
Ich fühlte mich angesprochen: Die modebewusste, intelligente Dame, das war ich. Das mittlere Alter klammerte ich aus.
Zwar hasste ich Chiffren – wer nicht? –, und doch antwortete ich nun dieser, weil die innere Leere in mir anfing, laut zu werden.
Und so stolperte ich geradewegs in meinen zweiten Mordfall.
ZWEI
Die Soziologin rief mich an einem Dienstag um halb acht Uhr abends an. Keine ungeschickte Zeit. Lang genug vor der Tagesschau. Hätte ich Kinder und Mann, wären sie jetzt schon abgefüttert. Doch ich war allein, denn mein Gatte weilte noch im Büro, wie oft in letzter Zeit.
»Mein Name ist Marion Gellert. Doktor Marion Gellert. Soziologin vom Institut EMSRA in Karlsruhe. Sie haben sich auf meine Annonce beworben. Vielen Dank. Allerdings haben Sie keinen Namen angegeben.«
»Natürlich habe ich einen Namen angegeben.«
Ein warmes Lachen.
»Gewiss. Aber nicht Ihren richtigen. Laura Sambrusio! Aus Ettlingen. Ich bitte Sie!«
»Wie kommen Sie denn darauf, dass ich nicht so heiße?«
»Sehr einfach. Es gibt keine Laura Sambrusio im Einwohnermeldeverzeichnis von Ettlingen, sehr wohl aber eine Laura Sambrusio in … Sizilien. Ich habe die Dame angerufen, sehr freundliche Frau übrigens, und sie hat mir gesagt, eine entfernte Verwandte von ihr wohne in Deutschland. Und zwar in Ettlingen. Ihr Name sei Swentja Tobler. Ich nehme nun also an, das sind Sie.«
Das raubte mir die Sprache. Mühsam beherrscht fragte ich: »Wie kamen Sie auf Sizilien?«
»Die Verteilung des Namens Sambrusio ist laut dem weltweiten Personenregister ›1,2,3 people‹ fast ausschließlich auf Sizilien beschränkt. In Kombination mit Facebook und dem Vornamen Laura hatte ich Glück. Es hätte natürlich auch anders ausgehen können, das gebe ich zu.«
»Und dann?«
»Dann hätte ich Sie eben einfach nach Ihrem echten Namen gefragt. Auch eine Option. Viele meiner Bewerberinnen geben zu Beginn falsche Namen an. Die meisten wählen ihren Mädchennamen, den sie offenbar mit Draufgängertum und der Freiheit assoziieren, die ihnen in der Ehe abhandengekommen ist.«
Die Stimme der Frau am anderen Ende der Leitung war kultiviert, dunkel und trotzdem sehr sachlich. Außerdem hatte sie recht. Auch ich fühlte mich freier und jünger mit meinem Mädchennamen.
Eine Frau, die sich für ihren Geburtsnamen schämt, mag das anders sehen. Die häutet sich, unterschreibt hastig auf dem Standesamt und denkt: »Gott sei Dank bin ich die Mischpoke los und bin ab jetzt jemand ganz anderes. Jemand Besseres!«
Später, viel später, sollte ich mich an diesen flüchtigen Gedanken erinnern.
Frau Dr.Gellert hatte ruhig in den Hörer geatmet und mir Zeit gelassen, ihre Entdeckung zu verdauen. Jetzt räusperte sie sich leise. »Sind Sie noch dran?«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!