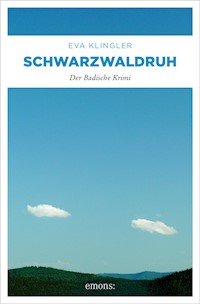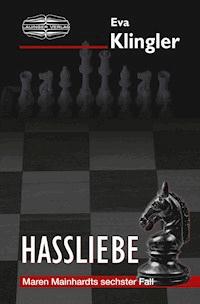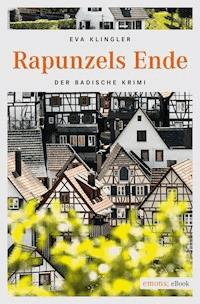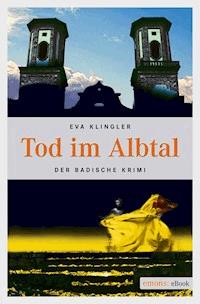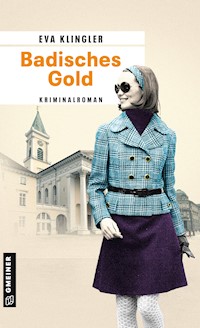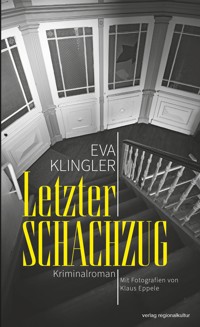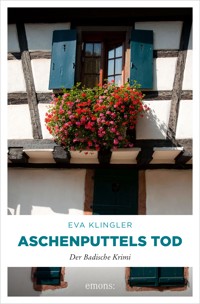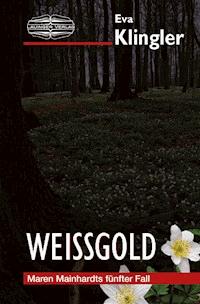
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maren Mainhardt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Maren Mainhardts fünfter Fall: Maren Mainhardt wohnt gerade zur Untermiete bei Nadia, einer Fotografin und entdeckt dort zufällig das Foto einer blutüberströmten Leiche. Von Maren zur Rede gestellt, berichtet Nadia von der grausigen Szene, die sie Jahre zuvor aufgenommen hat, sich jedoch aus Angst vor schlechter Publicity nie bei der Polizei meldete. Das Opfer verschwand offensichtlich spurlos. Maren wird hellhörig, beginnt zu recherchieren und handelt sich dabei wieder mal von allen Seiten Ärger ein: Ihre Freunde von der Polizei nehmen sie nicht ernst und Nadia will von dem Fall sowieso nichts mehr wissen. Da erinnert sich Maren an einen Auftrag, den sie vor Jahren abgelehnt hatte: Sie beginnt, nach dem damals spurlos Verschwundenen, einem jungen Mann polnischer Herkunft, zu suchen. Ihre Spurensuche führt sie in das Reich des "weißen Goldes", ins Schwetzinger Spargelmilieu: Was verschweigt der profitgierige Spargelbaron Goll? Wollte er eine "unstandesgemäße" Verbindung seiner Tochter verhindern? Gab es damals einen Streit unter Erntehelfern, der tödlich endete? Oder hatte die Tat einen fremdenfeindliches Motiv? Als Maren endlich den entscheidenden Hinweis entdeckt, scheint alles zu spät. Sie sitzt bereits in der Falle: in den Fängen eines skruppellosen Mörders...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Die Karlsruher Ahnenforscherin Maren Mainhardt wohnt vorübergehend bei der Fotografin Nadia – und stößt dort auf die Fotografie einer blutbespritzten Leiche. Von Maren zur Rede gestellt, beichtet Nadia ihr von dem Toten, die sie Jahre zuvor im Schlosspark Schwetzingen per Zufall entdeckte, fotografierte – und dann aus Angst vor negativer Publicity nicht der Polizei meldete. Warum wurde das Opfer dort nie gefunden? Und warum wurde der Mann nie als vermisst gemeldet?
Maren beginnt zu recherchieren. Doch ihre Freunde von der Polizei nehmen sie nicht ernst, und auch Nadia will von dem Fall nichts mehr wissen. Unterstützung findet Maren ausgerechnet beim Bruder ihres Ex-Freundes Melchior, dem interessanten Oliver, der allerdings seine ganz eigenen Ziele verfolgt ...
Dann zieht Maren eine Verbindung zu einem Auftrag, den sie vor Jahren ablehnte, und begibt sich auf die Spur eines verschwundenen jungen Mannes polnischer Herkunft. Ihre Spurensuche führt sie ins Reich des »weißen Goldes«, ins Schwetzinger Spargelmilieu – und zu dem profitgierigen Spargelbaron Goll. Wollte er eine unstandesgemäße Verbindung seiner Tochter mit allen Mitteln verhindern? Gab es einst einen Streit unter den Erntehelfern, der tödlich endete? Oder hatte die Tat doch einen fremdenfeindlichen Hintergrund?
Als Maren endlich den entscheidenden Hinweis entdeckt, scheint alles zu spät: Sie sitzt bereits in der Falle, in den Fängen eines Mörders, der keine Skrupel hat, erneut zuzuschlagen ...
Die Autorin
Eva Klingler, geboren 1955, ist Journalistin und Autorin. Sie arbeitete als Redakteurin beim SWR und für verschiedene Tageszeitungen und veröffentlichte bisher zahlreiche Romane und Kurzgeschichten. In der Maren-Mainhardt-Reihe sind die Bände »Erbsünde«, »Blutrache«, »Kreuzwege« und »Blaublut« erschienen.
Impressum
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2016 Der Kleine Buch Verlag | Lauinger Verlag, Karlsruhe
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
ISBN: 978-3-7650-2143-5
Dieser Titel ist auch als Printausgabe erschienen: ISBN 978-3-7650-8530-7
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Eva Klingler
WEISSGOLD
Ein badischer Krimi
Gewidmet meinem langjährigen Freund und Leser
Dr. Marduk Buscher in Baden-Baden
Prolog
Eine Entschuldigung für mein Verhalten damals?
Die kann ich nicht wirklich geben. Höchstens eine Erklärung. Es war seinerzeit nicht gerade die glücklichste Phase in meinem Leben gewesen, und wahrscheinlich hatte ich deshalb die junge Frau so abblitzen lassen, als sie mich um Hilfe in ihrem kleinen persönlichen Liebesdrama gebeten hatte.
Ich hatte meine eigenen Liebesdramen zu bewältigen. Die Ratschläge, die ich ihr gab, hätte ich lieber selbst beherzigen sollen. Kämpfte ich doch damals mit den Erinnerungen an Rüdiger, seine Tochter, die kleine Isobal, und vor allem gegen den Wunsch, bei ihm anzurufen, um ihn umzustimmen. Ein sinnloses Unterfangen, selbst in Gedanken. Diese Erkenntnis hatte mich unfreundlicher gemacht, als es sonst meine Art war.
Ein Fehler, den ich fünf Jahre später bereuen sollte. Und doch führte er dazu, dass ein Mörder, der sich schon sicher gefühlt hatte, aufgeschreckt wurde aus seiner trügerischen Ruhe.
Es ist wie mit den Staubflusen, die man unter die Vitrine kehrt, oder dem Aschenbecher, den man mit schlechtem Gewissen hinter einem Stapel Bücher verbirgt, wenn Besuch kommt: Dinge verschwinden nicht einfach. Sie haben die Tendenz, im ganz unpassenden Moment wieder aufzutauchen. So verhält es sich auch mit Mord. Manchmal. Diesmal …
Die Tat steht auf gegen den Frevler. Meist, wenn er es nicht mehr erwartet.
**********
Zurück zum Frühjahr 2004, als eine zarte, leise, aber auf ihre Weise doch bestimmte Frauenstimme telefonisch um ein Gespräch bat. Ein berufliches Gespräch, erklärte sie. So vermutete ich eine genealogische Anfrage, denn schließlich bin ich Ahnenforscherin.
Ich hörte bereits am Telefon, dass es sich um eine junge Frau handeln musste, und seltsamerweise hatte ich ein Bild von ihr vor Augen, das sich bei der ersten Begegnung sofort bewahrheitete.
Ich traf das Mädchen – ich muss sie so unpersönlich benennen, denn sie verriet mir so gut wie nichts über sich – auf ihren Wunsch im Café Palaver, einem stark alternativ angehauchten Ort am Lidellplatz, der als einer der wenigen Plätze von Karlsruhe etwas Altstädtisch-Studentisches ausstrahlt.
Sie saß alleine an einem Tisch, wirkte verloren und sah so aus wie ihre Stimme klang. Sie war mittelgroß und so schlank, dass sie beinahe mager war. Mit ihrer elfenbeinfarbenen Haut, den schwarzen Augen und dem lackschwarzen glatten Haar hob sie sich zwar von der Masse ab, doch sie wirkte nicht exotisch. Nase und Mund waren ebenfalls das, was der Engländer ›delicate‹ nennen würde und wofür es kein deutsches Wort gibt. Vergeistigt und zart, aber nicht zu unterschätzen, dachte ich.
Obwohl sie es war, die das Treffen herbeigeführt hatte, verhielt sie sich kühl, ja beinahe abweisend. Sie war eine dieser Frauen, mit denen man sich besser nicht anlegte, da unter dem Mantel der Zartfühlenden meistens ein erstaunlich harter Panzer lauerte. Oft kombiniert mit einer scharfen Zunge.
Das Mädchen saß vor einem Mineralwasser, das noch unberührt war. Wahrscheinlich hatte sie Angst, sie würde davon zunehmen.
»Frau Mainhardt, ich hatte eigentlich angenommen, Sie sähen ganz anders aus«, eröffnete sie das Gespräch auf eine ziemlich direkte Weise. »Eine Bekannte hat Sie mal erwähnt. Dass Sie Ahnenforschung betreiben. Vor allem für Frauen. Und dass Sie gut sind. Deshalb dachte ich, ich kann mit Ihnen reden.«
Ich blickte gespielt bescheiden in meinen fair gehandelten Kaffee.
»So, wie sie von Ihnen gesprochen hat, dachte ich allerdings, Sie sind noch jung.«
»Nun«, ich räusperte mich, »ich bin zwar nicht mehr zwanzig, aber auch noch keine achtzig. Ich würde mich durchaus noch als jugendlich bezeichnen.«
»Da Sie nicht mehr jung sind«, fuhr sie mit der Unverfrorenheit derer fort, die lebenslänglich auf dem Ticket ›Ich-bin-so-zart‹ reisen und damit glänzend durchkommen, »verstehen Sie mein Problem vielleicht nicht mehr. Meine Mutter begreift auch nichts. Nicht meine Schwester und mein Vater erst recht nicht. Manchmal hatte ich Angst um ihn.«
»Um Ihren Herrn Vater?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
»Nein, um ihn. Marek. Und jetzt ist er fort. Sie haben ihn alle gehasst. Vor allem meine Mutter und meine Schwester. Die leben nur für Geld und Erfolg! Das bedeutet alles für sie.«
Ich nickte so neutral wie möglich. Auch ich liebe Geld und Erfolg. Eine unerfüllte Liebe.
»Worum«, erkundigte ich mich vorsichtig, »geht es nun konkret?«
Sie fing nicht gleich an zu erzählen, musterte mich stattdessen noch einmal mit einem langen, prüfenden Blick aus ihren schwarzen Augen, die nichts Samtiges, Weiches hatten, sondern wie eine glatte polierte Fläche waren.
Dann schilderte sie ihr Problem.
Ihr Freund war verschwunden. Sie wollte ihn wiederfinden. Um jeden Preis. Er sei etwas Besonderes. Ein Künstler. Ihre Seelen befänden sich im Gleichklang. Und sie müsste wissen, ob ich derartige Fälle auch übernähme. Ohne meine Antwort abzuwarten, sprach sie weiter.
Es handele sich um einen Ausländer.
»Was für ein Ausländer?«, fragte ich.
Sie musste jetzt wieder lange nachdenken und mich prüfend mustern, bevor sie sich zu einer Antwort entschließen konnte. Zicke, dachte ich.
»Ein Osteuropäer«, kam es schließlich halblaut.
Und dann, als sei das etwas Peinliches: »Ein Pole.« Hier suchte sie trotzig in meinem Gesicht nach einer Reaktion. Sie würde keine finden. Was hatte sie denn gedacht? Dass ich mich bekreuzigte und ausrief: »Mein Gott, ein deutsches Mädel und ein Pole?«
War mir doch egal, woher ihr Liebhaber kam. Schlechte Laune keimte in mir auf.
Man sei so gut wie verlobt gewesen, fuhr sie fort, der Marek und sie.
Habe sich – auch da musste sie lange prüfen, ob sie mir vertrauen konnte – in Heidelberg kennen gelernt. Genaueres wollte sie nicht preisgeben.
»Ich bin nicht ganz ... ohne Geld. Wir sind in ... der Landwirtschaft, aber das muss Sie jetzt noch nicht interessieren. Irgendetwas stimmt nicht mit seinem Verschwinden. Er hätte das nie getan«, fuhr sie fort. »Und er hätte niemals seine Gitarre zurückgelassen.«
»Er ist also einfach so verschwunden? Ohne eine Erklärung?«
»Wenn man das so nennen will. Er hat mir einen Brief geschrieben, der aber erst ein paar Tage, nachdem er nicht mehr nach Hause gekommen ist, mit der Post zugestellt wurde. Ich hatte so sehr auf diese Nachricht gewartet. Auf eine Erklärung. Ich konnte es nicht begreifen. Wissen Sie, wie das ist? Einen ganzen Tag lang heulen?«
Ja, dachte ich. Ich weiß es.
Erstaunlicherweise klang das bei ihr jedoch alles ganz sachlich. Sie sprach von ihrem Kummer im Stil einer Nacherzählung.
»Sein Deutsch war ganz gut. Ich habe den Brief nicht mehr, aber ich gebe das jetzt trotzdem in meinen Worten wieder.«
»Warum haben Sie den Brief nicht mehr?«
»Ich habe ihn weggeworfen.«
Ich nickte und fühlte mich bestätigt. Hass und Wut waren jetzt in ihren schwarzen Augen. Ich war überzeugt, dass dieses Mädchen eine gnadenlose Feindin sein konnte. Ein eigenartiges Gefühl beschlich mich.
Leise, aber immer noch bestimmt sprach sie weiter.
»Er müsse sich das alles überlegen. Er sei ein freiheitsliebender Mensch. Ein Künstler. Es fiele ihm schwer, sich jetzt schon festlegen zu lassen. Dabei war er gar nicht mehr so jung. Er hatte«, hier errötete sie wenig altersgemäß, denn sie musste schon Anfang zwanzig sein, »schon einiges an Erfahrung.«
»Na ja, wenn er doch einen derartig … eindeutigen Brief geschrieben hat …«
»Der Brief war irgendwie eigenartig. Nicht seine Sprache. Nicht seine Worte. Ich verstehe etwas von Sprachen.«
Das kam wieder scharf zwischen ihren dünnen Lippen hervor.
»Aber das war bestimmt nicht seine Art. Einfach so zu verschwinden. Er hätte doch persönlich mit mir gesprochen! Ich will einfach wissen, wo er ist, und ihn noch mal fragen, was geschehen ist.«
»Wie lange ist denn das alles her?«
»Ende April habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Also vor zwei Wochen.«
»Sie wissen es bestimmt genauer«, mahnte ich aus Erfahrung. Der Tag, an dem man verlassen wird, brennt sich lebenslang ins Gedächtnis ein. Wenn die Beziehung etwas wert war. Zumindest meine Meinung.
»Wenn Sie unbedingt wollen. Am 23. April. Morgens. Ich hatte ihm zum Tag des Buches einen polnischen Gedichtband im Original in einem Antiquariat in Heidelberg gekauft.«
Kein Wunder, dass er abgehauen ist, dachte ich. Vielleicht hätte der junge Mann sich ein etwas praktischeres Geschenk gewünscht. Nicht jeder steht auf polnische Lyrik. Nicht mal jeder Pole, vermutlich. Und sie ist auch sonst nicht gerade eine einfache Persönlichkeit, darauf wette ich.
»Er war gut gelaunt. Hatte etwas vor. Wollte mir nicht sagen, worum es ging. Eine Überraschung. Ich weiß aber jetzt, was es war.«
»Und was? Ist etwas Besonderes vorgefallen?« Nicht, dass es mich interessiert hätte!
Sie machte eine spöttisch-abwehrende Bewegung in meine Richtung, ohne mich wirklich anzusehen. So als habe sie mich beim Spitzeln ertappt. Irgendwie fühlte ich mich in ihrer Gegenwart unsicher. Ich konnte nicht erklären warum, aber ich mochte diese junge Frau nicht besonders.
»Nein, nein. Horchen Sie mich nicht aus! Etwas Lächerliches eigentlich. Deshalb ist er nicht gegangen. Bestimmt nicht. Ich erzähle Ihnen erst mehr, wenn Sie sagen, dass Sie ihn für mich suchen.«
Das alles gefiel mir gar nicht.
»Ich bin keine Privatdetektivin«, sagte ich kühler, als ich es vielleicht beabsichtigt hatte. »Und ich sammele keine entsprungenen Männer ein. Wenn ich das könnte, hätte ich bei mir selbst genug zu tun. Ich gebe Ihnen den guten Rat: Lenken Sie sich mit etwas ab und vergessen Sie den Mann. So wie er wahrscheinlich Sie vergessen hat oder wird. Solche Dinge passieren.«
Sie sah mich böse an. Ihr Mund bildete jetzt wieder diesen schmalen Strich und ihre Augen waren kleiner geworden.
»Sie wissen nicht, was wir für eine Art von Beziehung hatten. Das war etwas Besonderes. Jetzt, da er nicht mehr bei mir ist, das ist für mich wie das – Ende der Welt.«
»Meine liebe ...«, ich kannte keinerlei Namen, musste es deshalb dabei belassen, »das denkt jeder von seiner Beziehung. Auch wenn es Ihnen schwer fällt: Ich fürchte, Ihr polnischer Verehrer hat kalte Füße bekommen. Vielleicht weil er zu Hause noch eine kleine Freundin sitzen hatte. Ich bin, wie gesagt, keine Privatdetektivin, aber im Laufe meiner Tätigkeit als Ahnenforscherin habe ich manchmal Einblicke gewonnen. Und das kommt eben leider sehr oft vor. Schätzen Sie sich glücklich, dass Sie es noch rechtzeitig gemerkt haben.«
»Sie haben keine Ahnung. Ohne ihn«, sagte sie und stand auf, »will ich nicht sein. Nicht atmen. Nicht einschlafen und nicht aufwachen. Ohne ihn macht alles keinen Sinn. Es ist draußen Frühjahr, aber für mich fühlt es sich an wie Winter. So kalt ist mir. Ohne ihn will ich nicht leben.«
»Sie sind so ziemlich die tausendste Frau, die das in meinem Leben zu mir gesagt hat, und komischerweise leben sie alle noch. Die meisten haben heute einen Stall voll Kinder und wüssten kaum noch, wie der Name desjenigen lautet, ohne den sie damals nicht leben konnten. Reißen Sie sich zusammen. Was haben Sie von einem Mann, den Sie von mir oder durch die Polizei suchen lassen müssen?«
»Das alles mag auf Sie zutreffen. Vielleicht sind Sie nicht so sensibel. Fühlen nicht so tief!«, versetzte sie. Dadurch wurde sie mir nicht unbedingt sympathischer, und mein erster Eindruck bestätigte sich. Leute, die sich selbst sensibel nennen und so furchtbar tief fühlen, sind mir immer suspekt, weil sie meistens nur dann tief fühlen, wenn es um sie selbst geht.
»Ich werde seinen Namen nie vergessen.« Die junge Frau stand auf. »Sie tun so, als liefe ich den Männern hinterher. Das habe ich nicht nötig. Ich hatte schon die Möglichkeit zu heiraten. Und sogar Chefin zu werden. In einem Restaurant. Kein Lokal. Ein gutes Restaurant. Da hätte ich …«, sie schluckte, »etwas zu sagen. Und ich wäre erfolgreich. Wie alle von uns. Aber das will ich nicht. Ich werde ihn nicht ersetzen. Einfach ersetzen.«
»Wie Sie meinen.«
»Sie sind ...«, ich sah, dass sie Tränen unterdrückte und nach einem Ausdruck suchte, »nicht mein Niveau«, stieß sie schließlich hervor.
Ich nahm das gelassen hin. Aber eine Frage beschäftigte mich noch.
»Was hätten Sie getan, wenn sie herausgefunden hätten, dass er sie betrügt, ihr Freund Marek?«
Sie musste keinen Moment nachdenken. Stand auf.
»Ich hätte ihn umgebracht.«
1. Kapitel
Fünf Jahre später. Februar 2009
Ich hatte wirklich mal wieder alles falsch gemacht.
Meine Wohnung in der Karlsruher Südstadt hatte ich mit Triumph in den Augen gekündigt: Endlich frei von dem an meiner Tür baumelnden Hausordnung!-Schild, bei dem ich mich immer gefragt hatte, was mit Ordnung gemeint war. Hausordnung moralisch? Oder nur putztechnisch? Der auf dem Schild fröhlich eingezeichnete Besen sprach für letzteres, deshalb war ich lustlos einmal im Monat die Treppenstufen mit seinem Ebenbild heruntergeklappert.
Frei von dem Gefühl, das Loch am Spion meiner Vermieterin, die wie eine examinierte Concierge im Erdgeschoss lauerte und alles beobachtete, würde täglich größer. Vor allem beäugte sie jede Lebensäußerung meines kleinen Hundes Nessie mit scheelem Misstrauen und pflegte ostentativ mit einem feuchten Tuch hinter ihm herzuwischen.
Bekanntlich bin ich eine Freundin von Multikulti. Und vielleicht würde mir der zarte Knoblauchgeruch, der aus der türkischen Küche von Akzoys unter mir drang, der alltägliche Duft von Pizza, der von Sanzinis schräg neben mir hinüberwehte und jener von eingelegtem Kohl, mit dem meine rumänischen Nachbarn ihre nahrhaften Gerichte zubereiteten, fehlen.
Letztere hatten mich sogar einmal eingeladen, zu ihrem Gottesdienst mitzukommen, in die Lutherkirche, eine wunderbare, beinahe orientalisch wirkende Kirche in der Karlsruher Oststadt. Nachdem ich zwei Stunden unverständliche Liturgie über mich hatte ergehen lassen, fand ich mich neben einem orthodoxen Mönch wieder, mit dem ich mir weitgehend sprachlos Krautwickel und Fischstäbchen teilte. Und das um drei Uhr nachmittags, wo sogar kulinarische Freigeister wie ich eher an Kaffee und Kuchen denken.
Mein geplanter Umzug hatte einen überwiegend beruflichen Aspekt. Ich bin bekanntlich Ahnenforscherin, und meine Kunden aus den sogenannten besseren Kreisen konnte ich kaum in meine Wohnung einladen. Meist musste ich ein kompliziertes Netz von Erklärungen stricken, um zu begründen, warum man sich zum Erstgespräch in einem Café traf und nicht in meinem elegant und solide eingerichteten Ahnenforscherbüro irgendwo in Karlsruher 1B-Lage.
Doch eine Freifrau von Dreiwitz-Gnüchenow will nun mal leider nicht im Hausflur über verschrammte Dreirädchen stolpern, und sie will auch nicht der Nachbarin unter mir ausweichen, die – eine bekennende Satanistin – sie bleich, dürr und schwarzgekleidet angrinst, wobei sie ein silbernes Kügelchen in der Zunge blitzen lässt.
Zwar liebe ich das Bunte und Unbürgerliche, aber solche Szenen kommen bei zahlender Kundschaft bedauerlicherweise nicht gut an. Misstrauen sie aber meinem Ambiente, so misstrauen sie am Ende auch der Ahnentafel, die ich ihnen mit bescheidenem Lächeln zusammen mit der Rechnung überreiche. Und leider kann ich von all den nahrhaften Gerüchen alleine nicht leben.
Optimistisch begann ich also nach einer neuen Wohnung zu suchen.
Ich hatte dann dieses wunderbare Appartement in der Sophienstraße in begehrter Karlsruher Wohngegend in Aussicht. Die Tinte der Unterschrift des Vermieters auf dem Mietvertrag hatte ich schon beinahe riechen können, nur dass nämlicher Vertrag nach der mündlichen Zusage nicht kam.
Bis mir der Vermieter schließlich verlegen und hastig mitteilte: »Ich habe mich nun doch für einen jungen Arzt vom Klinikum entschieden. Verstehen Sie, das sind gute Kontakte, sagt meine Frau. Wenn mal was ist. Und er hat ein festes Einkommen. Sie sind ja nur freiberuflich. Das macht meiner Frau Kopfschmerzen. Ich persönlich hätte Sie ja vielleicht genommen. Wollte immer schon mal meiner Familiengeschichte nachspüren. Da käme bestimmt einiges Spannendes heraus, wie?«
»Oh, gewiss, Herr Schmidt«, hatte ich sehr höflich gesagt, »bei dem Namen.«
Und so ist es in Karlsruhe und wahrscheinlich überall anders auch: Die Vermieter wollen Verdienstbescheinigungen sehen. Schufa-Auskünfte einholen. Bankauszüge studieren.
Sie misstrauen dir eigenartigerweise genau von dem Moment an, in dem sie sich für dich entschieden haben. Vorher bist du ein Bewerber, ein Interessent und wirst höflich behandelt – danach wirst du zum potentiellen Mietnomaden.
So gelang es mir einfach nicht, eine Wohnung zu finden, die einen Hauch besser war als die, in der ich momentan lebte.
Meine Vermieterin hatte mir meine triumphierende Kündigung nicht verziehen und konnte meinen Auszug offenbar nicht abwarten: »Noch ein Monat, dann sind Sie ja draußen, Frau Mainhardt. Und dann wird mal gründlich geputzt und renoviert!«
Eigentlich lehne ich Grundbesitz in Privathand aus politischen und weltanschaulichen Gründen ab, aber ich sah keine Möglichkeit mehr, innerhalb der nächsten zehn Jahre auf legale Weise an eine Mietwohnung zu kommen. Aus dem Hausbesetzeralter bin ich raus, zumal Karlsruhe keine Stadt ist, in der leere Mietskasernen auf Leute warten, die die Stadtwerke anzapfen und auf Obstkisten sitzen.
Meine Bankberaterin, Frau Landshut, zuckte merklich zusammen, als ich ihr mitteilte, ich hätte nunmehr aus der Not heraus beschlossen, eine kleine Wohnung zu kaufen.
»Haben Sie in letzter Zeit einmal einen genaueren Blick auf Ihr Konto geworfen?«, fragte sie dann so taktvoll wie irgend möglich. Professionelle Freundlichkeit selbst gegenüber dem größten Pleitegeier lernen die in speziellen Kursen. Frau Landshut setzte ein unnatürliches Dauerlächeln auf und stellte das Telefon auf ihre Vorzimmerdame um.
»Ja, das habe ich. Aber meine Schwester gibt mir etwas Geld. Und ich löse meine Fonds auf, sollten die sich durch die Bankenpleiten nicht sowieso von selbst aufgelöst haben. Den Rest leihe ich mir dann von Ihnen. Okay?«
Frau Landshut füllte den Kreditantrag mit einem Gesicht aus, als habe sie mehrere frühreife Zitronen ausgelutscht. »Sie haben kein festes Einkommen, Frau Mainhardt. Der Chef fragt nach Sicherheiten.«
»Nichts ist sicher im Leben«, meinte ich achselzuckend. »Das muss man feinstofflich sehen. Esoterisch.«
Sie starrte mich an. Ich lächelte milde.
Ich hatte gelernt, dass es immer gut ankam, wenn man sagte: »Das muss man feinstofflich sehen.« Kein Mensch auf Erden weiß, was der Satz bedeutet, aber er hört sich an, als habe man mindestens zehn Semester Buddhismus studiert und befinde sich bereits auf einer höheren Bewusstseinsebene.
»Sagen Sie das dem Chef«, seufzte Frau Landshut immer noch taktvoll lächelnd. »Wir leben im Zeitalter der Finanzkrise.«
»Das ist nichts Neues für mich. Ich lebe schon seit vielen Jahren mit einer ganz privaten Finanzkrise. Man kann sie überstehen. Oder aussitzen. Oder einfach abwarten, bis man tot ist.«
»So etwas dürfen Sie nicht sagen. Nicht mal denken!«, erwiderte Frau Landshut streng, so als seien ihre Kunden grundsätzlich unsterblich.
Ich bekam schließlich meinen Kredit, weil meine armen alten Eltern für mich bürgten. Peinlich in meinem Alter. Ich sah ihnen und meiner Schwester regelrecht an, was sie dachten: Warum ist sie auch nicht verheiratet so wie alle anderen und hat zu Hause einen Mann, der mit warmer Stimme spricht: »Einen Kredit? Aber Schatz, hättest du doch was gesagt. Wieviel brauchst du? Da, kauf dir eine schöne kleine Wohnung.«
Ja, warum eigentlich nicht? Vermutlich hört sich der Gedanke an solch einen Allroundversorger für manche verlockend an. Für mich nicht. Mich würde die Abhängigkeit schrecken.
Solch ein Mann war eben nicht nur da, wenn es um einen Kredit ging, sondern immer. Auch am Sonntagmorgen, wenn der Single, in ein riesiges Kissen eingebettet, in Ruhe die Bunte lesen will, mit einer Lupe die Falten von Iris Berben studiert und dabei bis elf Uhr von einem spät eintreffenden Lebensglück träumt. Solch ein Mann ist auch montagmorgens da, wenn man am Vorabend spät ins Bett gekommen ist und aussieht wie eine gerade geborgene Wasserleiche. Und mittwochs, wenn man sich die Haare in jenem herrlichen Kastanienbraun färbt, das Männer für echt halten und mit dem man keine Frau täuscht und nach dessen Auftragen man das Badezimmer so gut wie renovieren muss.
Ich weiß nicht, was besser ist: Kontrolle und Geborgenheit? Freiheit und manchmal einsam sein? Vermutlich bin ich längst sicher im Betreuten Wohnen untergebracht, bis ich es herausgefunden habe.
Jetzt hatte ich meinen Kredit und konnte dafür keine Wohnung finden, die es wert war, gekauft zu werden. Entweder handelte es sich um Zellen, in denen man keinen Goldhamster, geschweige denn einen lebhaften kleinen Hund wie den meinen einsperren wollte, oder sie sahen zwar nach außen hin einigermaßen ordentlich aus, hatten aber riesige Hauskosten oder Renovierungsstaus, die jedem Normalverdiener den Angstschweiß auf die bleiche Stirn trieben.
Drei Worte brannten sich mir mit der Zeit ein: Fassade, Dach und Heizung. Vielleicht noch Fenster. Die Wohnung kann ein Traum sein, aber wenn diese Sachen nicht stimmen, kannst du das Objekt vergessen.
Die Makler selbst waren übrigens gar nicht so übel, wie man immer sagt.
Vom negativen Image ihres Berufsstandes gebrandmarkt, wollten sie weder Betrüger sein noch so wirken. Sie verzogen schmerzlich das Gesicht, wenn ich sie um 10 000 Euro herunterhandeln wollte, und malten düstere Bilder vom Elend des Verkäufers, der nur überleben könne, wenn ich seine Immobilie kaufte. »Er legt sowieso drauf, Frau Mainhardt, und wie! Unter uns... der Mann muss verkaufen.«
Irgendwann rückten aber die Handwerker in meiner Wohnung in der Südstadt an, und ich musste raus aus meiner Bleibe. Ein eindeutig therapierelevantes Erlebnis. Schnell alles packen, bei Freunden und Eltern zwischenlagern und telefonieren, wer dich und den Hund vorübergehend aufnimmt. Eine Skala von Ausreden ertragen und anhören.
Hund: Tierheim? Du: Frauenhaus? Ins Hotel? Aber mit dem Hund? Und von welchem Geld?
Schließlich endeten Nessie und ich bei einer Bekannten meiner rumänischen Freundin Raika.
Die Freundin hieß Nadia Rixinger und wohnte in der Nebeniusstraße in der Südstadt, also nicht weit von meinem bisherigen Zuhause, wenn auch im etwas feineren Teil unseres Viertels. Ihr Hausgang war frei von bunten Gerüchen und Geräuschen, es war ruhig, sauber, und die Hausordnung wurde von einer Firma erledigt.
»Nadia stammt ursprünglich aus Frankfurt«, berichtete Raika. »Ich kenne sie über einen Cousin, der in ihrer Nachbarwohnung gewohnt hat. Sie kam immer erst morgens heim, aus ihrer Kneipe, und die haben dann manchmal zusammen gefrühstückt. Und dann treffe ich sie doch eines Tages hier im Weiherfeld an der Alb, als ich mit Ana spazieren ging. Nach einigen Umwegen war sie in Karlsruhe gelandet. Sie bewohnte damals da in der Nähe ganz alleine ein kleines Haus mit verwunschenem Garten. Etwas zurückgesetzt von der Straße, ein reines Paradies. Der alte, verwirrte Mann, dem es gehörte, hatte in der unteren Wohnung gewohnt und war ins Krankenhaus gekommen. Zwei Jahre hat sie da gelebt und einiges auf eigene Kosten renoviert, den Garten verschönert, und dann kam, was ja für unsereins immer kommt: Der Alte hatte die Unverfrorenheit zu sterben und bald darauf wollten die Erben das Haus verkaufen. Nadia musste raus, und ich habe ihr geholfen, die Wohnung in der Nebeniusstraße zu finden. War nicht leicht. Du weiß ja – Karlsruhe und Wohnungen!«
Oh, wie gut ich das wusste.
»Sie ist Bedienung?«
»Mitnichten. Zumindest nicht mehr. Als Studentin und einige Zeit danach hat sie mal in einer Bar gearbeitet. Sie hat Gebrauchsgrafik studiert, aber ihre große Leidenschaft ist das Fotografieren. Schon in dem fiesen Abschleppschuppen, in dem sie gearbeitet hat, hat sie oft die Gestalten an der Theke porträtiert. Ihr Thema hieß »Nacht-Macht-Männer«. Das ist ein Titel, was? Den nummeriert sie für die Ausstellungen durch. Ist ihr Markenzeichen geworden, und dafür ist sie mehrfach ausgezeichnet worden. Doch mit solchen Aufnahmen kann man vielleicht Preise gewinnen, aber kein Geld verdienen.«
»Ja?«, fragte ich erfreut. Hörte sich nach einer Leidensgenossin an. Genial aber arm.
»Aber sie hat für sich eine Nische gefunden. Jetzt fotografiert sie Blumen. Und Bäume. Stimmungsvolle Gräser. Grünes Zeug. Für Glückwunschkarten auf gehobenem Niveau. Seit Neuestem auch für E-Cards.«
E-Cards! Das sind die Dinger, die man heutzutage anstelle von den guten alten Papierkärtchen kriegt. Statt des Postboten, der sich an deinem Geburtstag unter der Last der Karten biegt, meldet sich der Computer und spuckt von romantischer Musik untermalte Bilder aus, bei denen rote Luftballons, kleine Hunde, Schneeflocken oder Clowns auf Schaukeln über ein Kitschbild trudeln. Dazu irgendwo der Name des schnellen Absenders. Unverbindlich. Kostenlos verschickt, genauso schnell wieder gelöscht.
»Und davon kann man existieren?« Ich werde nie aufhören zu staunen, womit andere Leute mehr Geld verdienen als ich.
»Anscheinend. Es geht ihr nicht schlecht. Die Karten sind nicht so billige Dinger, wie du sie immer kaufst. In den Läden, in denen alles einen Euro kostet.«
»Bitte Raika! Wichtig ist, dass die Karte von Herzen kommt und warm ums Herz macht.«
»Bei deinen Karten ist man schon froh, dass der Kugelschreiber keine Löcher reingestanzt hat, so dünn sind die. Ihre sind ganz anders. Edel, Leinenoptik, mit Goldaufdruck. Teuer. Designerkarten. Sind schon toll, ihre Fotos. Gestochen scharf. Und irgendwie so plastisch, dass man die Blumen fast riechen kann. Rosen. Tulpen. Aber auch so exotische Blüten, die man nicht so oft sieht. Und sie kombiniert sie immer irgendwie anders. Mir hat sie mal ein Foto von einer Kaffeepflanze geschickt mit einem Feld voll Getreide. Das war eine Einladung zu Kaffee und Kuchen. Das Mehl, verstehst du? Für den Kuchen.«
»Hört sich an, als bräuchte man Abitur, um Frau Rixingers Kartengrüße verstehen zu können.«
»Jedenfalls hat sie schon etliche Preise für ihre Fotografien gewonnen. Ob ihr zwei klarkommt, weiß ich nicht – sie ist eine ziemlich geradlinige Person. Tough!«
Was sollte das jetzt wieder heißen? Warum sollte ich mit ihr nicht klarkommen? Was war ich in den Augen meiner Freundinnen? Eine entsprungene Diakonisse? Oder wie ein Vorschulkind contra erwachsene Erfolgsfrau?
Aber ehrlich gesagt: Tough bin ich wirklich nicht. Jemand, der zum fünfhundertsten Mal an Weihnachten heult, wenn Sissi ausgestrahlt wird, ist nicht tough. Vor allem, weil ich mich bei der Szene, in der Kaiser Franz Josef bei dem alles entscheidenden Ball mit dem Blumenbukett auf Sissi zugeht und nicht auf die fassungslos mit leeren Händen dastehende Schwester, immer mit der Loserin Nene identifiziere. Was mich aber tröstet, ist, dass die später noch zur Freigeistin avanciert und nach Preußen gezogen ist, wo die Luft moderner war als im Alpenraum des 19. Jahrhunderts. Ein Mann ist eben nicht alles im Leben, auch wenn er zufällig Kaiser ist.
Raika fuhr fort, mir ihre großzügige Bekannte zu beschreiben, die tatsächlich bereit war, einen Tramp wie mich aufzunehmen.
»Ihre Fotos sind schon mehrfach ausgestellt worden. Die Präsentation im ZKM damals mit den Kerlen in der Bar hat viel Aufsehen erregt. Und in der Deutschen Bank hat sie eine Serie mit Männern im Biergarten gezeigt. In München. Trostlose Gestalten. Du kennst den Maler Hopper?«
»Der mit den einsamen Leuten in den einsamen Bars?«, fragte ich. Raika nickte.
»Solche Motive hält sie als Fotos fest. Die niedlichen Blumenkarten sorgen fürs tägliche Brot und die Ausstellungen samt Verkauf für die Extras in ihrem Leben. Und Extras hat Nadia genug. Da kannst du von ihr lernen. Die kauft jedenfalls keine Slips bei Real im Zehnerpack wie du.«
»Vielleicht sieht auch jemand ihre Slips. Nessie ist es egal, was Frauchen anhat, wenn Frauchen nichts anhat.«
»Blöd. Dessous kauft man für sich und nicht für andere. Der Kartenverlag sitzt bei Baden-Baden. Erst hatte sie ihr Atelier und ihr Gewächshaus noch in München gehabt, aber dann wurde ihr die Pendelei zuviel, sie zog nach Karlsruhe, den Rest kennst du. Seither treffen wir uns ab und zu.«
»Ich denke, sie ist aus Frankfurt.«
»Denk doch sauber, Maren. Erst Frankfurt, dann München, dann Karlsruhe. Hier fühlt sie sich so wohl, dass sie nicht mehr weg will.«
Ich hatte überhaupt keine Lust, bei dieser Wunderfrau einzuziehen. Sie hörte sich an wie jemand, dem ich lieber aus dem Weg ging.
»Sie ist jedenfalls recht gut im Geschäft. Bei der Hochschule für Gestaltung hat sie so etwas wie einen Honorarvertrag, als künstlerische Beraterin für Grafikkunst. Ihr Gewächshaus hat sie jetzt auch zur Hand. Auf dem Balkon ihrer Wohnung. Da ist ausreichend Platz für ...«
»Wieso ihr Gewächshaus? Ich möchte nicht in einem Gewächshaus leben. Das ist sogar mir zu warm. Ich bin doch keine Schlange und auch kein Reptil.«
»Unsinn. Du kriegst ein Gästezimmer. Alles sehr elegant. Nadia ist höchst wählerisch mit ihrem Ambiente. Dieses kleine Gewächshaus braucht sie für die Blumen und Pflanzen, die sie fotografiert. Sie lichtet besonders gerne halb Verblühtes ab. Eignet sich für Trauerkarten. Außerdem Rosen und Schleierkraut für die Hochzeiten, Narzissen für Ostern und Olivenzweige fürs Ewige. Kakteen für witzige Karten. Da kann sie seltene Sorten züchten, kann sie alles arrangieren wie sie will. Muss nicht alles kaufen und macht sich so unabhängig vom Blumenhandel, sagt sie. Endlich eine Frau, die Marx verstanden hat. Selbst über Produktionsmittel verfügen. Ich sag doch, eine toughe Frau.«
»Stopp!« Ich sah Schreckliches auf mich zukommen. »Also, eine von diesen supervielseitigen perfekten Frauen, mit denen ich etwa so harmonisch zusammenlebe wie mit einem Skorpion, der wegen Aggressivität in therapeutischer Behandlung ist.«
»Witzig! Nadia ist kein Wunderwesen. Sie hat ihre Macken. Manchmal merkt man schon noch, dass sie früher in Frankfurt in einer Bar gearbeitet hat. Kann ziemlich direkt sein. Meinen neuen Freund würde ich ihr nicht unbedingt gleich vorstellen. Nur als Beispiel.«
Ich sagte jetzt nichts mehr dazu. Ich hatte keinen neuen und auch keinen alten Freund. Gereift hatte ich mich von dem Gedanken abgewandt, die Welt unbedingt als paarweises Vergnügen sehen zu müssen.
Stattdessen hatte ich versucht, mein Berufsleben aufzupeppen: Hatte Fortbildungskurse besucht, meinen Internetauftritt, ohne den man heute in gewissen Kreisen gar nicht wahrgenommen wird, perfektioniert und etliche neue Kunden gewonnen, indem ich Anzeigen in der Südpfalz geschaltet hatte sowie mich auf das Aufspüren deutsch-elsässischer Familienbäume spezialisiert hatte.
Aber diese Nadia? Ich wollte nicht bei jemandem wohnen, der Trauerkartenmotive arrangiert. Wer will schon dran erinnert werden, dass die ganze Sache hier auf Erden Anfang und Ende hat und dass wir den Anfang schon eine ganze Weile hinter uns haben?
Und die Empfehlung, dass Nadia im ZKM tätig war, verpuffte bei mir. Ich fühle mich nicht wohl dort. Unser Karlsruher Zentrum für Kunst und Medientechnologie, angeblich so bedeutend wie das Centre Pompidou in Paris, zieht diesen Typ Mensch an, der mich einschüchtert: Schwarzgekleidet mit Blazer und Flatterhose. Ernster Gesichtsausdruck. Hochdeutsch und politisch korrekt formulierend. Sloterdijk persönlich kennend. Hornbrille. Ein Lebenslauf, der aus Stationen bei Kunstprofessoren, die kein Mensch kennt, besteht.
»Sie hat eine große Wohnung. Lebt alleine. Das heißt nicht, dass sie alleine ist, aber Männer trifft sie am liebsten nur stundenweise. Vielleicht noch ein Relikt aus ihrer Zeit in der Bar. Und sie mixt supergute Cocktails. Also, das würde doch ganz gut passen.«
Matthias, mein biederer Freund aus der Zunft der Versicherungsvertreter, war sofort gegen Nadia.
»Eine Frau, die in dem Alter noch solo lebt, obwohl sie angeblich gut aussieht. Und das freiwillig. Mit der stimmt was nicht.«
Danke, Matthias. Und was war mit mir? Wie sah ich aus? Wie die Tante von Godzilla?
Er wiegte bedenklich den Kopf. »Das gefällt mir nicht, Maren. Auch wieder eine, die nicht ordentlich ihre acht Stunden arbeitet. Und bestimmt keine Lebensversicherung hat.«
Wenn Matthias einer Person misstraut, ergreife ich fast reflexhaft ihre Partei.
»Matthias! Nadia Rixinger ist Fotografin, aber nicht nur so eine, die Passfotos macht, sondern eine echte Künstlerin. Mit Studio. Und mit Vernissagen und Ausstellungen. Sogar in London in irgendeinem Museum für moderne Medienkunst hängt ein Foto von ihr. Männer in Bars. Fremde im Vertrauten. Und bei uns im ZKM gab es eine aufwändige Installation mit den Kneipenaufnahmen aus ihrer Frankfurter Zeit. So mit animierter Überblendtechnik. Die Cocktails haben sich virtuell immer neu gefüllt. Ihre Spezialität sind eben frustrierte Kerle in Kneipen und an anderen öffentlichen Orten, wo’s was zu trinken gibt. Sag was dagegen! Zumindest ein angenehmer Arbeitsplatz.«
Matthias überging die Bars.
»So etwas fotografiert kein normaler Mensch«, sagte er. »Depressive Leute am Tresen. Das ist abartig. Das will keiner sehen. Ich liebe schöne Landschaftsbilder. Die Berge. Mal ein See. Der Sonnenaufgang über Rüppurr. Gut, vielleicht auch einmal rotgefärbte Blätter im Herbst. So was schaut man doch gerne an. Das entspannt.«
Gut, dass Nadia nicht wusste, was für spießige Freunde ich hatte.
»So etwas nenne ich gute Kunst. Tiere sind auch noch in Ordnung. Schöne Tiere!«, ergänzte Matthias hochzufrieden mit sich selbst. Nessie öffnete ein Auge.
Ich dachte an Nadias Worte bei unserem ersten Treffen vor ein paar Tagen. Sie hatte mir Espresso serviert und Konfekt in Form von Rosenblüten. Daneben eine Schale Datteln.
»Warum die Bars?«, hatte ich sie auch gefragt. »Was reizt dich daran?«
»Weil eine Bar ein gesellschaftlicher Ausnahmeort ist. Dort geht scheinbar alles. Ist alles erlaubt. Du und der Tresen, der Mann dahinter. Man erzählt sich Dinge, die man sonst verschweigt. Jeder ist Geschäftsführer, keiner ein Loser. Die glitzernden Flaschen, die Spiegel. Die Leute einzeln sitzend neben dir. Dunkel. Nüsschen. Cocktails. Frauen«, erklärte sie mir eher knapp und gab mir beinahe abwesend einen Schlüssel für ihre Wohnung. »Maren, bleib solange du willst. Seit der letzte Mann endgültig wieder draußen ist, habe ich Platz. Und du weißt ja hoffentlich besser als der, dass man beim Arbeiten Ruhe braucht. Hier!«
»Danke!«
Ich bewunderte dabei ein Foto mit zwei Avocados im Gang. Nahaufnahme. Eine ganze Frucht und eine aufgeschnittene. Bei genauer Betrachtung hatte ich das Gefühl, die Früchte seien verschiedene weibliche Formen. Brüste oder die Rundungen von Pos. Obwohl man nichts weiter darauf sah als die ineinander geblendeten Formen eines eher unscheinbaren Gemüses, waren die Schemen in Nadias Interpretation hocherotisch. Das Ganze natürlich in matten Sepiafarben. Ein Künstler, der was auf sich hält, scheut normalerweise Knallfarben wie der Teufel das Weihwasser. Auch in der Fotografie. Von wegen bunte Berge, Matthias!
Ich ging weiter. Betrachtete die anderen Aufnahmen.
»Interessant, wie du die Welt siehst, Nadia. Manchmal ein wenig morbide, oder? Die Farben. Die müden Gesichter. Und hier auf dem Bild, diese halbverblühte Rose. Schreckt dich der Verfall nicht, Nadia?«
»Es ist nichts aufzuhalten, Maren. Keine Entwicklung. Kein Verlust. Kein Abschied. Wir verfallen jeden Tag. Sind alle die Leichen von morgen. Bei einer Rose geht es nur schneller«, hatte sie knapp erwidert. Zwar hatte sie Recht, aber ich mochte dem Gedanken nicht näher treten. Andere offenbar auch nicht. Ihr letzter fester Freund hatte sich seit längerem verabschiedet. Danach hatte sie eine längere zumindest beruflich fruchtbare erotische Beziehung zu einem Kunstmanager gepflegt, doch nachdem sie erfolgreich geworden war und er sie endgültig als Dauerexponat im ZKM und anderen modernen Museen platziert hatte, war er auf ihren Erfolg eifersüchtig geworden.
»Männer in der zweiten Reihe entschließen sich meistens dazu, das Theaterstück ganz zu verlassen anstatt zu warten, ob vorne etwas frei wird«, erklärte sie mir nonchalant. Es habe häufig Streit gegeben, und sie war schließlich alleine in der Vierzimmerwohnung geblieben.
Nadia war diszipliniert, geradlinig, ziemlich offen in ihren starken Gefühlen, und dabei mit ihrem herben Gesicht und den tiefliegenden dunklen Augen auf ihre Weise eine attraktive Frau. Etwa vierzig. Oder mehr oder weniger. Gute Figur, langes dunkelblondes Haar und drei Kleiderschränke voll geschmackvoller Klamotten. Bei der Barbiepuppenparade vor Heidi Klums Schreibtisch wäre sie zwar sicher durchgefallen – »Ich habe leider kein Foto für dich!« – aber ein Hingucker war sie zweifellos. Und kein Kind von Traurigkeit. Sie hatte immer ausreichend Champagner und luxuriöse Esswaren im Haus: »Von Verehrern. Für Verehrer. Warum nicht?« So konnten wir die ersten Abende miteinander überstehen. Manchmal merkte man ihr die Vergangenheit noch an. Im Unterschied zu mir, die ich auf Absätzen, die höher sind als zwei Zentimeter, schwanke, als sei ich betrunken, lief sie wie selbstverständlich mit hohen Schuhen in ihrer Küche hin und her. Klackklack. Nessie begegnete sie mit konsequenter Strenge, wodurch die sich sofort in Nadias Sklavin verwandelte und auf »Aus« sogar ihre Plastikkatze fallen ließ, was sie bei mir nie tat, sondern sie im Gegenteil provokativ weit wegtrug. Hoffentlich hatte ich nicht einen masochistischen Hund großgezogen.
Waren wir Freundinnen? Ich weiß es nicht. Respektvolle Nähe traf es eher.
Nadia hatte durchaus Humor und Esprit, aber wenig Wärme, und sie konnte gnadenlos sein, wenn es um ihre Kunst ging.
So schienen mir die von einem Verehrer überreichten Fresien im Wohnzimmer verblüht, und deshalb warf ich sie eines Tages in den Müll. Sie wurde nicht wütend, sondern eiskalt, was schlimmer war. »Maren, auch wenn es dir schwer fällt, das zu sehen: Alles kann ein Motiv sein. Auch diese sterbenden Fresien waren auf ihre Art schön.«
»Tut mir leid.«
»Ich hätte sie für eine vorbestellte Trauerkarte gebraucht. Konntest du nicht wissen. Jetzt gehe ich eben in den Oberwald und suche nach einem toten Baum.«
»Sorry, wirklich.«
»Verziehen. Kommst du mit?«
»Nein, ich habe noch zu tun, danke!«
Sie pflegte, so hatte sie mir berichtet, auf Motivsuche tief durchs Unterholz zu streifen. Das war nicht meine Sache. Ich werde gerne für unkonventionell und chaotisch gehalten, aber ich lebe diese Eigenschaften am liebsten in der Zivilisation aus. Für die Wildnis bin ich nicht gemacht. Ich liebe Wege, die an Cafés beginnen und bei einem schönen Kiosk enden.
Ich entschuldigte mich und beschloss stattdessen, mit doppelter Kraft nach einer neuen Wohnung für mich und meinen Hund zu suchen. Auf Dauer hatte ich keine Lust, armen Blumen beim Krepieren zuzusehen.
Gewöhnt, alleine zu wohnen, verlebte ich trotzdem anregende Abende mit ihr. Wir unterhielten uns nächtelang: Über Männer, keine Männer, Kinder und keine Kinder, über Kripokommissarin Elfie, die zu ihrem ungeduldigen Missbehagen noch immer nicht schwanger war, über ihre Kollegin Karina Ix, die sich leider selten sehen ließ, über Marie von Lingenberg, die programmgemäß schwanger war und zwar gleich passenderweise mit dynastisch gut verwertbaren Zwillingen.
Nadia erzählte, sie habe von klein auf etwas Besonderes sein wollen. »In manchen steckt das, in manchen nicht. Mittelmaß zu sein, der Gedanke war für mich immer unerträglich! Zu sterben, ohne einen Eindruck auf die Welt gemacht zu haben.« Ich sagte vorsichtigerweise nichts dazu. Mittelmaß oder nicht. Das ist etwas sehr Persönliches.
Raika hatte mir gesagt, dass Nadias Leidenschaft für ihre Fotos aus dem Milieu des Zwielichtigen auch daher rühre, dass sie mehrmals bei Schauspielschulen abgelehnt worden sei. Ursprünglich war es ihr dringlichster Wunsch gewesen, zur Bühne zu gehen. Das hatte nicht funktioniert, aber es kann im Leben ja auch nicht alles funktionieren, und wir haben schließlich alle unsere unerfüllten Träume!
»Wenn ich jetzt in den Bars sehe, wie die Blicke der Gäste an mir kleben, während ich sie fotografiere«, meinte sie nachdenklich, »denke ich, der Wunsch berühmt zu sein, beachtet zu werden, steckt in jedem, sogar in diesen miesen Figuren. Sie stehen am Tresen vor ihrem Getränk und freuen sich, dass sich jemand die Mühe macht, ihre rattenhaften Züge festzuhalten. Das gilt weltweit. Eigentlich dürften sie, wenn sie nicht gerade prominent sind oder Massenmörder, sogar die Veröffentlichung ihres Bildes in einer Ausstellung verweigern, aber das macht kaum einer.«
»Magst du diesen Job in den Bars?«
»Mögen? Du siehst in die absoluten Tiefen der menschlichen Existenz. Ich sitze meistens ganz vorne, am Tresen. Die Männer, meist sind es Männer, sehe ich von der Seite, die Mienen des Barkeepers kann ich genau studieren, wenn sie ihre Stories erzählen. Der Ausdruck der Kerle wechselt dabei von Stolz zu Trotz über zur Angst, dass sie zu viel preisgeben.«
»Sicher manchmal interessant zu beobachten.«
»Ja. Wie ein kleiner Angestellter mit einem oder zwei Cocktails plötzlich zum wichtigsten Mann der Firma wird, ist schon bizarr. Aber ich muss aufpassen. Wenn sie zu betrunken sind, bringt es nichts mehr. Den Übergang von nüchtern zu heiter, den muss ich erwischen. Später werden sie aggressiv oder dumpf. Viel mehr als zehn Minuten habe ich oft nicht. Dann muss ich nur wie ein Automat reagieren. Knipsen. Das Besondere am Gast schnell erfassen. Das dicke Goldkettchen, dazu schlechte Zähne. Die teure Uhr und die schäbigen Schuhe dazu. Die dicke Brille. Das schüttere Haar. Die Armseligkeit seines Triumphs, dass ihm jemand zuhört. Hässliche Hände. Der miese Versuch, den Alterungsprozess zu unterbrechen.«
»Und das bringst du alles mit deiner Kamera zustande?«
»Man muss schnell sein. Bevor sich die Stimmung verändert, bevor der erste Eindruck, den man selbst hat, verblasst. Und nichts mehr retuschieren. Nichts stellen. Das könnte ich gar nicht. Das wäre wie Lügen für mich.«
Ich erzählte ihr dann von meinen Träumen. Berufliche. Ein Buch schreiben über meine bizarrsten Ahnenforschungen und Aufträge. »Natürlich anonym«, betonte ich. »Ich bin diskret.«
Und über die privaten Träume. Das Wort Melchior mochte dabei mehr als einmal gefallen sein. Etwas, wofür sie wenig Verständnis hatte.
»Vergiss das Ganze. Streiche es. Vergessen können ist sowieso eine der wichtigsten Fähigkeiten, besonders für Frauen, die bekanntlich an erlittenen Kümmernissen gerne klammern wie an einer Felswand. Vergessen können wie dein kleiner Hund da. Sich schütteln und weitermachen. Hoffen und Harren macht Frauen bekanntlich zu Narren.«
»Leicht gesagt.«
Nadia nahm sich eine ihrer geliebten getrockneten Datteln. Verschrumpelte Dinger, die wenig appetitlich aussahen. Alterungsprozesse schienen sie zu reizen, aber natürlich nicht bei sich selbst, wie die vielen Cremetiegelchen in ihrem Bad bewiesen.
Ich fand kaum Platz für meine geliebte Penatencreme und meine Arganölflasche. Ich schwöre auf Arganöl für die Haut. Millionen bildschöner Algerierinnen können nicht seit Jahrtausenden irren.
Nadia lachte.
»Nachdem ich mit sechzehn Jahren drei Tage und drei Nächte wegen eines Kerls namens Georg durchgeheult hatte, wusste ich, dass ich das bestimmt nicht mehr wollte. Der Sinn unseres Lebens ist es definitiv nicht, wegen eines Mannes unglücklich zu sein. Er ist es nicht einmal, wegen eines Mannes glücklich zu sein. Er ist es im Idealfall, mit uns selbst glücklich zu sein, und wenn das auch nicht klappt, dann einfach jeden Tag so gut wie möglich genussvoll hinter uns zu bringen. Das geht am besten mit einer Sache, die deine Leidenschaft hervorruft. Die kann dich nicht betrügen und nicht weglaufen. Wenn du Leidenschaft ausstrahlst, ziehst du sowieso jede Menge Einfallslose an wie Motten das Licht. Und habe immer eine Saite Lachs, ein paar Weinbergschnecken, guten Champagner und die neue Vogue im Haus. Damit hältst du es ganz gut auch mit dir selbst aus.«
Es stimmte, dass sie Menschen anzog. Es riefen dauernd Leute an. Meist Männer. Nadia erklärte kühl, sie habe selbstverständlich Affären. »Das gehört dazu. Ich habe kein Keuschheitsgelübde abgelegt. Und es gibt keinen, dem ich treu sein müsste.«
Eine Affäre nach der anderen habe sie, nur sehr gelegentlich zwei gleichzeitig. Manche, die ihr beruflich nutzten: »Das machen die Männer seit Jahrtausenden.« Manche gefielen ihr sexuell, bei anderen wollte sie einfach nur wissen, wie sie ohne Kleider aussahen. »Natürlich frage ich manchmal, ob ich sie fotografieren darf. Die ganz Jungen stimmen gleich zu und die ganz Alten auch. Problematisch sind nur die dazwischen.«
Eine Erfahrung, die ich bestätigen konnte.
Ich zähmte mein Chaos in Haushalt und Alltag, sie dafür ihren Hang zum Perfektionismus, und so lief mit uns alles ganz gut.
Bis sie an einem Sonntagmorgen ins Europabad zum Schwimmen ging, ich alleine in der Wohnung blieb und wieder ein Mord seine hässliche Hand nach mir ausstreckte.
2. Kapitel
Wie immer begann es ganz harmlos und zufällig. Mit Kopfschmerzen. Es war Ende Januar, eiskalt draußen, und das mögen meine zarten Ohren nicht. Sie leiten die Kälte ins Innere weiter, und ich bekomme Kopfweh.
Da hilft nur eine baldige Tablette, und da ich mich quasi im Exil befand, stöberte ich in meinem Kosmetikköfferchen nach intensivem Suchen zwar endlich den lange vermissten auberginefarbenen Lippenstift sowie fünf Euro auf, aber keine Tabletten. Der Lippenstift hatte sich übrigens von seiner Kappe befreit und das gesamte Innere meines Köfferchens in ein topmodisches Aubergine getaucht. Beim Saubermachen zerriss der Geldschein in drei handliche lila Teile.
Jetzt hatte ich noch stärkere Kopfschmerzen. Es hämmerte wie auf einer Großbaustelle.
Man macht das eigentlich nicht: Man stöbert nicht in anderer Leute Sachen herum, wenn sie nicht da sind und man selbst dort den Status des Gastes einnimmt. Andererseits brauchte ich jetzt wirklich eine Kopfschmerztablette und fand keine an den üblichen Orten wie im Badezimmer oder in der Küchenschublade. Zu dem Hämmern gesellte sich jetzt noch Übelkeit. Das ließ mich den Anstand des Gastes vergessen. Ich ging in Nadias Arbeitszimmer und öffnete die oberste Schublade ihrer Weichholzkommode, aus der ich sie einmal eine Packung Taschentücher hatte herausnehmen sehen. Könnte also rein theoretisch auch die Vorratshaltung für Aspirin sein.
Ich fand kein Aspirin, dafür alte Ansichtskarten von Venedig und von München, einen abgelaufenen Führerschein (sie hatte sich kaum verändert, beneidenswert), eine Reihe Fotos von Burgen und Schlössern, von Ruinen, aber auch Szenen aus Theaterstücken, zwei oder drei Blumenstudien, Kritiken von Ausstellungen im März 2004, einen ganzen Packen Zeitungsausschnitte, die mit einem Gummi zusammengehalten waren.
Eigentlich suchte ich Aspirin, doch jetzt war meine natürliche Neugier geweckt. Eine Ahnenforscherin und eine Schublade voller Fotos und Dokumente verbindet eine tiefe, manchmal illegale Leidenschaft miteinander.
Ich sah, dass sie auch von 2004 waren, allerdings vom April und Mai. Darunter lag ein unscheinbarer Umschlag mit Fotos, die lose darin lagen, so dass einige herausfielen, als ich ihn zur Seite schob.
Es waren keine Fotos in Schwarzweiß oder Sepia, wie Nadia sie heute gerne machte, sondern Studien in ganz grellen Farben, fast wie in altem Technicolor. Interessante Motive. Die grellen Farben wirkten nicht heiter, sondern grotesk. Sie passten irgendwie nicht in unser Leben. Sie wirkten auf eine nicht näher definierbare Weise bedrohlich.
Von Rissen durchzogene Hauswände, an denen Efeu hochkletterte, und davor ein alter Mann. Fensterrahmen, von denen der Putz abblätterte, dahinter sich spiegelnd ein Junge. Ihrem Motiv Männer war sie also meist treu geblieben. Ein Stück Salamiwurst, das sich an den Enden rollte, ein Metzger, der es genüsslich betrachtete. Unglaublich. Könnte ich fotografieren, so würde ich persönlich schönere Sachen ins Visier nehmen. Es mussten ja nicht gleich Matthias’ nette Bergwelten sein.
»Der Verfall«, murmelte ich. »Es ist die Vergänglichkeit der Dinge und der Menschen, die sie interessiert. Für ihre Grußkarten vielleicht doch schwer verkäuflich, aber ansonsten sehr künstlerisch.«Nessie, die mir gefolgt war, gab durch eine Art Piepslaut kund, dass sie nicht am Verfall, sondern an ihrem Mittagessen interessiert sei.
»Gleich«, murmelte ich. Blätterte die Bilder durch. Besonders interessant fand ich die Darstellung eines Männerschuhs neben einer schwarzgelben Banane, die ziemlich hässlich aussah. Es war ein länglicher Schuh, vielleicht aus der Elviszeit, und in ihm steckte ein unsportlicher Männerfuß mit weißen Socken, die sich nach unten ringelten. Irgendwie erinnerte er mich ans Theater. An ein kleines Vororttheater, das sich keine neuen Schuhe mehr leisten kann.
Ich verfüge leider über wenig visuelles Talent. Schon gar nicht zum Fotografieren. Die Leute, die von mir zum Ansehen meiner Werke gezwungen werden, fangen meistens nach drei Bildern zu gähnen an.
Doch Nadia besaß offenbar das magische Auge. Das musste der Kurpark in Baden-Baden sein. Ich erkannte die Fassade des Brenner’s, die sich filigran andeutete, aber ganz nach vorne geholt hatte sie zwei Balkone. Auf dem einen stand ein ziemlich feist wirkender Araber, der eine Zigarre rauchte. Wie das Licht durch die Blätter brach und sich in der Oos widerspiegelte. Und da, wie der Hutrand des alten Herrn im Café seine Torte exakt in zwei Hälften tauchte, eine sonnige und eine schattige. Natürlich waren sie auch vom Verfall bedroht, der Kuchen und der Mann. Eine Wespe, die irgendwie vergrößert wirkte, saß auf der Torte. Man glaubte, das Mahlen ihres Kiefers zu hören. Wenn Wespen überhaupt Kiefer besaßen. Eine Wespe zu fotografieren, stellte ich mir sehr schwer vor. Ich persönlich würde nicht lange genug in ihrer unmittelbaren Nähe bleiben, um auf den Auslöser zu drücken.
Hier der Karlsruher Marktplatz … hatte sie beim Knipsen flach auf dem Boden gelegen? Nur Beine und die Blumenkübel auf dem täglichen Blumenmarkt. Eine Birne war unter einen Wagen gerollt, ein Marktverkäufer bückte sich missmutig nach ihr und verlor dabei sein verkaufsförderndes Lächeln. Dann eine Bar. Eine Frau, deren Brille grausam blitzte, und ein Mann mit zigeunerhaft glatt nach hinten gekämmtem lackschwarzem Haar saßen an der Theke. Vor sich Cognac. Wie Fotos so deutlich die Banalität unseres Lebens ausdrücken konnten.
Ein weiterer kleiner Umschlag. Mit ganz dünner Bleistiftschrift stand »23.4.2004« darauf. Die Schrift war so verblasst, als sei sie schon einmal ausradiert worden. Ich lugte hinein.
Wieder ein Foto mit viel Grün. Büsche. Blätter. Gras.
Das war aber nicht Baden-Baden, so wie es aussah. Etwas wilder, mehr Büsche, mehr Unterholz. Eine kleine Stechpalme, etwas weich gezeichnet und verschwommen im Hintergrund. Ein schmaler Weg nur angedeutet. Sonne, die tief ins Blätterwerk eindrang. Eine schöne Szenerie.
Ich kniff die Augen zusammen. Wunderbar, wie sie das Efeu erfasst hatte, die unterschiedlichen Grüntöne, das warme Braun der Erde. Der Weg und die Bäume schienen zu einer Natureinheit zu verschwimmen.
Vielleicht hätte ich den Volkshochschulkurs »Besser sehen, toll zeichnen können« von Marlis Moser-Streich doch nicht nach einer Stunde schon aufgeben sollen. Zwischen dem Efeu lugten weiße Blüten hervor, die sie mit dem Zoom etwas näher herangeholt hatte. Weiß ist sehr schwer zu malen, hatte ich bei Moser-Streich erfahren. Geht nur durch gezieltes Weglassen. Auch bei Fotos, soviel hatte mir Nadia gnädigerweise mitgeteilt, sei Weiß eine problematische Farbe, da sie polarisiere. Den Grund dafür hatte sie mir nicht mitgeteilt.
Auf dem Bild schien es Frühjahr zu sein. Die weißen Blüten sahen wie eine Art Maiglöckchen oder Maikraut aus.
Sie waren aber nicht alle weiß. Erst sah ich es nur bei einer, dann bei mehreren. Sie hatten rote, unregelmäßige Tupfer. Tropfenförmig. Eigenartig. Ich kannte solche Blumen nicht. Es sah merkwürdig aus. Wie umgekehrte Fliegenpilze. Beinahe unheimlich.
Ich griff nach der kleinen ausklappbaren Lupe, die ich immer bei mir habe. Typisch Ahnenforscherin. Keine nützlichen Tabletten zur Hand, aber eine Lupe in der Tasche!
Die Sprengsel auf den weißen Blättern lösten sich unter dem Blick der Lupe in verschiedene Farbschichten auf, dunkelrot und mehr ins Bräunliche schimmernd. Was waren das für Blumen?
Doch dann stutzte ich. Am linken Bildrand, fast ganz versteckt unter den weißen Blüten, da lag etwas Eigenartiges … etwas Fremdes. Ich kniff die Augen zusammen und hielt die Lupe in verschiedenen Positionen vor das Bild, bis die Konturen deutlicher wurden und ich mir sicher war. Das war eine Hand. Ziemlich lange Fingernägel. Eine Frauenhand also? Nein, die Nägel waren zu naturbelassen für die einer Frau. Wahrscheinlich also doch eine Männerhand, denn sie war ziemlich kräftig. Halbgeöffnet. Zwischen ihren Fingern schimmerte ebenfalls etwas von roter Farbe wie auf den Blättern. Eine solche leblose Hand alleine sieht merkwürdig aus. Gespenstisch. Ihre Finger schienen zu verzweifelt gekrümmten Klauen verkrampft.
Ich sah in den kleinen Umschlag. Da war noch ein zweites Foto. Ich holte es heraus. Meine Augen glitten darüber. Wie als ahnte ich, was mich erwartete, konzentrierte ich mich zuerst auf die Hand. Da war sie wieder, doch diesmal war sie nicht am Bildrand abgeschnitten … Den Arm hoch, der unter den Blättern – oder waren es deren Schatten – verborgen lag. Zum Körper. Zu einer zweiten Hand, die sich um eine Stelle an der Brust krampfte. Zwischen den Fingern etwas von der roten Flüssigkeit. Weiter. Zum Gesicht, das auf einem Bett von brauner Erde lag. Kräftige Züge. Ein auffallender Schnauzbart wie eine Robbe. Offenstehende Augen in einem eigenartigen Blau. Darunter kranke Schatten. Die Augen starr. Der Mund offen. Sehr deutlich. Das ganze Bild erinnerte mich an Museumsbesuche am Sonntagmorgen. Die alten Holländer hatten auch manchmal so lebensecht gemalt, dass man den Eindruck hatte, diese Herren mit den gefältelten Kragen würden gleich aus ihren holzgeschnitzten Bilderrahmen heraus zu sprechen beginnen. Ich sah das erste Bild wieder an. Diese Blüten. Sie schienen zu leben. Doch die Gestalt auf dem zweiten Bild da war tot.
Hätte ich die roten Punkte und Spritzer auf dem Blütenbild nicht gesehen, so wäre mir der Anblick der Hand zunächst vielleicht ganz entgangen. Ich hätte das Foto kopfschüttelnd zurückgelegt und vergessen. Und damit das ganze grässliche Szenario, das sich auf der zweiten Aufnahme entfaltete.
Seltsam, dass mich die Hand auf dem ersten Bild fast mehr abstieß als der zweifellos tote Mann auf dem zweiten.
Ich erinnerte mich an die Hand meiner Großmutter, als diese im Sterben lag. Sie hatte eine ganz ähnliche Geste mit ihren Fingern gemacht. Sie krallenartig noch einmal geschlossen und geöffnet. Als habe sie sich mit den letzten Schlägen ihres Herzens bewegt. Manchmal hatten wir geglaubt, sie sei bereits tot. Bis sich dann ihrer Brust ein mühsames lautes Schnarchen entrang.
Mein Blick wanderte zurück zu den weiß-roten Blüten auf dem ersten Bild.
Diese Flecken waren Blut, das war eindeutig. Wie ein roter Regen musste das Blut über die weißen Blätter getropft sein. Herausgekommen war dieses Blut aus der reglosen Gestalt da auf der Erde, welche das zweite Foto so schonungslos zeigte. Halb verborgen von Buschwerk zwar, aber doch deutlich.
Ich hatte leider in den letzten Jahren genug Blut gesehen, wo es nicht hingehörte, und ich war mir sicher: Bei dem Mann im Gebüsch konnte es keinen Zweifel geben. Da lag ein Toter in seinem Blut. Diese Bilder waren nicht nur bizarr. Sie strahlten selbst als Fotos noch etwas Gewalttätiges aus. Die Erinnerung an einschlägige Filme kam in mir hoch. An Irre, die ihre Morde dokumentieren. Hatte Nadia einen Menschen umgebracht und dann für ihre Serie »Männer« fotografiert? Warum auch immer. Vielleicht war sie verrückt. Hatte noch einen Toten für ihre Bildersammlung gebraucht. Verrückte wirken bekanntlich oft ganz normal. Sie verbergen ihren Fanatismus unter der Maske von Normalität und Disziplin.
Mit weichen Knien ließ ich mich auf die Couch in ihrem Zimmer fallen, die beiden Bilder noch immer in meiner Hand. Registrierte Einzelheiten wie einen Kaffeefleck auf dem Boden. Nessie war mir gefolgt und betrachtete mich argwöhnisch.