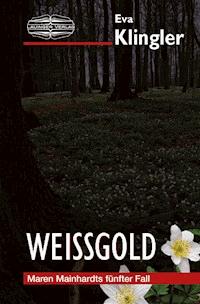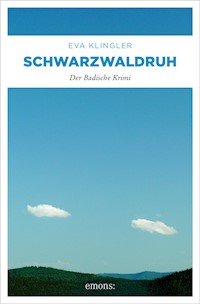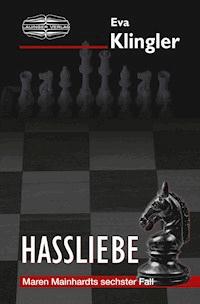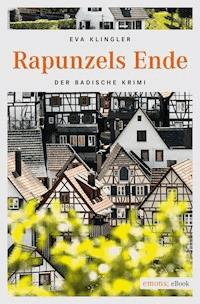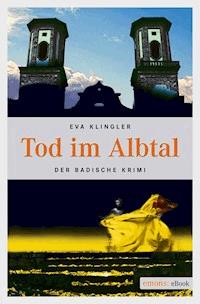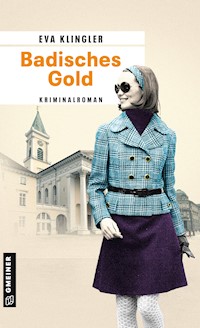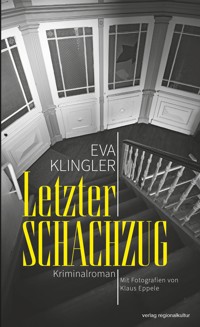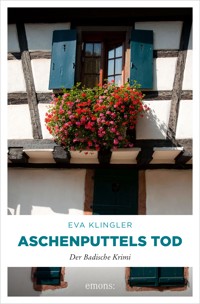Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Maren Mainhardt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Fiesling trug die Uhr und jetzt den Schatten. Er trägt die Botschaft. Nach dem tragischen Tod ihres Freundes bricht Maren alle Zelte im Elsass ab und quartiert sich bei einer guten Freundin in Karlsruhe ein. In der Wohnung der wohlhabenden Felicitas hängt ein echtes Gemälde von Abraham Teniers, dem Bruder von David Teniers, einem berühmten niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts. Krank ans Bett gefesselt, starrt sie auf das Meisterwerk und entdeckt darauf, was dort gewiss nicht hingehört: der Schatten einer Armbanduhr. Von der Neugier getrieben, stürzt sie sich in dieses neue Projekt und versucht dem Rätsel des Bildes auf die Spur zu kommen. Und die führt über das Paris der 20er-Jahre zu einem uralten Verbrechen ... Band 7 der erfolgreichen Maren-Mainhardt-Reihe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Endlich hatte Maren ihr großes Glück gefunden: Gemeinsam mit ihrem Partner Oliver hatte sie sich ein Häuschen in Sélestat gekauft und mit Beinahe-Stieftochter Kelly und Hund Nessie ein friedliches Leben begonnen. Eines fernab der Verbrechen, menschlichen Tragödien und Lügen, die sie in ihrer Zeit als Ahnenforscherin so manches Mal in lebensgefährliche Situationen manövriert hatten.
Doch auf einen Schlag wurde ihr alles genommen – mit dem Verlust Olivers durch einen schweren Unfall hat sie nicht nur ihren Partner verloren, sondern auch ihre Zukunft und damit das Gefühl angekommen zu sein.
Der Rückkehr nach Karlsruhe folgt eine schwere Grippe. Glücklicherweise kann sie bei ihrer Freundin Felicitas unterkommen, die sie liebevoll pflegt. Doch das Gemälde neben Marens Bett ist ihr nicht nur optisch ein Dorn im Auge. Ist das Bild nachträglich manipuliert worden?
Ihr alter Spürsinn ist geweckt und so begibt sich Maren auf Spurensuche, die sie tief in Felicitas‘ Familiengeschichte eintauchen lässt. Welches Geheimnis birgt der Fiesling mit dem Schatten am Handgelenk?
Die Autorin
Eva Klingler arbeitete als Lehrerin sowie Journalistin (u.a. beim Südwestfunk) und ist seit langer Zeit als Autorin tätig. Die meisten ihrer über 30 Veröffentlichungen beschäftigen sich mit badischer Geschichte, mit dem Lebensgefühl und der Kultur unseres Landes. So etwa der Titel »Frauen wie wir« oder die Krimireihe um Maren Mainhardt: Nach »Erbsünde« (Bd. 1), »Blutrache« (Bd. 2), »Kreuzwege« (Bd. 3), »Blaublut« (Bd. 4), »Weissgold« (Bd. 5) und »Hassliebe« (Bd. 6) liefert die Autorin ihren Fans nun den lang ersehnten 7. Band der Reihe. Eva Klingler ist in Mannheim aufgewachsen, lebte lange in Baden-Baden und nun seit 14 Jahren mit Ehemann, Hund und Katze in Karlsruhe.
www.evaklinglerkrimis.de
Anmerkung der Autorin:
Handlung und Personen in dieser Geschichte sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit real existierenden oder auch bereits verstorbenen Personen sind daher rein zufällig.
Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 1. Auflage 2017 Lauinger Verlag | Der Kleine Buch Verlag, Karlsruhe
Projektmanagement & Lektorat: Julia Barisic
Korrektorat & Satz: Beatrice Hildebrand
Umschlaggestaltung: Sonia Lauinger
Umschlagabbildung:
Frau: Muna Nazak | Trevillion Images
Mauer Rückseite: Designed by Freepik.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
ISBN: 978-3-7650-2145-9
Dieser Titel ist auch als Printausgabe erschienen:
ISBN: 978-3-7650-8815-5
www.lauinger-verlag.de
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Prolog
In Deutschland gibt es mehr als 6000 Museen, darunter etwa 660 Kunstmuseen. Laut neueren Forschungen betrachtet ein Museumsbesucher ein einzelnes Objekt im Durchschnitt elf Sekunden lang. Bedenkt man dies, war es ungewöhnlich, dass ich mir das Bild neben meinem Bett deutlich länger ansah. So lange, bis in ihm nach und nach eine alte Schuld sichtbar wurde.
*******
Erst hatte sie nicht mitgehen wollen. Es war schon Herbst, und die Tage wurden empfindlich kühl. Doch es tat ihr gut, sich wieder unbeschwert in der Natur zu bewegen. Den Körper anzustrengen, so wie früher, um sich lebendig zu fühlen. Nicht nur rennen, um der allgegenwärtigen Angst zu entfliehen oder sich in einem Kellerloch zu verstecken.
Dieser Ausflug war, so betrachtet, ein kleiner Luxus.
Den Sport hatte sie vermisst in all den dürren und schrecklichen Jahren, die hinter ihr lagen. Sie war aber noch nicht so stark wie früher.
Ich muss mehr essen, dachte sie. Wenn sich alles beruhigt, werde ich auch überlegen, wie es mit ihr weitergehen soll. Jetzt war sie freundlich. Weil sie Angst hatte. Jetzt hatte sie tausend Erklärungen. Es sei ihr Mann gewesen, nicht sie. Nun, das konnte man glauben, musste man aber nicht. Doch Rache war das Privileg Gottes oder der Vorsehung.
Sie könnte Gnade walten lassen.
Weiter ging sie auf ihrem Weg. Kleine Steinchen knirschten unter ihren Schuhen. In dem Moment spürte sie hinter sich eine Bewegung. Drehte sich um. Sah in ein vertrautes Augenpaar, in dem sie Mordlust und Entschlossenheit wahrnahm. Und sie wusste, dass sie nun sterben würde.
Eigentlich hätte ich es mir denken können, dachte sie, kurz bevor der Schmerz ihren Körper zerriss.
*******
Er würde sich das Leben nehmen, denn mit der Schuld konnte er nicht mehr länger leben. Und diese Schuld war viel größer, als er gedacht hatte. Er war sowieso nicht mehr jung, es blieb ihm nicht mehr viel Zeit.
Sie hatten alles beschmutzt, hatten mit dem Bösen einen Pakt geschlossen, und der hatte sich jetzt, viele Jahre später, gerächt.
Er würde sich vergiften und hoffte, es würde schnell gehen. Da er allein lebte und allein war, würde ihn niemand finden, um zu retten, was nicht mehr zu retten war.
Schon seit Langem hatte er das Mittel zu Hause. Es würde nicht schön sein, aber auch nicht blutig und unappetitlich. Er hatte immer Wert auf Ästhetik gelegt. Deshalb hatte er sie ja auch so geliebt. Wegen ihrer Grazie und ihrer Schönheit.
Der Becher stand bereit.
Dann klingelte es an der Wohnungstür. Lohnte es sich noch aufzumachen?
Leise schlich er zum Spion und lugte hinaus. Diese Person schon wieder. Was wollte sie hier? Sie war doch an allem schuld. Ohne ihre Schnüffeleien wäre die Sache niemals herausgekommen.
Er atmete leise.
Sie sollte verschwinden. Doch die Gestalt ging nicht weg. Wie durch ein schwankendes Brennglas wurde ihr verzerrtes Gesicht größer und kleiner, je nachdem, wie nahe sie der Tür kam.
Sie klingelte noch einmal.
Er machte auf. Nur einen Spalt, doch wie stets kam die Person unaufgefordert herein. Und dann sprach diese Frau und sprach immer weiter. Verkündete Ungeheuerliches. Kaum verstand er, was sie da sagte. In der Küche stand doch schon der Becher mit den vielen aufgelösten Schlaftabletten. Alles war bereit. Diese neugierige Person störte ihn bei dem, was er vorhatte.
Dann holte sie ein Foto heraus und …
… nichts mehr war wie zuvor. Er ging in die Küche, mit Tränen in den Augen, und goss den Becher mit der milchigen Flüssigkeit aus.
Es gab nun einen Grund zum Leben.
eins
Ich war krank. Ich war krank und fühlte mich einfach nur elend. Die grau-blonde Ärztin, die mir meine langjährige Freundin Felicitas Mänzer vermittelt hatte, meinte lakonisch: »Frau Mainhardt, es ist Ihre Psyche, die Sie nicht auf die Füße kommen lässt.«
Nicht gerade eine bahnbrechende medizinische Erkenntnis. Ich habe schließlich meinen Freund verloren – meinen Gefährten, meinen Geliebten. Und mit ihm meine Zukunft.
Oliver. In Irland geboren und Halbbruder meiner einstigen großen Liebe, Kriminalkommissar Melchior Oberst. Ja, genau der, der damals überraschend meine Freundin und Kollegin Elfie geheiratet hatte und nicht mich. Nachdem ich die beiden eine Weile lang gehasst hatte, waren wir uns zum Schluss wieder nähergekommen … Letztendlich war das schmucke Pärchen nach Konstanz gezogen, wo es Verbrecher rund um den Bodensee jagte.
Natürlich hatten wir uns nach der Katastrophe um Oliver, die auch Melchior zugesetzt hatte, öfters gesehen. Am Anfang hatten wir täglich telefoniert, doch nun war der Alltag eingekehrt, in dem mein Geliebter nur noch als Erinnerung in unseren gelegentlichen Gesprächen weiterlebte.
Manchmal schickten die beiden mir eine SMS, die sie hübsch mit einem Smiley garnierten: Hoffen, es geht dir einigermaßen. Kopf hoch. Auch wir denken oft an ihn. Melchior und Elfie.
Oh, Oliver. Liebevoller Vater von Kelly, meiner Beinahe-Stieftochter. Oliver, der manchmal schwermütig, meistens aber lustig gewesen war und fast immer sexy. Ja, das auch, und ich hatte es wirklich genossen.
Nach einer Reihe von traurigen und manchmal peinlichen Fehlversuchen war Oliver der erste Mann gewesen, mit dem es noch einmal hätte klappen können. Wer nämlich gemeinsam einen Fachwerkhauswinter im nasskalten Kleinstädtchen Sélestat, einem eher industriell geprägten Ort kurz vor Colmar im südlichen Elsass, überstand, der musste sich schon was zu sagen haben!
Doch jetzt herrschte Stille zwischen uns. Für immer. Und nicht, weil wir es wollten.
Auf der Autobahn zwischen Calais und Lille hatte unser Schicksal zugeschlagen. Zwei Lkw waren beteiligt gewesen. Es wird mir niemals gelingen, die schrecklichen Einzelheiten zu vergessen.
Mein kleiner Hund Nessie lebte mittlerweile auch nicht mehr, doch er war einfach nur alt und schwach gewesen, und hatte sich still nach dem Tierhimmel gesehnt, allerdings in der Hoffnung, dass dort Hunde und Katzen getrennt untergebracht wären.
Auch um diesen treuesten aller Freunde hatte ich geweint. Ich fühlte mich verloren.
Geblieben war mir nun die kecke Kelly, die sich doch tatsächlich lange Zeit geweigert hatte, mich zu verlassen. Ihre Mutter Geraldine war Olivers erste Frau gewesen und lebte in London. Ich hatte einiges an Überredungskünsten auffahren müssen, um Kelly davon zu überzeugen, zu ihrer Mutter zu ziehen. Die beiden hassten sich zur Zeit alters- und entwicklungsgerecht. Das würde vorübergehen. Eines Tages würde Kelly heiraten und am Tisch der Eltern würde Geraldine und nicht ich sitzen. Dann würde ich vielleicht vergessen sein.
Die Kelly von heute steckte auf jeden Fall in den Ausläufern einer stürmischen Pubertät und war gerade dabei, ihren persönlichen Dresscode zu entschlüsseln. Zeuge davon konnte man auf Instagram werden, wo sie täglich Fotos von sich und ihren schrillen Outfits postete. So wusste ich zumindest, dass sie sich kürzlich in London lila Stiefeletten mit rosa Rüschchen und einem goldenen Reißverschluss an der Hacke gekauft hatte; etwas das ihr Vater ihr niemals erlaubt hätte. Oder vielleicht doch?
Sie drohte immer wieder mit liebevoll quieksender und sich manchmal vor Aufregung überschlagender Stimme an, mich zu besuchen, bald schon, und das würde bestimmt teuer. Na wenn schon. An dem früher für mich so typischen Geldmangel litt ich nicht mehr. Als habe er etwas geahnt, hatte mir Oliver nämlich seinerzeit das Haus in Frankreich überschrieben – sollte ihm etwas zustoßen. Auch einen Teil seines Vermögens hatte er mir testamentarisch hinterlassen. Die größere Summe fiel an sein Kind, und das war gut so. Kelly würde auch mich vielleicht einst beerben und neben Geld so schrullige Hinterlassenschaften bekommen wie etwa meine Sammlung unterschiedlicher Weingläser, die sie immer bestaunt hatte. Ich erinnerte mich an einen Spruch, den ich irgendwo gelesen hatte: Die Dinge, die etwas bedeuten, gibt man jemandem, zu dem sie sprechen.
Als ich solch grauen Gedanken auf meinem fiebrigen Krankenlager nachhing, wusste ich nicht, wie nahe ich damit der Lösung eines Rätsels gekommen war, das direkt neben mir an der Wand hing.
*******
Meine Gastgeberin Felicitas stammte aus einer wohlhabenden und kultivierten Familie. Davon zeugten die Fotos von gut gekleideten Menschen, die mit ernster Miene aus schweren, wertvollen Rahmen heraus auf die Nachwelt blickten.
»Die Mänzers waren einmal wohlhabend, haben aber durch die Kriege natürlich viel, eigentlich fast alles verloren. Und die meisten sind auch früh gestorben!«
Felicitas wies auf schwarze Mäntel und blasse Gesichter auf den Fotos. Bei deren Anblick legte sich erneut Traurigkeit über mein Gemüt, als habe ich einen grauen Hut aufgesetzt. Wie würde meine Zukunft aussehen? Einer wie Oliver würde nicht noch einmal in mein Leben stürmen, um mit seiner irischen Leidenschaft alles durcheinanderzuwirbeln. Ich würde ohne die Liebe eines Mannes alt werden – und das war vielleicht gut so. Zu viele Enttäuschungen pflasterten meinen bisherigen Lebensweg. Zuletzt Melchior Oberst und sein Verrat an unseren Gefühlen. Dann Oliver, das Haus in Sélestat, Kelly und endlich das Gefühl, angekommen zu sein. Keine Verbrechen, keine menschlichen Tragödien und keine Lügen mehr, die mich zum Schluss so fassungslos hinterlassen hatten. Und nun, ohne Vorwarnung, Olivers früher Verlust. Endlich verstand ich den bitteren Spruch mancher Hinterbliebener auf den Todesanzeigen: Und wir hatten noch so viel vor! Ja, auch wir hatten noch so viel vorgehabt.
Seltsamerweise schlug diese nicht enden wollende Grippe nicht direkt nach Olivers Tod zu. Krank wurde ich erst, nachdem ich mir in Karlsruhe mit Hilfe alter Freunde wieder eine kleine Wohnung gesucht und eingerichtet hatte. Zu meiner eigenen Verwunderung hatte es mich dabei nicht in die Südstadt gezogen, mit der mich einst so viel verbunden hatte. Fast trotzig hatte ich mich im Westen Karlsruhes niedergelassen, in der Gartenstraße, und dort ganz in der Nähe des Medienmuseums ZKM, dem laut und vernehmlich schlagenden Herzen der Fächerstadt. Die Wohnung befand sich in einem schmucklosen Bürgerhaus aus den Fünfzigerjahren und war mehr praktisch als schön.
Karlsruhe genoss den Status einer aufstrebenden, teuren Stadt. Meine neue Behausung war also nicht gerade billig, aber sie war für mich bezahlbar und lag zentral. Ich würde den alten 2 CV, den wir in Frankreich für mich angeschafft hatten, vielleicht gar nicht mehr brauchen. Doch das kleine Gefährt war so bunt und fröhlich, wie es da vor dem Haus stand. Ich bemerkte, dass die Leute oft stehenblieben und es anlächelten. Ein Gute-Laune-Auto. Doch drin saß eine Frau mit schlechter Laune.
Das Haus in Sélestat, in dessen alten Holzdielen so viele Geister aus der Vergangenheit hausten, hatte ich mitsamt unseren Möbeln an einen rumänischen Arzt mit deutschem Pass verkauft. Der hatte es sich offenbar zum Hobby gemacht, alte Fachwerkhäuschen billig zu erstehen, zu renovieren und an Türken und Araber weiterzuvermieten. Unter normalen Umständen hätte das die Denkmalschützerin in mir auf die Barrikaden gescheucht, doch in der Zeit nach Olivers viel zu frühem Tod war mir eigentlich alles gleichgültig. Mochte doch ganz Sélestat zerfallen! Die Wahrscheinlichkeit dafür war allerdings gering, denn diese chaotische Ansammlung an Gassen, Kirchen mit geheimnisvollen Krypten und alten Häuschen hatte immerhin bereits viele Jahrhunderte überstanden.
Der dubiose Arzt konnte alles haben. Nur ein paar Bücher, Fotos und die Kerze, die wir abends angezündet hatten, wenn wir aßen und Wein tranken, nahm ich mit in mein neues Leben als eine Witwe, die streng genommen keine war. Denn natürlich waren mir in Deutschland einige Freunde geblieben.
Manche wohnten nicht mehr in Karlsruhe, so wie Matthias, mein spießiger Dauerverehrer, der endlich eine Frau gefunden hatte, die mit ihm zusammen fernsehen wollte. Und das in einem kleinen Ort am Neckar irgendwo hinter Heidelberg, wo sie als Altenpflegerin arbeitete. Ein Berufsprofil, das sie in nicht allzu ferner Zukunft bei ihm wahrscheinlich bestens gebrauchen konnte.
Theo, der schrullige Antiquar, der mich bei so vielen meiner Fälle unterstützt hatte, hatte sich sehr gefreut, dass ich wieder da war. Und war kurz danach mit ehrlichem Bedauern abgereist: »Aber nur, weil ich die Fahrkarte schon hatte, Maren. Sonst wäre ich bei dir geblieben.«
»Ist schon gut. Ich kann dich bestimmt auch in sechs Wochen noch brauchen. Wohin reist du denn überhaupt?«
Die Antwort hatte mich erstaunt.
»Nach Amerika. Zu meiner Schwester. In der Nähe von Neu York!«
»In diesem Fall heißt es Flugticket und nicht Fahrkarte, Theo. Und ich glaube, der Ort heißt New York!«
Theo würde mir fehlen, doch wenn er den Besuch nicht über Gebühr ausdehnte, würde mein belesener Freund in ein paar Wochen wieder zurück sein. Solange lag sein kleiner, gemütlicher Laden verwaist.
Wenn ich nicht mindestens die erlaubte Zeit drüben bleibe, lohnt sich die Fahrt nicht!, schrieb er mir kurz nach seiner Ankunft und zwar als SMS – eine technische Revolution für ihn, dessen Universum aus staubigen Büchern und uraltem Wissen bestand.
Ich zog also in meine neue Wohnung, möblierte sie gedankenlos und lebte mich ein. An meine Arbeit als Ahnenforscherin mochte ich nicht denken und noch weniger an meine Leidenschaft fürs Detektivspielen. Ich hatte durch meinen Beruf, der zur Berufung geworden war, viel erlebt, hatte mich oft getäuscht und war ebenso oft enttäuscht worden. Vieles hatte ich untersucht: einen Mord im Schwetzinger Schlosspark, die geheimnisvollen Verstrickungen des Hauses Baden mit einer Grabstätte in Pforzheim, ein altes Schiffsunglück in New York, das mit Mord und Totschlag im Europa Park Rust endete. Begonnen hatte meine kriminelle Vergangenheit mit einer geheimnisvollen Familiengeschichte rund ums Kloster Maulbronn …
Mit all dem war ich fertig gewesen. Mit Oliver hatte ich ein neues Leben beginnen wollen. Nun musste ich mich schon wieder auf einen Neustart einstellen.
Als ich dann scheinbar wieder auf den Füßen war, zog es mir den Boden genau darunter weg. Ich entwickelte diese bösartige Grippe, die nicht weichen wollte. Das Fieber stieg unaufhaltsam, niemand machte mir Wadenwickel, und ich wurde dünner und schwächer. Und es machte mir nicht einmal etwas aus. Eigentlich war es egal, ob ich noch da war oder nicht.
Das konnte und wollte meine Freundin Felicitas nicht länger mit ansehen. Felicitas, die wie ich jetzt Mitte Vierzig war, hatte ich vor etlichen Jahren am Teich im Schlossgarten kennengelernt. Gemeinsam hatten wir uns zwar die letzte freie Parkbank geteilt, aber zwischen uns doch so viel Raum gelassen, dass noch eine dritte Person hätte Platz nehmen können. Jede von uns hatte ein Buch herausgeholt: ich »Der Kettenmann«, einen brutalen Thriller mit abgesägten Gliedmaßen, die nach einem geheimnisvollen alten Code über die Stadt Chicago verteilt wurden, und sie »Astas Tagebuch« von Barbara Vine.
»Das ist ein Krimi ohne Mord. Nur mit einem Geheimnis«, empfahl sie mir, als sie meine Seitenblicke bemerkte. »Die Spannung ist trotzdem fast unerträglich. Nein, falsch, sie ist köstlich. Wie ein ausgedehntes Essen in einem guten Restaurant. Ihr Buch, mit Verlaub, sieht mehr aus wie eine Schlacht bei McDonalds!«
So hatte unsere Freundschaft begonnen. Wir trafen uns von da an regelmäßig, und sie hatte mir gutgetan. Felicitas war diszipliniert und trotz ihrer zarten Erscheinung überraschend zäh. Als wir in dem kleinen, gemütlichen Cafe Jäck in der Karlstraße zusammensaßen, erklärte sie dazu: »Sportlich waren viele in unserer Familie. Mein Vater und auch mein Opa, ja, der hat sehr gut Tennis gespielt, und meine Uri Clara war sogar beinahe athletisch. Von ihr und ihren Freundinnen existierte in Mamas Album ein altes, hochdramatisches Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1919. Darauf haben die Frauen und Mädchen ungemein pathetisch aussehende Gymnastikübungen vollführt und halb nackt griechische Tänze in der freien Natur getanzt. Sah lustig aus. Wie eine Szene in einem Stummfilm.«
»Wer verwendet denn heute noch das Wort ›ungemein‹? Ich liebe deine schöne Sprache, Felicitas.«
»Und ich meinerseits liebe die gute, alte Zeit. Zu Hause habe ich eine Fotoleinwand. Ich habe die alten Bilder zu einer Collage zusammengestellt und dran gepinnt. Eigentlich beobachten mich alle meine Vorfahren tagtäglich. Sie sind wichtig in meinem Leben.«
Später würden wir erfahren, wie recht sie damit hatte. Jetzt amüsierte ich mich darüber: »Na, du bist ja wirklich der Fleisch gewordene Traum eines jeden Ahnenforschers!«
»Maren, du weißt das besser als ich. Wir sind doch alle das Produkt aus so vielen verschiedenen Genen und Anlagen. Mich fasziniert das, es macht mich stolz.«
Als sie das sagte, strahlte sie tatsächlich von Innen heraus. Ich hingegen schwieg, denn in meiner Familie ging es anlagentechnisch etwas bescheidener zu. Ich dachte an meinen Vetter Stefan, der bereits das vierte Mal unglücklich verheiratet war, und die Tochter meiner Cousine Astrid, die bei »Deutschland sucht den Superstar« in der ersten Runde rausgeflogen war.
Felicitas hingegen war ganz erfüllt von den glänzenden Fähigkeiten ihrer Vorfahren.
»Uri Clara war eine begeisterte Skifahrerin und eine herausragende Bergsteigerin. Obwohl ihre Familie, glaube ich, ganz ursprünglich mal aus dem Mannheimer Raum kam, waren die Berge ihr Ein und Alles. Eine fortschrittliche Frau. Du, die war sogar in Paris auf einem Institut und hat dort Französisch gelernt. Dagegen bin ich langweilig. Das bisschen Paddeln ab und zu im Vierordtbad.«
Bei dem Wort zuckte ich zusammen. Auch dort, mitten unter den Schwimmern in Karlsruhes wunderschönem Wellnesstempel, hatte es damals eine Tote infolge einer tragischen Geschichte auf dem Jakobsweg gegeben.
*******
Nun war ich also krank und Felicitas, die mich zweimal am Tag versorgte, beschloss, dass ich ebenso gut in ihrer herrlichen Altbauwohnung in der Cäciliastraße weiterhusten könnte. In dieser Wohnung hatte sie schon mit ihrer Mutter gelebt, alles darin atmete Würde.
Und so lag ich dann bald in ihrem hübschen, sehr femininen Gästezimmer, umgeben von Orangensaftgläsern, Tablettenpäckchen und zerknüllten Tempotaschentüchern. Natürlich auch von Zeitschriften und Büchern, denn Felicitas las viel und behielt sogar das meiste davon im Gedächtnis.
»Du erinnerst mich an Virginia Woolf!«, sagte sie freundlich. »Die war auch bei jeder seelischen Erschütterung krank.«
»Ist zwar ein schmeichelhafter Vergleich«, krächzte ich, »aber ich hoffe, ich ende nicht wie sie: Steine in die Tasche und ab ins kalte Wasser.«
»Kein Fluss in unmittelbarer Nähe, in dem du dich ertränken könntest. Die Alb ist zu flach.« Felicitas schüttelte mein Kissen auf und legte mir einen Stapel frischer Tempos griffbereit hin. »Kommst du zurecht, Maren? Ich würde jetzt mit Adele ins Kino gehen und mir diesen neuen französischen Film ansehen. Ach, ich verehre alles Französische. Das liegt mir im Blut – meine Ururoma Alberta hieß mit Mädchennamen Debertin, und sie war eine Hugenottin. Sie hat dann in die Familie Heym geheiratet und ihren ausgeprägten Kunstsinn mitgebracht. Ihre Tochter, meine Uroma Clara Heym etwa …«
»Und wie heißt der Film?«, krächzte ich, um den vielen Urs zu entfliehen.
»Monsieur Chocolat.«
»Aha.« Französische Filme langweilten mich. Allzu geduldige Kameraeinstellungen und feinsinnige Gags, die ich erst nach langem Nachdenken verstand.
Felicitas stellte mir die Flasche Fachinger griffbereit und erläuterte: »Der Film stand als Tipp in den BNN. Es geht um einen entflohenen karibischen Sklaven, der in den Pariser Nachtclubs der Jahrhundertwende wie ein Clown vorgeführt wurde, sich auch selbst so benahm, wohlhabend wurde, das süße Leben genoss, aber dann merkte, dass ihm seine Menschenwürde abhandengekommen war. Finde ich ein interessantes Thema.«
»Welche Jahrhundertwende?«, krächzte ich.
»Maren! Natürlich die vorletzte. Und nun schlaf! Ich bin bald zurück. Französische Filme sind meistens nur 80 Minuten lang.«
Ich beobachtete, wie sie den Vorhang meines Siechenzimmers zuzog.
Felicitas war schmal und hatte ihr lockiges dunkelblondes Haar wie einen lichten Kranz um den Kopf frisiert. Sie trug stets ausgefallene und geschmackvolle Kleider, die sie bei einem dänischen Versandhaus bestellte. Das moderne, hektische Leben schien an ihr vorüberzugehen. Felicitas verschlang gute Bücher, dachte lange in ihrem Schaukelstuhl über die Welt nach, schrieb kleine altmodische Gedichte und verfasste sogar Briefe, die sie am oberen Rand mit kleinen filigranen Zeichnungen versah. Natürlich verdiente sie auch Geld, obwohl ich nicht wusste, ob sie es wirklich nötig hatte, denn sie stammte ja ganz offensichtlich aus einer gutsituierten Familie.
Ihr Urgroßvater Alfred Mänzer und ihr Großvater Robert Mänzer, so erzählte sie oft voll Stolz, waren renommierte Ärzte gewesen. Felicitas selbst arbeitete als Geigenlehrerin und regelmäßig kamen kleine, niedliche Püppchen mit winzigen Geigen zu ihr, abgegeben von jungen und schicken Müttern, die viel jünger und schicker waren als Felicitas und ich. Diese Kinder kratzten dann scheue Mäusetönchen auf ihren Geigen und Felicitas verteilte am Ende der Stunde Smarties als Belohnung.
Dass Felicitas aus besserem Haus stammte, sah man nicht nur an ihr selbst und ihrem guten Geschmack, sondern auch an ihrem Porzellan, ihren Möbeln, der ehrwürdigen Büchersammlung und ihren edel gerahmten Bildern. Zwar handelte es sich meistens nur um moderne, schön gerahmte Kunstdrucke oder Museumsposter, doch strahlten sie allesamt jenen gewissen intellektuellen Geschmack aus, den man nicht kaufen und nicht lernen konnte.
»Die Debertins, von denen meine Uri Clara Heym, verheiratete Mänzer, mütterlicherseits abstammte, betrieben eine Spedition, und ich denke, das eine oder andere haben sie wohlhabenden Leuten abgekauft, die umgezogen oder ausgewandert sind. Ich habe jedenfalls gehört, sie besaßen zahlreiche Kunstgegenstände. Allerdings war nach dem Krieg nicht mehr viel übrig. Meine Mama besaß im Grunde nichts mehr Wertvolles, nur Kopien oder Drucke. Keine Ahnung, wo die anderen Sachen geblieben sind. Möglicherweise war Uris Haus von Bomben zerstört worden oder vielleicht liegen die Sachen irgendwo noch in einem vergessenen Safe. Uri Clara starb ja so plötzlich«, endete sie versonnen.
Ich schnäuzte, stöhnte und gab übellaunig einen Kommentar ab: »Oder sie haben sie vielleicht schlicht und einfach verkauft. In den Kuhställen des Kraichgau hatten sie damals angeblich Orientteppiche liegen. Eine Wurst gegen einen silbernen Kerzenleuchter.«
Auch die Wand neben meinem Krankenlager zierte ein Bild in einem würdigen Holzrahmen. Es war einer dieser vielen Niederländer, die man früher furchtbar oft auf Kalenderblättchen gesehen hat, und wo mehr oder weniger einer wie der andere aussah. Und man wusste niemals so recht, wie der Name des Künstlers auszusprechen war: Breughel, Brügel … Einmal war es der Jüngere, ein andermal der Ältere. Die Bilder jedoch schienen irgendwie gleich.
Die angesäuselten, tanzenden Bauern mit ihren Holzschuhen und ihren Gelagen hatte man irgendwann ebenso satt wie die blauen Schwertlilien von Van Gogh oder dessen trauriges Selbstbildnis, das einem im Esszimmer bei den Schulaufgaben zusah. Als Reproduktionen, gestickte Bildchen oder als Poster gehörten sie in unsere Kindheit der Sechziger- und Siebzigerjahre, und unsere Omas staubten die geschmacklosen Kopien lieblos ab.
Das Bild, das nun so plastisch neben meinem Bett hing, gefiel mir nicht besonders. Und der lange Titel, der auf einem in Folie geschweißten Karteikärtchen neben dem Werk hing, ließ meinen Magen rebellieren. »Der Antrag und ein Mahl auf dem Lande«. So wortreich wie der Titel, so bevölkert war auch das überladene Bild selbst. Es erzählte gleich mehrere Geschichten:
Im Vordergrund, unter dem romantisch kaputten Dach eines Hauses oder einer Schänke, spielte sich ein Teil der Handlung ab. Ein paar ziemlich rustikal aussehende Gestalten in groben Jacken tummelten sich um einen rohen Holztisch, auf dem in einer irdenen Schale derbe, fette Würste serviert wurden, bei deren Anblick erst recht Übelkeit in mir aufstieg. Etliche Hunde vom Typ Spaniel balgten sich am Boden um einen Knochen. Im Hintergrund der Gaststätte spielte ein Mann etwas, das wie eine Gitarre aussah. Alle Männer trugen weite weiße Hemden. Einige hatten ein Lederwämschen oder derbe Jacken darüber. Friedlich zogen im Hintergrund ein paar weiße Wolken über den kühlen, blassblauen Himmel, der die Landschaft mit sparsam belaubten Bäumen, einem sich windenden Fluss und einem Ort mit Kirche und Häusern überspannte. Das große stolze Gebäude im hinteren Bereich des Bildes erinnerte an ein Herrenhaus und ließ auf die Nähe zu einer Stadt schließen. Die frischen Wiesen und Weiden und die Szene am Tisch wirkten friedlich. Stolz stand ein gut gekleideter Gutsherr im Vordergrund und betrachtete den Tisch, einige andere Männer saßen auf einer Bank und genossen die Musik. Ein Mann mittleren Alters stand hinter der geöffneten Gaststättentür, an der er sich festhielt, und beobachtete alles wohlwollend. Die gedrungenen, in enge Wämschen gepackten Kinder, die überall herumkugelten, lachten. Vor dem Haus stand ein gerade erblühender Baum und verdeckte halb ein paar Butzenfenster. Aus einem der Fenster lugte ein weiteres Gesicht heraus, das eines Mannes mit dunklen Locken. Er wollte es mit seinem kräftigen Arm wohl gerade schließen.
Irgendwo hatte ich mal gehört, dass niederländische Maler nach der Zahl der Köpfe bezahlt wurden, die sie gemalt haben. Wahrscheinlich hatte der unbekannte Künstler dann hier und dort noch einen Kopf platziert. So nach dem Motto: Meine Frau braucht noch einen Wintermantel. Also mal ich schnell noch zwei Typen in das Bild!
Auf der Bank neben der Schenke standen Krüge und Schüsseln. Die drei Frauen trugen ebenfalls weiße Blusen über langen Kleidern mit wärmenden Überwürfen.
Aber das war noch nicht alles. Das bereits übersättigte Auge schweifte weiter. Die Hauptszene des Gemäldes bestand aus einem Mann, der etwas vom Haus entfernt unter einem Baum saß und seinen Arm um eine junge, dralle Frau legte. Mit der Hand des anderen Armes griff er nach ihren Fingern. Wenn die Leute am Tisch das »Mahl auf dem Lande«darstellten, musste das hier »Der Antrag«sein.Als ob das alles nicht genug wäre, tanzten im Hintergrund vor der Silhouette einer Stadt oder eines größeren Dorfes noch die üblichen gesichtslosen Standardbauern in Holzschuhen herum.
Das Bild war nicht schlecht, doch es war insgesamt kein besonders tiefschürfendes Werk.
Ich seufzte und wandte den Kopf zum Fenster, das mir im Vergleich zu diesem Bild geradezu leer und friedlich schien: Nur der Himmel über der Stadt Karlsruhe und der Ast eines blühenden Baumes, sonst nichts.
Doch irgendwann musste ich mich wieder umdrehen und da war er dann wieder, »Der Antrag«. Als wollten die beiden Verliebten mich verhöhnen. Ob Oliver und ich eines Tages geheiratet hätten?
*******
Nachdem ich wochenlang auf dieses Bild gestarrt hatte, meistens allerdings mit hämmerndem Kopfschmerz oder zwischen Fieberschüben, klagte ich in Felicitas‘ stets sanftes und geduldiges Ohr.
»Felicitas, ich kann dieses Landidyll nicht mehr sehen. Häng was anderes hin. Tausch es aus, von mir aus sogar gegen einen richtig hässlichen Picasso. So mit Auge mitten auf der Stirn oder so.«
»Kann ich morgen machen!«, entgegnete sie heiter. »Ich besitze zwar einen Picasso, einen wunderschönen Rückenakt in Blaugrün, doch im Unterschied zu diesem Bild da ist er nicht echt.«
Ich setzte mich auf und ließ mich gleich wieder fallen. Dass man sich derart schlecht fühlen kann!
»Echt? Das da ist also wirklich ein Original?«
Felicitas stopfte mir ein Kissen in den Rücken. Sie roch zart nach einem altmodischen Blütenduft.
»Ja. Und sogar ein Teniers.«
»Wer?«
Felicitas vergab mir und klärte mich freundlich auf: »Es gleicht den Werken des berühmten Malers David Teniers, dem Jüngeren, wohlgemerkt. Geboren Anfang des 17. Jahrhunderts. Ist ziemlich alt geworden, hat also ein ganzes Jahrhundert mit seinen Bildern begleitet. Hat verschiedene Genrebilder gemalt, darunter Wirthausszenen und Dorfszenen, aber auch biblische Darstellungen und Tierstücke. Er war sehr angesehen und offenbar ein guter Netzwerker, wie man heute sagen würde. Er kannte sie alle. Rubens und die anderen. Er hat sogar die Tochter von Jan Brueghel, dem Sohn des bekannten Bauernbrueghel, geheiratet. Samtbrueghel genannt.«
»Ein kontaktfreudiger Typ also!«
»Offenbar. Es gab hier in der Kunsthalle eine große Sonderausstellung über Teniers. Vor etwa elf Jahren. Ich habe irgendwo noch den Katalog. Warte, ich suche ihn.«
Ich wartete ergeben. Ins Museum zog es mich nur in bestimmten Stimmungen. Etwa sonntags, wenn ich mich einsam fühlte. Doch nicht immer passten die Termine der Sonderausstellungen und meine Gefühlswelt zusammen. Deshalb war ich schon lange nicht mehr in der Staatlichen Kunsthalle gewesen.
Felicitas, deren gesamte Vergangenheit offenbar erstaunlich gut sortiert war, erschien schon nach kurzer Zeit mit einem jener voluminösen Kataloge, die bei Sonderausstellungen zu überhöhten Preisen angeboten wurden. Ich blätterte das dicke Buch kraftlos durch. Allesamt typische Szenen: Häuser, Bäume, Hunde, Kinder, Kartenspieler, betrunkene Leute in der Kneipe, ewige Tanzereien auf dem Marktplatz …
»Haben diese Holländer eigentlich zwischendurch auch mal was gearbeitet? Sie singen und tanzen und essen und trinken anscheinend ganzjährig«, fragte ich gereizt.
»Maren, immerhin haben sie ein Weltreich aus Handel und Wandel aufgebaut und die sogenannte Vereinigte Ostindische Kompanie gegründet. Aber mein Bild stammt natürlich nicht von dem großen Teniers. Es ist von seinem Bruder, Abraham Teniers, der nicht ganz so berühmt war, aber immerhin auch einen Namen hat. Es gab sogar ein Echtheitszertifikat von einem habilitierten Kunsthistoriker, welches auch die Datierung und die Signatur bestätigt. Meine Mutter hat mir oft davon erzählt.«
»Beeindruckend«, sprach ich muffig und wuchtete das schwere Buch auf die andere Bettseite.
In meinem familiären Umfeld hatte es nicht allzu viele echte Kunstwerke gegeben. Die einzigen Originale, die ich bei meinen Leuten gesehen hatten, stammten von mir selbst aus dem Kindergarten. Echte Bilder von echten Malern hatten sich in meiner Welt nur Leute geleistet, die von allem anderen schon genug gehabt hatten. Heute sei Kunst vor allem Geldanlage, hörte ich immer wieder und fand das irgendwie ernüchternd.
»Ja. Dieses Zertifikat ist leider irgendwann verschwunden. Vielleicht hat es meine Tante Diana nach Amerika mitgenommen oder mit ihren anderen Sachen versehentlich weggeworfen. Eine Art Begleitschreiben, in dem der Kunsthistoriker seine Untersuchung kurz zusammengefasst hat, muss aber noch irgendwo bei ihren Sachen auf dem Speicher sein. Meine Mutter hat es mir mal irgendwann gezeigt. Obwohl ich schweren Herzens schon einiges entsorgt habe, ist der Speicher immer noch voll von uralten Sachen. Ich gehe da niemals hoch.« Dann kokett: »Frag mich also bitte nicht, wo genau es heute liegt. Ach, man möchte immer Ordnung in das Chaos bringen und schafft es dann doch nie …«
Es tat gut, dass auch die disziplinierte Felicitas nicht alle Dinge auf Anhieb fand.
»Maren, niemand hat je angezweifelt, dass es ein echtes altes Bild ist. Das sieht man an der Tiefe der Ölschichten. Die Pinselstriche müssen geradezu zu fühlen sein. Hat mir irgendwann ein erwachsener Geigenschüler gesagt, der sich auskennt.«
»Ist es denn sehr wertvoll?«
Ich wusste, dass sich Felicitas nicht viel aus Geld machte, denn ihr Luxus waren Musik und Bücher und dafür reichte es immer. So hob sie nur fragend die Schultern. Die Sonne verfing sich in ihrem dunkelblonden Haar mit den hübschen kleinen Löckchen.
»Vielleicht schon. Ich habe es mal im Internet recherchiert. Bilder niederländischer Maler aus dem 17. Jahrhundert haben ihren Wert. Natürlich nicht wie David Teniers selbst. Der kann schon mal hunderttausend Euro auf einer Auktion bringen.«
»Was?« Verständnislos betrachtete ich die selbstvergessen tanzenden Bauern.
»Ja, aber dieser da könnte schon auch zehntausend Euro wert sein. Ich habe es von meiner Tante Diana Mänzer, der Schwester meiner Mutter, geschenkt bekommen. Oder sagen wir vielmehr, sie hat bestimmt, dass ich es später mal bekommen soll. Als sie nach Amerika ging, war ich ja noch klitzeklein.«
»War das die Modezeichnerin, von der du mir erzählt hast?«
»Ja, die Modezeichnerin. Diana Mänzer. Sie trug ihren Mädchennamen, da sie meines Wissens nach niemals geheiratet hat. Schneiderin hatte Diana eigentlich gelernt, aber sie hatte wohl immer eigene und ausgefallene Ideen. Meine Tante muss eine ehrgeizige Frau gewesen sein, und sie hätte wohl nur zu gern ihr eigenes Atelier mit ihren eigenen Kreationen gehabt.«
Felicitas stand auf und wies auf ein Foto, das eine Frau im Profil zeigte. Dunkles Haar, makelloser olivfarbener Teint, ein energisches Kinn und eine keck aufstrebende Nase. Hübsche Person.
»Die Locken hast du von ihr!«
»Nicht unbedingt. Meine Mutter hatte auch schönes Haar. Diana war übrigens kinderlos. Sonst hätten ja ihre Nachfahren das Bild bekommen.«
»Klar!«
»Aber Diana hat zu meiner Mama gesagt – und sie hat es mir hundertmal vorgebetet, du kennst ja Mütter – sie möge es mir geben, und ich solle es auf jeden Fall behalten und immer wieder betrachten. Es sei bedeutsam und gehöre in die Familie Mänzer, hat sie gesagt. Obwohl meine Mutter ja durch ihre Heirat Sempermann hieß und ich damit eigentlich auch eine Sempermann bin.« Es klang nicht freundlich, wie sie den Namen Sempermann aussprach. »Aber ich fühle mich dem Namen Mänzer mehr verbunden, deshalb habe ich beschlossen, so zu heißen. Und da ich eine gesetzestreue Person bin, habe ich es auch in den Pass eintragen lassen. Kostenpflichtig.«
»Was war an diesen Mänzers so besonders?«