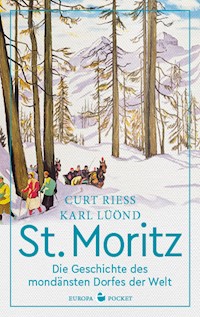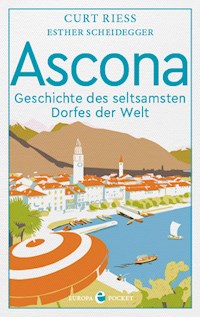
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im trotz aller Weltkrisen und -kriege immer schicken und mondänen Ascona begegneten sich Künstler und Kunstliebhaber, Einheimische und Exilanten, Intellektuelle und Naturmenschen. Man amüsierte sich, diskutierte, und zahlreiche Musiker, Tänzer, Schriftsteller und Architekten fanden Inspiration und Impulse für spätere Werke. Von Erich Mühsam über die Gräfin Reventlow bis zum Clown Dimitri – Curt Riess erzählt unterhaltsam von den Bewohnern und Besuchern des "seltsamsten Dorfes der Welt".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe 2021
Bildmaterial entnommen: Curt Riess: Ascona. Geschichte des seltsamstenDorfes der Welt. Europa Verlag A.G. 2. Auflage. Zürich 1964.sowie Seite 2: Sheila – fotolia.de (oben), Sunlove – fotolia.de (Mitte),Hans Muench – fotolia.de (unten)Im Nachwort: Friedrich Glauser: Der alte Zauberer. Das erzählerischeWerk. Band 2. Unionsverlag. Zürich 2000.Vollständige Taschenbuchausgabe Mai 2021© 2012 Europa, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, MünchenUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung einer Illustration von © qpiii/Shutterstock
Konvertierung: BookwireePub-ISBN: 978-3-95890-395-1
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
CURT RIESS
ESTHER SCHEIDEGGER
Ascona
Geschichte des seltsamsten Dorfes der Welt
INHALTSVERZEICHNIS
Ein Paradies mit Postleitzahl: 6612 Ascona
Zum Geleit
Jeder sagt etwas anderes
Oedenkoven und die Folgen
Erich Mühsam besingt die Vegetarier
Ein seltsamer Prospekt und seltsame Gäste
Die himmlische Reventlow
Emil Ludwig – Dichter ohne Geld
Ein Anarchist – eine Nackttänzerin – ein Naturmensch
In den grossen Krieg
Die Werefkin kommt – die Reventlow geht
Schwindler auf dem Monte Verità
Inflation – und eine bemerkenswerte Dame aus Deutschland
Auftritt: Baron von der Heydt
Der sagenhafte Emden
Ruhe vor dem Sturm – und die Fede
Nelly’s Bar
»Im Westen nichts Neues«
Flüchtlinge – wohin?
Die Kinder – und Rosenbaum taucht auf
Marionetten – so oder so
Und schon wieder Krieg!
Rolf Liebermann
Wovon lebt der Mensch?
Schmuggel respektabel und politisch
Enthüllung eines seltsamen Geschäfts
Dimitri
Sehnsucht nach gestern
Und morgen …?
Ascona oder alles bleibt, wie es nie war
Noch eine Kommune und weitere Protagonisten
Spucknapf, Jahrmarkt, Ringeltanz
Das Museo Epper
Bücherwelten
Der Sternekoch und die Anarchie
Eine Adresse im Herzen
Wer im Buch vorkommt (Register)
Bildteil
EIN PARADIES MIT POSTLEITZAHL: 6612 ASCONA
»Na ja, Franzel, Ascona gehört entschieden zur Biografie«, schrieb Franziska Gräfin zu Reventlow (1871–1918) ihrem Freund Franz Hessel, »aber ich sehe vom Turm aus Locarno und die Ecke, wo die Bahn in die Welt hinausgeht, und es wird sehr schön sein, nach einem faulen Sommer da hinauszufahren«. Dazu gekommen ist sie nicht mehr. Dass ihr der frühe Tod das Altern ersparte, hatte sie sich wohl gewünscht: »Die beste Vorsorge fürs Alter ist jedenfalls, dass man sich jetzt nichts entgehen lässt, was Freude macht, so intensiv wie möglich lebt. Dann wird man dermaleinst die nötige Müdigkeit haben und kein Bedauern, dass die Zeit um ist.« Ihre letzte Ruhe hat sie, nach einem dummen Unfall mit ihrem legendären Fahrrad, nicht in Ascona gefunden, sondern auf dem Friedhof der Kirche »Santa Maria in Selva« (im Wald) in Locarno.
Ascona gehörte nicht nur zur Biografie der vielgeliebten Reventlow, die hinreissende Briefe und Tagebücher schrieb und »Petitessen« wie Von Paul zu Pedro oder Der Geldkomplex, den sie mit Grandezza nonchalant ihren Gläubigern widmete. Dem magischen ehemaligen Fischerdorf am Lago Maggiore hofierten im Laufe der Zeit Heerscharen von aus den unterschiedlichsten Beweggründen Zugereisten. Der skurrile Chronist Emil Szittya (1886–1964) fasste es furios zusammen: Er schrieb, 1924, von »Begegnungen mit seltsamen Begebenheiten, Landstreichern, Verbrechern, Artisten, religiös Wahnsinnigen, sexuellen Merkwürdigkeiten, Sozialdemokraten, Syndikalisten, Kommunisten, Anarchisten, Politikern und Künstlern«.
Ascona gehörte – und gehört – auch zur Biografie von Schriftstellern und Journalisten. Prominente Paradebeispiele waren virile, schillernde Figuren wie Erich Maria Remarque (1898–1970) mit seinem Weltbestseller Im Westen nichts Neues oder Hans Habe (1911–1977), von dem das Credo stammt, »der Platz zwischen allen Stühlen« sei der einzige, der eines Schriftstellers würdig sei. Einer von ihnen war auch der ambitioniert recherchierende und figulant schwadronierende Journalist Curt Riess (1902–1993). 1964 erschien sein Buch Ascona. Geschichte des seltsamsten Dorfes der Welt im Europa Verlag Zürich seines Freundes Emil Oprecht (1895–1952), dem legendären Verleger und Verwaltungsratpräsidenten des Schauspielhauses Zürich. Mit dem Schauspielhaus war Riess auch privat verbandelt, seine Gattin, die Diva Heidemarie Hatheyer, gehörte 1955–1983 zum ständigen Ensemble. Sie war während ihrer langen internationalen Karriere die Mutter Courage gewesen, die Heilige Johanna, die Geierwally und in William Faulkners Requiem für eine Nonne eben jene Nonne.
In den sechziger Jahren, als das Buch von Curt Riess erschien, war Ascona tatsächlich keine exklusive Künstler- und Reformerkolonie mehr, sondern ein boomendes Touristenzentrum für (fast) jedermann, auch für den Schweizer Mittelstand. Der Basler Kurt Z., damals 5-jährig, erinnert sich belustigt an fröhlich Federball spielende Nonnen im Borgo vor dem Borromeo, an die tollen Familienferien in einer nagelneuen sogenannten Ferienresidenz und vor allem ans köstliche Zitronen-Gelato im Lido. Dort konnte man – wow! – sogar dem Schlagerstar Freddy Quinn in Badehose begegnen, der gerade mit Junge, komm bald wieder … einen Hit gelandet hatte. Im gleichen Jahr machte auch Connie Francis Furore, mit Paradiso unterm Sternenzelt, Paradiso Palmenstrand … Gemeint war mit diesem Paradies zwar nicht Ascona, aber die kollektiv beseligende Sehnsucht der Kriegs- und Nachkriegsgenerationen nach dem romantischen Süden bekam eine neue Stimme.
Ascona war (und ist bis heute) auch ein Magnet für Flitterwöchner. Einer von damals weiss noch heute, fünfzig Jahre später, wie er schicksalhaft die Bekanntschaft des Hexenmeisters, Antiquitätenhändlers und ehemaligen Schweizer Star-Anwalts Wladimir Rosenbaum machte, in dessen Galerie in der um 1620 erbauten barocken Casa Serodine. Er kaufte, obwohl er eigentlich noch überhaupt kein Geld hatte, für seine Frau eine Skulptur, sie wurden zum Essen eingeladen, und Rosenbaum verriet ihm sogar den simpeln numerisch alphabetischen Code, mit dem er die Preise seiner Kunstwerke chiffrierte.
Rosenbaum (1894–1984) war gerade selber wieder frisch verheiratet, 1957 hatte er sich mit Sybille Kroeber aus Halberstadt im Harz liiert, einer beherzten Journalistin, die 1997 starb. Begraben liegt sie in Ascona, mit ihrem Mann und mit dessen zweiter Frau, der Psychoanalytikerin und Schriftstellerin Aline Valangin, die sich 1939 mit einem Geliebten, dem Komponisten Wladimir Vogel, ebenfalls in Ascona niedergelassen hatte. Wie sich die Ex-Ehefrau ins Rosenbaum-Grab komplimentierte, daran erinnerte sich Sybille lebhaft: »Ro und ich waren bei Aline zum Tee. Wir sassen vor ihrem Haus in einer Laube. Aline hatte gerade Besuch gehabt von dem Geistlichen dieser altkatholischen Kirche, der sie angehörte, und mit ihm hatte sie alle ihre Sterbewünsche besprochen: was für Musik und was sonst alles sie sich denke für ihren Tod. Dadurch kam auch unser Gespräch auf dieses Thema, und bei dieser Gelegenheit sagte Aline: ›Und begraben sein würde ich ja gerne‹ – mit leichter Verbeugung zu mir hin –, ›wenn Sie nichts dagegen haben, mit euch.‹ Sie lud sich sozusagen ein. Ich habe ein wenig gelacht und gesagt: ›Natürlich habe ich nichts dagegen, Aline. Das wäre ja komisch, wenn wir uns da unten nicht alle vertragen sollten.‹«
1998 hat der Wirtschaftswissenschaftler und Historiker Wolfgang Oppenheimer in seinem Buch Das Refugium. Erinnerungen an Ascona (Universitas) mit seiner Wahlheimat grimmig abgerechnet und die Geldgier gewisser Bauherrschaften harsch kritisiert. Das deutsche Wirtschaftswunder, schreibt er, sei zum Paten der ungestümen Entwicklung von Ascona geworden. Auch die Politik des Patriziats mit seinem »Kampanilismus« missfiel ihm immer wieder. Den 1928 eröffneten Golfplatz allerdings lobt er über den grünen Klee, auch als intellektuelles Terrain. Er erinnert sich gerührt an die Ansichtskarten, die seine kunstliebende Mutter sammelte und unermüdlich verschickte, auch an ihn. So habe er schon in jungen Jahren viel Kunstgeschichte gelernt, argumentiert er, ganz pragmatisch: »Ausserdem kann man solche Kartensammlungen, wenn die Zeit knapp wird, einfach liegenlassen, während man sogar langweilige Vorträge bis zu Ende anhören muss und mit dem Lesen von Kunstbüchern überhaupt nie fertig wird.«
Oppenheimer lag auch die Biblioteca popolare am Herzen. Diese im besten Sinn gemeinnützige Asconeser Institution gründete 1927 die zugezogene Amerikanerin Charlotte Giese, leicht gewesen war es nicht. 1952 konnte man im Jahresbericht lesen:
Im tiefen Keller sitzen wir/
Und haben grosse Sorgen/
So vieles möchtet lesen Ihr/
Wir würden’s gern Euch borgen.
Doch stets soll’s etwas Neues sein,/
Und’s Kapital, ist, ach zu klein!/
Zum Kaufen neuer Sachen,/
Was sollen wir da machen?/
Wenn Ihr uns helfen wollt, so geht’s,/
Denkt dran, wie wir bemüht sind stets.
Um Euern Bildungsgrad zu heben,/
Vom Dunkeln – Helligkeit zu geben./
Drum greift recht tief ins Portemonnaie,/
Damit wir bleiben auf der Höh’/
Und ihren guten Ruf bewahre/
Die Biblioteca popolare.
Seit Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ist das mehrsprachige Bücherhaus in der hellblau verputzten Casa Laura Pancaldi-Pasini an der Piazza Giuseppe Motta 37 zuhause. Eine tolle Einrichtung! Dem volksbildungsbeflissenen Curt Riess müsste sie eigentlich aufgefallen sein. Viel jünger ist freilich die Kunst am Bau: An der Gartenmauer der Biblioteca prangen seit 2008 die bronzenen Fussabdrücke der deutschen Fussball-Nationalelf samt jenen ihres Trainers Joachim »Jogy« Löw. Die Wand hat der vielseitige Schweizer Künstler Stephan Schmidlin gestaltet, ein Holzschnitzer, Bildhauer und Kabarettist.
Das Ascona-Buch war längst vergriffen, und Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, halten nun den neu gestalteten Reprint in den Händen. Curt Riess machte aus Ascona ein Welttheater. Er kannte viele, aber nicht alle. Ausgeblendet hat er zum Beispiel den Literaten Ferdinand Lion (1833–1968), der mit Thomas Mann über Jahre die Zeitschrift Mass und Wert herausgab, und, kein Kavaliersdelikt, die einst sehr erfolgreiche Autorin Mary Lavater-Sloman (1891–1980). Sie lebte von 1943 an dreissig Jahre lang in Ascona, machte sich einen Namen und eine grosse Leser(innen)schaft mit reihenweise süffigen historischen Biographien: Der Schweizerkönig, Katherina und die russische Seele, Genie des Herzens … Auch ihr Roman Wer singt, darf in den Himmel gehn entstand am Lago Maggiore. Für sie galt ausgesprochen nicht, was Remarque prophezeit hatte: »Ascona regt die meisten nicht zum Schaffen an, sondern zum Nichtstun. Wie vielen bin ich schon begegnet, frisch angekommen mit dem Vorsatz, in Ascona ›das Werk‹ zu vollenden! Bald sah man sie gemächlich mit den andern im Sonnenschein vor dem Albergo sitzen und fleissig auf den Lago Maggiore blicken. Tag für Tag hockten sie da vor ihrem Glase, und es dauerte nicht lange, da hatten auch sie jenen ›leeren, hellblauen Blick‹, den Sie an manchem Bohèmien hier bemerkt haben werden.«
Noch verkannt war damals Friedrich Glauser, der »Erfinder« des schweizerischen Kriminalromans, und die wunderbare, lange verfemte Lyrikerin Mascha Kaléko. Auch diverse »Asconeser«, einheimische wie internationale, wurden erst später ernst genommen. Dazu mehr im Epilog. Lesen Sie drauflos!
Esther Scheidegger
ZUM GELEIT
Es ist nicht ganz leicht, die Geschichte Asconas zu schreiben, schon weil es nicht ganz leicht ist, Ascona zu definieren. Man könnte auch sagen, dass es unmöglich ist. Zumindest ich habe es nicht fertiggebracht.
Ich habe im Laufe der Jahre vielen Menschen, die Ascona bewohnen oder bewohnt haben, diese Frage gestellt; vielleicht fünfzig oder sechzig von ihnen. Ich habe hundert oder zweihundert Antworten bekommen; je nachdem, ob ich die Frage im Winter oder im Sommer stellte, bei schönem Wetter oder bei Regen und Sturm, während des Krieges oder im Frieden, in einer Zeit des allgemeinen Wohlergehens oder der Not, am Montag oder am Dienstag.
So viele Antworten sind natürlich – keine Antworten. Aber vielleicht ist es das Richtigste, was man über Ascona sagen kann, dass niemand genau weiss, was Ascona ist.
Manchmal habe ich mich auch gefragt, ob es Ascona überhaupt gibt. Auf den Landkarten ist es vermerkt, und von Zürich, Berlin, Paris oder New York aus war ich relativ sicher, dass es Ascona gibt. Die Unsicherheit begann erst – und beginnt immer wieder, wenn man in Ascona selbst ist; falls es ein Ascona gibt.
Als ich mich an diese Arbeit machte, dachte ich mir, dass sie so schwer nicht sein würde; da Ascona ja klein ist, müste – so schloss ich messerscharf – es einfacher sein, seine Geschichte zu schreiben, als etwa die Geschichte einer grossen Stadt. Das war ein Irrtum.
Ich könnte nicht einmal sagen, wie ich diese Geschichte schreiben würde, wenn ich noch einmal ganz von vorn zu beginnen hätte. Ich weiss nur, dass jeder meiner Freunde aus Ascona, das, was ich auf seine Erzählungen hin schrieb, für richtig hielt, und alles, was sich auf Berichte anderer stützte, für grundfalsch erklärte. Dies legte mir den Schluss nahe, dass für jeden Ascona etwas ganz anderes ist als für die anderen. Und die zweite Folgerung für mich war, dass ich über Ascona nur so schreiben konnte, wie ich Ascona sehe, spüre, rieche, empfinde – und liebe.
Da niemand in Ascona zu der Überzeugung zu bringen ist – ich habe die entsprechenden Versuche schon längst eingestellt –, dass nur er oder sie allein über Ascona Bescheid weiss, muss ich damit rechnen, dass sie alle auch über dieses Buch den Kopf schütteln werden. Vielleicht werden sie auch die Köpfe über dieses oder jenes schütteln, was sie mir selbst erzählt haben. Weil sie es mir an einem Montag erzählt haben – und das Buch an einem Dienstag lesen. Denn was ist Zeit in Ascona? Eine Woche kann dort wie ein Jahr sein und ein Jahr wie eine Stunde.
Vielleicht ist dies das grosse Geheimnis von Ascona.
Als ich mich entschloss, dies Buch zu schreiben, dachte ich an so etwas wie Vollständigkeit. Alles, was sich in Ascona je zugetragen hat, sollte Erwähnung finden und alle die Menschen, die Ascona sind. Auch das hat sich als unmöglich erwiesen. Nicht annähernd alle, die in diesem Buch vorkommen müssten, haben darin Platz gefunden. Diejenigen, die unerwähnt blieben, mögen mir verzeihen. Wie übrigens auch diejenigen, die ich auftreten liess … Vielleicht sollte sich diese Verzeihung ausdehnen auf mein ganzes Unterfangen, über Ascona zu schreiben. Aber habe ich wirklich geschrieben? Habe ich nicht nur geträumt? Muss man nicht zu träumen beginnen, wenn das Wort Ascona fällt?
Ein Wort nur. Vielleicht ist es nicht mehr. Vielleicht ist es eine Welt, und vielleicht ist es doch nur ein Traum.
Einer der klügsten Männer der Weltgeschichte hat gesagt, er wisse mit zunehmendem Alter immer mehr, dass er nichts wisse. So geht es mir mit Ascona. Als ich mich entschloss, dies Dorf zu erforschen, glaubte ich, eine Menge über Ascona zu wissen. Und jetzt?
C. R.
JEDER SAGT ETWAS ANDERES
Da war die Sonne. Sie hatte den ganzen Tag geschienen. Da war der Himmel. Blau, so weit das Auge reichte. So war es gestern gewesen, so würde es morgen sein.
Da war der See, der immer neue Farben annahm. Da waren die Berge, die den See einrahmten, hoch, mit schneeglitzernden Spitzen, als wollten sie es den Menschen draussen unmöglich machen, hierher zu gelangen, als wollten sie diesen Ort vor ihnen bewahren.
Da waren die Blumen, Ginster von so unerhört intensivem Gelb, als sei er in die Sonne selbst getaucht. Kamelien, Rhododendren, Mimosen. Eine verschwenderische Pracht von Farben und Düften.
Und da war das Dorf mit seinen schmalen holprigen Gassen, mit den Häusern, die sich in die Felsen eingenistet hatten, mit den Treppen und Treppchen, die die Hügel hinaufführten.
Aber war es denn noch ein Dorf? Wie damals, als auf der natürlich ungepflasterten Piazza noch die Kühe weideten und die Hühner spazieren gingen? Neue Häuser waren gebaut worden oder in die Felsen gesprengt, und es entstanden neue Hotels, und eine Garage wurde aufgemacht und Läden. Und dann wurden mehr Hotels gebaut, mehr Garagen, mehr Läden und Einbahnstrassen und Parkplätze, und Schilder wurden aufgestellt, dass dies und das verboten sei.
Aber das Dorf blieb doch ein Dorf. Die hohen Berge hatten zwar die Invasion von draussen nicht verhindern können, aber die Häuser versuchten noch einen letzten Widerstand.
Gegen den Felsen geschmiegt oder dicht aneinander gereiht, um nur ja keine Lücke zu lassen, schienen sie nach aussen hin nichts als kleine und überalterte Häuser, nicht der Rede wert, gleichsam stumm darum bittend, dass man an ihnen vorübergehe und sie nicht beachte. Trat man aber durch eines der schweren Tore, dann stand man wohl in einem geradezu prächtigen Innenhof, inmitten eines Gartens, und da waren sie wieder – die Mimosen, die Rhododendren und die Kamelien. Da gab es wohl auch Palmen und Pinien. Eine Welt für sich. Eine andere Welt als die der Garagen, der Verbotstafeln, der Autos, die vorbeisausten, der Eindringlinge von draussen, die erst gestern Bewohner geworden waren, oder der Touristen, die morgen wieder fort sein würden.
Die anderen, die schon immer hier gewesen waren – aber was heisst eigentlich in diesem Dorf immer? –, sie blieben in ihren Häusern, in ihren Gärten, in ihren Höfen, die sah man nicht.
Manchmal, wenn man sie traf, wenn man mit ihnen über das Dorf sprach, schüttelten sie die Köpfe. Es sei alles wie in einem Roman, nicht wie Wirklichkeit. »Man hat das Gefühl, als träume man, was hier vor sich geht«, sagten sie.
Auch ich träumte manchmal, wenn ich durch die Gassen ging, träumte von diesem Dorf, wie es vor dreissig oder fünfunddreissig Jahren gewesen war, mit dem Vieh und den Hühnern, mit den Fischern, die ihre Netze am Rand des Sees trockneten, mit den Glyzinien, die sich an den alten Mauern emporrankten, als wollten sie alles vergessen machen, was hässlich, geborsten oder zerbrochen war, und mit ihrer Lieblichkeit bedecken. Ich hörte die Dorfmusik auf der Piazza, ein kleines Orchester – einer spielte Gitarre, einer spielte Klavier, einer spielte Ziehharmonika. Rote Lampions schwankten im sanften Wind, und wir sassen und tranken den heimischen Wein, oder wir tanzten auch eine Weile.
Und heute?
»Sie wollen über Ascona schreiben? Da müssen Sie unbedingt mit mir sprechen. … Ich weiss alles über Ascona!«
Wir sassen auf der Piazza. Sie war anders geworden. Gepflastert, natürlich. Flankiert von Hotels und Restaurants. Flankiert auch von unzähligen Autos. Einige wenige hatten Nummernschilder aus dem Tessin, die meisten aus den grossen Städten Deutschlands. Die Piazza war eine Art Hauptstrasse geworden, auf der ständig Autos hin und her fuhren. Konnte man überhaupt noch den See erblicken?
»Sehen Sie dort die Dame mit dem vielen Schmuck?«, fragte meine Begleiterin, oder vielmehr sie ermunterte mich, die Dame zu betrachten. »Von der könnte ich Ihnen eine Menge erzählen. Sie werden es nicht glauben, aber sie ist – meine Putzfrau! So was erlebt man eben nur in Ascona … Und dann, der Herr dort drüben mit der Dame. Die Dame kommt aus Paris. Sie ist natürlich nicht seine Frau, sondern …«
Und so ging es stundenlang weiter.
»Sie wollen über Ascona schreiben?«, fragte mich Karl Vester. »Ich gehe nur noch ins Dorf, wenn ich muss.« Bis vor Kurzem – er ist im Herbst 1963 gestorben – stieg er von seinem Haus auf dem Hügel oft hinunter, er war sozusagen eine der Sehenswürdigkeiten des Dorfes, der alte Mann, der wohl schon auf die Neunzig zuging, mit seinem langen weissen Haar, dem Christusbart, dem Kostüm, das ein wenig an das der Jünger erinnerte.
»1902 kam ich zum ersten Mal. Und 1904 kam ich zum zweiten Mal, und dann kaufte ich die Villa Gabriella und etwa 20 000 Quadratmeter Land, davon 100 Meter Seefront. Alles zusammen für 3000 Franken – also fünf Rappen pro Quadratmeter.«
Nach einer Pause: »Damals hätte ich für mein Geld den ganzen Strand bis Porto Ronco erwerben können. Aber ich kam nicht als Geschäftsmann, sondern als Siedler – und mit Idealen.«
Als ich ihn fragte, wovon er lebe, antwortete er: »Vom Essen und Trinken.« Und dann – mit einem verschmitzten Lächeln: »Ich lebe vom Geld, das ich nicht ausgebe.«
Ein Wort, das vielleicht gerade im heutigen Ascona eine besondere Bedeutung hat, wo viel Geld ausgegeben wird.
Später wurde der alte Mann mit dem Christusbart düsterer: »Der Mensch ist der schlimmste Parasit auf der Erde!« äusserte er. »Wir bereiten eine der grössten Katastrophen der Weltgeschichte vor. Es wird viel schlimmer als der Zweite Weltkrieg sein, der im Grunde genommen noch gar nicht zu Ende ist.«
Seltsamerweise kam er immer wieder auf Geld zu sprechen. »Man könnte einen Hut voll Geld haben, und man wäre doch ein armer Mann.« Dies galt den neuen Bewohnern von Ascona, die oft sehr viel Geld haben. »Aber einen Garten haben sie eben nicht mehr. Früher war es selbstverständlich, dass man einen Garten besass. Jetzt kauft man ein Haus, und wenn man aus dem Haus tritt, steht man schon auf der Strasse.«
»Das alte Ascona gibt es eben nicht mehr«, sagte, ebenfalls ein wenig melancholisch, der Maler Richard Seewald, der seit 1910 im nahen Ronco niedergelassen ist. »Das hat mit den Invasionen zu tun.«
»Den Invasionen?«
»Ja. Zuerst kamen ein paar reiche und berühmte Leute und setzten sich fest. Das war so Ende der zwanziger Jahre. Dann kam die Invasion nach 1933 vor allen Dingen natürlich der von Hitler bedrohten Menschen. Die dritte Invasion erfolgte während des Zweiten Weltkrieges. Es waren die Schweizer von jenseits des Gotthards, die nicht mehr ins Ausland reisen konnten und die begannen, sich Villen zu bauen. Die vierte Invasion … na, da sind wir ja mitten drin.«
Ein deutscher Schriftsteller, Wilhelm Schmidtbonn, hatte die »Invasionen« einmal, das war noch in den dreissiger Jahren, etwas anders formuliert: »Zuerst kamen die Vegetarier, die Grasfresser, die in weissen Hemden herumgingen und ihren Acker bebauten.
Dann kamen die Gottsucher jeder Art. Astrologen, Gesundbeter, Buddhisten, die auch eine Erneuerung der Welt – aber von der Seele her – wollten. Wie die Urmönche die Wüste, suchten sie die Einsamkeit von See und Fels, um mit dem Rätsel des Daseins zu ringen.
Dann kamen die Verherrlicher des Lebens: die Maler, Bildhauer, Dichter, Architekten – insbesondere solche, die anderswo ihr Leben nicht mehr fristen konnten.
Unter dieser unermüdlichen Sonne trugen sie auch die bittersten Entbehrungen leichter.
Zuletzt kamen die Millionäre.
Der junge, äusserst erfolgreiche Grundstückmakler Giacomo Thommen, von dem man sagt, er habe das ganze Ascona verkauft – soweit es zu verkaufen war –, sprach von Grundstückpreisen. »Ja, 1910 kostete der Quadratmeter am See noch dreissig Rappen. 1920 allenfalls ein bis zwei Franken, 1930 schon fünf Franken, 1940 zehn Franken, 1950 immer noch zwanzig bis dreissig Franken.«
»Und heute?«
»Heute gibt’s keine mehr. Wenn zufällig mal was zu verkaufen ist, bekommt man dafür, was man will. Natürlich sind überall im Tessin die Preise gestiegen, aber nirgends so wie in Ascona. Wissen Sie, die Menschen sind komisch. Sie wollen ganz einfach in Ascona wohnen, sie wollen den Poststempel Ascona auf ihren Briefen, es ist so eine Art Snobismus …«
Ob das so weitergehen würde, wollte ich wissen.
Vermutlich nicht, weil kein Land mehr da sei. Das Land sei im Wesentlichen im Besitz des Patriziats.
Des Patriziats?
Ja, das sei die öffentlich-rechtliche Körperschaft der alteingesessenen Einwohner von Ascona, die Wiesen, Land und Wald in gemeinschaftlichem Besitz verwalten. Es gebe darunter reiche und arme Leute. »Aber man sieht sie nicht. Man sieht eigentlich immer nur die Ausländer, die erst vor relativ kurzer Zeit nach Ascona gekommen sind.«
Ein Asconeser Kind beschrieb diesen Zustand in einem Schulaufsatz gar nicht so schlecht: »In Ascona siedeln sich die Bürger an und sterben dann aus. Aber Ascona vermehrt sich.«
»Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen«, beteuerte eine Dame auf der Piazza. »Kennen Sie die Geschichte von dem Gemeindepfarrer, der umherging und um Land für ein Altersheim bettelte? Er bekam auch welches geschenkt, es kam ein ganz hübsches Terrain zusammen. Jetzt will er dort ein Hotel bauen. … Was sagen Sie dazu?«
Und: »Auf den Flugplatz müssen Sie hinausfahren: eine tolle Sache! Das hat ein junger Asconese in den Jahren nach dem Krieg aus dem Nichts gezaubert. Alle Prominenten besitzen heute Flugzeuge, natürlich.«
Auf einer Party, die zu Ehren einer hübschen jungen Dame gegeben wurde – sie hatte Geburtstag –, traf ich etwa hundertfünfzig Menschen, unter anderem auch eine Amerikanerin, die ich zuletzt in Hollywood gesehen hatte. Sie wollte wissen, ob ich jemanden von den Gästen kenne: Sie kannte nur den Gastgeber, ich kannte auch nur den Gastgeber, auch das Geburtstagskind kannte nur den Gastgeber.
Es wurden viele Sprachen gesprochen, sogar Polnisch und Russisch. In einer Ecke standen drei Männer und redeten über einen Film, der noch nicht geschrieben war. An der Bar sassen drei Männer, die über einen Film redeten, den sie produziert hatten und der gerade durchgefallen war.
Jakob, genannt Köbi Flach, der Schriftsteller, der Maler, der Mann, der jahrelang das Marionettentheater Asconas leitete, sagte: »Früher ging man nach Ascona, um allein zu sein. Und heute kommt man hierher, um die gleichen Leute um sich zu haben, die man zu Hause auch um sich hat.«
Und der Anwalt Pietro Marcionni, von mir befragt über den Unterschied zwischen Ascona und Lugano oder Locarno, meinte: »In Lugano und in Locarno gibt es mehr Leute als in Ascona. Und sie haben gute Schulen, sie haben Klubs und Konzerte und manchmal sogar Theater … Ascona ist ein Dorf geblieben …«
Er schwieg, und ich sah einen Augenblick das alte Dorf vor mir, wie ich es zum ersten Mal gesehen hatte. Die stillen Gässchen, die Fischer, die ihre Netze flickten … die weidenden Kühe.
Marcionni schloss: »Ja, Ascona ist ein Dorf geblieben. Es ist eben nur sehr schön, in Ascona zu leben.«
»Ja«, sagte der Musiker Rolf Liebermann. »Wenn man heute wieder einmal nach Ascona kommt, so ist es, als sei man gestern weggefahren. Die Menschen von damals leben noch in ihren Häusern und sind die gleichen guten alten Freunde geblieben, die sie damals waren.«
»Nein«, sagte mir eine etwas nervöse Schriftstellerin. »Es wird dauernd gebaut, es wird dauernd umgebaut, wenn man verreist und kommt nach ein paar Monaten wieder, findet man nichts mehr so, wie es war …«
»Ascona ist eben kein Dorf mehr«, sagte Peter Kohler, der junge Kunsthändler. »Ja, damals wusste wirklich jeder alles von jedem. Aber heute? Die meisten Menschen hier leben ein fast anonymes Dasein, sie leben in Cliquen, sie spielen entweder Golf oder sie spielen Bridge – und ihre Bekanntschaften beschränken sich auf einige wenige … Ich glaube aber doch, dass es hier einmal ein geschlossenes Kulturleben geben wird, denn die heutigen Tessiner lassen ihre Jugend auswärts studieren, und dann kommen die Jungen vielleicht wieder zurück. Früher haben sie das nicht getan … Und daraus wird schon etwas werden. Aber ein Dorf wird Ascona nie mehr.«
Und er fragte, wie sie alle fragten: »Sie wollen über Ascona schreiben? Über das heutige? Über das gestrige? Wo wollen Sie denn anfangen?«
Am Anfang? Wann war der Anfang? Wenn man mit alten Asconesen spricht, sogar mit gebildeten Leuten, hört man nur vage Vermutungen, die Geschichte des Dorfes ginge bis ins 14. oder 15. Jahrhundert zurück.
Jemand schickte mich zu Dr. Gotthard Wielich, der »erst« seit ungefähr fünfundzwanzig bis dreissig Jahren in Ascona lebt; wenn man will, ist er also ein Neuankömmling. »Und Historiker bin ich auch nicht, oder vielmehr ich war es nicht«, sagte der hochgewachsene, weisshaarige Herr. »Ich war Jurist in Deutschland, bevor ich mich hierher zurückzog. Jetzt habe ich mich allerdings seit vielen Jahren hauptsächlich mit der Geschichte Asconas befasst …«
Er hat zahlreiche Zeitungsartikel und Broschüren geschrieben und zeigt mir, nicht ganz ohne Stolz, das Innere seines Bücherschranks, voller Aktenordner mit Material über das Tessin und seine Geschichte.
»Sie werden also die Geschichte Asconas schreiben?«, fragte ich.
»So lange werde ich nicht mehr leben. Und man findet ja immer Neues heraus. So hat man erst 1952, und zwar gelegentlich der Ausgrabung des Urnenfriedhofes, festgestellt, dass die Geschichte bis 800 vor Christus zurückgeht …«
Nach anderen Quellen soll es das Dorf Ascona bereits 4000 Jahre vor Christus gegeben haben, bevölkert von Liguriern, die von Südwesten her über Brissago ins Land kamen. Also begann schon damals die Überfremdung, über die ein halbes Dutzend Jahrtausende später so heftig geklagt werden sollte! Und sie ging lustig weiter, ja, man kann sagen, dass die ganze Geschichte des Tessins eine Geschichte unzähliger Überfremdungen ist. Um 800 vor Christus jedenfalls setzte die Einwanderung aus dem Osten ein, 400 Jahre später kamen die Kelten, die einen grossen Drang zur Unabhängigkeit besassen – im Kastell zu Locarno können noch Funde aus der Keltenzeit besichtigt werden. Ob die Tessiner ihren Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit von ihnen haben?
196 vor Christus: Die Römer eroberten Como und das südliche Tessin. Ein halbes Jahrtausend später – im Jahre 455 – kamen die Alemannen von Norden her, wurden aber von den Römern aufgehalten. 568 erfolgte der Einbruch der Langobarden, die ihre Herrschaft über das Tessin ausdehnten; besser über das, was später Tessin heissen sollte. 948 schenkte der Bischof Otto von Vercelli diese Landschaft dem Domkapitel von Mailand. Das Ende dieser Fremdherrschaft begann, als im Februar 1182 die Bevölkerung den »Schwur von Torre« leistete, mit dem sie sich verpflichtete, neue Burgen niederzureissen, die »Kollaborateure« zu bekämpfen und insbesondere die kaiserlichen Vögte da Torre zu entmachten.
1496: Die Bevölkerung schwört den Urkantonen Treue. 1500: Bellinzona begibt sich unter deren Schutz. 1530: Locarno und das Maggiatal werden eidgenössisch.
Bald aber setzte eine neue Herrschaft der Vögte ein, die keinerlei Interesse für das regierte Land oder Volk zeigten und sich darauf beschränkten, in ihrer Amtszeit von zwei Jahren so viel Geld wie möglich zusammenzuraffen. Jeder Verbrecher konnte sich loskaufen.
1798 war auch dieser Spuk vorbei. Der letzte der Vögte musste abdanken, im Tessin wurde der Freiheitsbaum mit dem Gesslerhut errichtet. Das Volk jubelte. 22. Juli 1798 Anschluss an die Schweiz. In Ascona wurden die Waffen im Gemeindehaus abgegeben, und der Waffenmeister, Paolo Pancaldi, erklärte, die Gewehre seien so verrostet, dass man mit ihnen kaum einen Schuss hätte abgeben können. Der Beschluss wurde gefasst, neue Gewehre, Bajonette, Säbel und Pulver zu kaufen und eine Ortswache von Ascona zu schaffen, die sechs Mann stark sein sollte. Um diese Zeit zählte Ascona 772 Einwohner.
Es war Napoleon, der am 19. Januar 1803 durch die sogenannte Mediationsakte den Kanton Tessin schuf. Von 1810 bis 1813 besetzten Truppen des Königreichs Italien das Tessin. Dann wurde es ruhig, abgesehen davon, dass am 3. September 1848 die Tessiner zunächst einmal die Bundesverfassung verwarfen.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wurde die Gotthard-Vereinigung gegründet, 1872 der Bau des Tunnels begonnen, der das Tessin näher an die Nordschweiz heranbringen sollte. Zehn Jahre später konnte er eröffnet werden, und trotzdem blieb ein gewisses Misstrauen gegen den Norden bestehen, auch gegen die Schweizer nördlich des Gotthards.
Schon 1869, ein Dutzend Jahre vor der Eröffnung der Gotthardbahn, war in Iwan Tschudis Reiseführer, erschienen in St. Gallen, das erste Mal der Name Ascona als Reiseziel aufgetaucht.
»Dampfbootfahrt von Magadino nach AronaRechtes Ufer (Lago Maggiore)
Man fährt von Magadino, Vira links lassend, nach Locarno und an den Ausmündungen der Maggia vorbei nach Ascona. Kleine Stadt mit altem Stadthaus und Kirche mit Gemälden von Serodine, Collegium, Seminar, den beiden Burgen S. Michele und Materno und elfbogiger Maggiabrücke, dann an den von M. Lenzuoli überragten weinreichen Ronco d’Ascona und den unbewohnten Isole di Brissago und dei Conigli (Kanincheninsel) vorbei nach dem reizend zwischen Citronen- und Orangengarten, Feigen, Granat- und Ölbäumen gelegenen Brissago mit weissen, glänzenden Häusern, in reizender Lage.«
Und in dem Baedeker des Jahres 1893 hiess es:
»Südlich von Locarno hat man einen Blick in das Val Maggia, die Maggia hat bei ihrer Mündung in den See ein grosses Delta gebildet. Weiterhin ist das westliche Ufer bis hoch hinauf mit Landhäusern, Dörfern und Kirchtürmen übersät.
In der Ecke Ascona (Kahnstation) mit Burgruine und einigen Villen, dann Ronco höher am Abhang. Weiter im See zwei kleine Inseln – Isole di Brissago.«
OEDENKOVEN UND DIE FOLGEN
Trotz der Entdeckung durch Baedeker blieben die Asconesen vorläufig unter sich, bescheidene, ruhige Menschen, immer heiter. Nie wären sie auf den Gedanken gekommen, die wenigen Fremden, die hier durchreisten, auszunützen; sie wussten gar nicht recht, ob sie für Essen und Trinken Geld nehmen sollten
Da stand etwa ein Feigenbaum, und man ermunterte einen Touristen: »Steigen Sie nur in den Baum und essen Sie, so lange Sie Lust haben, und dann zahlen Sie ein paar Centesimi …«
Jeder vertraute seinem Nächsten. Behörden? Um die Jahrhundertwende gab es kaum Beamte in Ascona und nur einen Polizisten. Ascona war ein armes, kleines Fischerdorf.
Hier beginnt unsere Geschichte. Und zwar mit dem jungen Henri Oedenkoven, dem Sohn eines reichen Fabrikanten aus Antwerpen. Er war noch nicht dreissig, aber ziemlich krank, schon zwei oder drei Jahre vorher von den Ärzten aufgegeben – damals litt er noch an Gelenkrheumatismus. Inzwischen war er von dieser Krankheit geheilt, aber unter den Kuren mit Salizyl hatte sein Magen schwer gelitten, er konnte nur noch leichteste Krankenkost vertragen und oft nicht einmal diese. Die Mutter, die ihren einzigen Sohn sehr liebte, hatte zahlreiche Badekuren finanziert, die aber nichts nützten. Da war dem jungen Mann schliesslich aufgegangen, dass die Ärzte auch nicht viel mehr wüssten als gewöhnliche Sterbliche und dass es vielleicht nicht das Dümmste wäre, es mit einer Naturheilanstalt zu versuchen. Als er nach dieser Methode einigermassen gesund geworden war, beschloss er, selbst eine Naturheilstätte zu errichten. Seine Wahl fiel auf Ascona, vielmehr auf den Berg, an dessen Fuss Ascona liegt, und der war damals für einen Pappenstiel zu haben.
Dieser Entschluss sollte den Anfang einer neuen und höchst merkwürdigen Entwicklung für das kleine Fischerdorf bilden. Man schrieb das Jahr 1899 – aber bevor die Neuankömmlinge sich installieren konnten, hatte das neue Jahrhundert begonnen.
Eine bewegte Zeit, wenn auch nicht für die Schweiz, so doch für Europa, war angebrochen. Otto von Bismarck war gestorben, und die europäische Politik wurde stark beeinflusst von Wilhelm II., dem noch jungen, dynamischen, aber launenhaften deutschen Kaiser. Mit seinem Flottenbauprogramm wollte er Englands Überlegenheit auf den Weltmeeren brechen. Noch regierte dort die alte Königin Victoria, die zumindest befremdet über das Gebaren ihres temperamentvollen Enkels war, während der Prince of Wales, der bald König Eduard VII. werden sollte, seinen taktlosen Vetter nicht leiden konnte. Frankreich litt noch immer unter der beschämenden Dreyfus-Affäre. Emile Zola hatte seinen offenen Brief »J’accuse« geschrieben und aus dem Lande fliehen müssen. In Russland konnte der Zar nur mit Terrormassnahmen regieren, es kam zu blutigen Zwischenfällen und Attentaten, die Anarchisten wurden aktiver. In Paris bereitete man eine Weltausstellung vor, deren Sensation die erste rollende Treppe sein sollte. Um die gleiche Zeit veranstalteten die Oberammergauer erstmals ihre Passionsspiele, an denen die ganze Einwohnerschaft mitwirkte. Ein Graf namens Zeppelin behauptete, ein lenkbares Luftschiff konstruieren zu können, und wurde allgemein für verrückt gehalten. Im Haag tagte die erste Friedenskonferenz zur friedlichen Beilegung internationaler Konflikte. Schon konnte man von Berlin nach Paris telefonieren, und das erste Kabel, das Amerika mit Europa verband, sollte bald in Betrieb genommen werden.
In Ascona wusste man von all dem kaum etwas, und es interessierte auch keinen Menschen.
Auch Henri Oedenkoven wollte nichts wissen von dem, was sich in der grossen Welt abspielte. Er hatte sich ja losgesagt von ihr, deswegen war er ins Tessin gekommen. Er glaubte, in der Natur und ihren kaum erschlossenen Kräften das Heil zu finden. Hier, nur hier, fern vom Betrieb war – die Wahrheit. Darum nannte er den Berg, auf dem er seine Naturheilstätte aufbauen wollte, »Monte Verità«.
Es handelte sich bei ihm keineswegs nur um rein medizinische oder therapeutische Ziele, ihm ging es um eine Gründung mit ethisch-moralischen, wenn nicht gar politischen Aspekten. Henri Oedenkoven wollte eine Art kommunistisches Gemeinwesen aufbauen, wozu er freilich Kapitalien brauchte, nämlich die seines Vaters, des Antwerpener Fabrikanten. Die Menschen, die Henri Oedenkoven um sich versammeln wollte, sollten also, wie wir in einer alten Broschüre lesen, nicht nur durch »Befolgung einfacher und natürlicher Lebensweisen entweder vorübergehend Erholung oder durch Daueraufenthalte Genesung finden, sondern auch seinen Ideen nacheifern«.
Oder wie Ida Hofmann, seine um elf Jahre ältere Freundin, es formulierte:
»in Henri’s kopf entsprang als resultat erfahrungsreicher leidensjahre der krankheit und moralischer unbefridigtheit im kreise seiner umgebung, dann als resultat immer steigender gesundheit und lebensfreude, das unter den bestehenden erwerbsgattungen eine der rechtlichsten, idealsten darstele u. zugleich mer gesundheit und schafensfreude und mer libe unter di menschen brächte, seine filfachen erfahrungen in den naturheilanstalten kuhne, just, riki, etc. liferten die sichere grundlage zu einer, auf regenerazion in körperlicher u. sitlicher hinsicht zilenden einrichtung, wo das eine gesundet, muss das andere gesunden – körper und geist sind eins.«
Wie man sieht, neuartige Ideen und eine neuartige Rechtschreibung.
Aber das war bei weitem nicht alles. Oedenkoven und seine Leute sollten den Asconesen sehr bald mancherlei Überraschungen und Aufregungen bereiten. Er liess keinen Tag vergehen, ohne im Gespräch oder gelegentlich auch in Aufsätzen, die allerdings nur in Zeitschriften erschienen, die für »Vegetabilismus« kämpften, darauf hinzuweisen, dass er mit der alten Gesellschaftsordnung zu brechen gedenke, um eine eigene neue Ordnung zu schaffen.
Das begann schon bei äusseren Dingen. Die männlichen Bewohner der Siedlung trugen knielange Hosen, hemdartige Kittel und Sandalen – keine Hüte, sondern ein Stirnband, das ihre Haare, die sie bis zu den Schultern wachsen liessen, zusammenhielt. Die Frauen gingen ähnlich gekleidet. Die Polizei – die von Locarno! – war manchmal entsetzt, wenn diese Gestalten auftraten, schritt aber nur selten ein, indem sie mehr Bedeckung verlangte. Befragt, was die Behörden hierunter verstünden, erklärte sie, insbesondere im Hinblick auf die Hosen und die Röcke der Frauen: »Je länger, desto lieber.« Ja, es gab unter diesen entschlossenen Weltverbesserern damals schon Frauen, die Hosen trugen!
Die Kostüme wurden entsprechend geändert.
Fast überflüssig zu sagen, dass in einer solchen Siedlung für Dienstboten kein Raum war. Einer der Gründer äusserte sich dazu:
»filmehr wird das sanatorium von seinen gründern mit hilfe freier mitarbeiter betrieben. Als mitarbeiter werden nur solche für di dauer behalten, di sich nach einer Probezeit als reif für unser leben erwisen haben. File waren berufen, aber ach! wi wenige auserwählt!«
Und wie stand es mit der Arbeitszeit? Es wurde viel gearbeitet, aber feststehende Arbeitsstunden gab es nicht.
»Wir binden uns mit unseren ruhetagen nicht an di im kalender forgeschribenen sonn- u. fest-tage, sondern wählen si nach unserem bedürfnis. Wir wollten keine 10tägige woche einführen. Jeder mitarbeiter hat jetzt im jahre 50 freie tage, di er sich nach eigenem ermessen wählen kann, wobei er durch seine wahl gelegenheit hat zu zeigen, ob ihm mer an der förderung der gemeinsamen sache oder seinen persönlichen interessen ligt. Zeigt sich das letztere, so wird er über kurz oder lang das schicksal der spreu erfahren.«
Freilich: »Gar mancher, der mit grosser begeisterung herkam und glaubte, den geist unserer sache erfasst zu haben, zeigte früher oder später, wi sehr er noch fon dem durch die heutige gesellschaft ihm anerzogenen knechtsein befangen war.«
Auf eines legte Oedenkoven entscheidenden Wert: Er wünschte nicht, mit sogenannten Naturmenschen verwechselt zu werden. Ida Hofmann unterstrich es bei jeder Gelegenheit:
»bite nochmals uns nicht als ›naturmenschen‹ zu bezeichnen, indem wir dise bezeichnung fast gleichbedeutend mit ›urmenschen‹ betrachten, eine bezeichnung, welche wol nur auf jene zeit bezug haben kan, da di ersten menschen di nakte, d. h. di noch unkultivirte natur u. erde befölkerten.«
Unter denen, die es eine gewisse Zeit aushielten – einige sogar ziemlich lange –, sind natürlich vor allem die Gründer zu nennen, also Oedenkoven und Ida Hofmann, der ungarische Oberleutnant Karl Gräser, der sich zu der Überzeugung durchgerungen hatte, das Töten, somit also der Soldatenstand, sei unmoralisch, ferner die deutsche Bürgermeisterstochter Lotte Hattemer, ein liebenswertes Geschöpf, das nach seiner Flucht aus dem Elternhause in zweideutigen Kneipen Kellnerin gewesen, aber rein geblieben war und meist im Freien übernachtete. Weiter gab es Ida Hofmanns attraktive Schwester Jenny, die Konzertsängerin gewesen war und sich bald mit Gräser zusammentat, und schliesslich Gustav, den jüngeren Bruder des Oberleutnants Gräser, einen ungewöhnlich hübschen Jungen, der den Kommunismus so auffasste, dass er bei anderen mitessen durfte. Wenn er etwa bei einem Handwerker etwas bestellte und der sass gerade mit seiner Familie beim Mittagessen, setzte sich Gustav einfach dazu. Einmal sah er bei einem an Oedenkovens Bewegung interessierten Literaten in Zürich ein Sofa und erklärte, hier würde er heute Nacht schlafen. Und tat es auch – sehr zum Entsetzen der gutbürgerlichen Zürcher Haushälterin.
Zu den Gründern gesellte sich die grosse Anzahl derer, die vorübergehend mitmachten, dann aber wieder verschwanden. Von ihnen seien nur erwähnt ein junger holländischer Möbeltischler, »Vegetabilier«, Kommunist, Anarchist, Deserteur. Ferner ein siebzehnjähriger Sattler und Naturarztgehilfe aus Berlin; die zwanzigjährige Tochter eines russischen Getreidemaklers, die in Zürich studiert hatte; ein deutscher Matrose, der schon überall gewesen war; ein Böhme oder Slowene, von dem niemand richtig wusste, was er vorher getrieben hatte. Schliesslich sogar auch ein Schweizer, der aus Zürich gekommen war, um sich kurieren zu lassen, dann aber irgendeine Funktion als Gärtner oder Buchhalter bei der Gruppe übernahm. Er hatte draussen in der Welt schon zahlreiche Posten bekleidet und war, wie er selbst zugab, aus Langeweile dem Christian Science beigetreten. »Was soll man denn treiben?«, stöhnte er, und so war er wohl auch aus Langeweile nach Ascona gekommen.
Aus Langeweile. Man konnte es auch so nennen. Die meisten waren nach Ascona gegangen aus dem vielleicht vagen, aber keineswegs falschen Gefühl, irgend etwas stimme nicht mehr mit der Welt. Das, was wir später die gute alte Zeit nannten, war eben durchaus nicht so in sich gefestigt, wie man glaubte oder glauben wollte. Überall wuchs die Schar der Unzufriedenen. Überall spürten die Menschen, dass nicht alles zum besten stand. Doch vermutete wohl noch keiner, dass es zu einer so ungeheuren Explosion kommen sollte wie dem Weltkrieg.
Eines steht fest: auch das Leben auf dem Monte Verità war damals nicht leicht. Es gab zum Beispiel keine Wasserleitung, es gab nicht einmal Quellen – oder man hatte sie noch nicht entdeckt. Vorläufig musste das Wasser mit ziemlicher Mühe von unten heraufgeschafft werden.
Die Siedler mussten überhaupt alles selbst machen, da sie auch mit Geld nichts zu tun haben wollten – Geld bedeutete Kapitalismus, war also verwerflich, vermutlich der Ursprung allen Übels. Man war entschlossen, »aus eigener Kraft« zu leben.
Kein Wunder, dass durch solch ständige Mühsal die Nerven der Beteiligten litten. Es kam häufig zu Krächen, insbesondere wenn manche meinten, Oedenkoven und Ida Hofmann, die beträchtliches Geld in die Sache gesteckt hatten, sollten ihre Anteile doch der Allgemeinheit »verschreiben«. Oedenkoven dachte nicht daran; so kommunistisch war der Sohn des Antwerpener Fabrikanten nun wieder nicht.
Natürlich konnten die Naturmenschen, die keine sein wollten, nicht sehr lange auf dem Monte Verità hausen, ohne dass sie zu einer Art Sensation für die nähere und weitere Umgebung wurden. Die Bevölkerung von Ascona kümmerte sich vorläufig nicht allzu sehr um diese Vegetarier und verstand auch nicht, was sie wollten. Ein junger Mann aus Zürich, der an der neuen Bewegung journalistisch interessiert war und später eine Broschüre über die Bewohner des Monte Verità schreiben sollte, verspeiste einmal ein Kotelett in einer Wirtschaft unten in Ascona. Jemand, der ihn auf dem Monte Verità gesehen hatte, ging zur Wirtin und sagte ihr, dieser Gast sei auch ein solcher Vegetabilist, er habe ihn kürzlich mit Oedenkoven gesehen. Sie widersprach, der Gast ässe doch, wie man sich überzeugen könne, Fleisch.
Für den Asconesen war das kein Argument. »Dann wird er eben so ein Vegetabilist sein, der Fleisch isst!«, erklärte er. Und damit war die Sache für ihn erledigt.
Natürlich hatte für die Vegetarier die Frage, was sie nun essen oder nicht essen durften, grösste Bedeutung. Schliesslich war Oedenkovens gründlich verdorbener Magen der Ausgangspunkt der ganzen Bewegung gewesen. Unter seiner Führung wurde schliesslich angeordnet, man dürfe nicht nur kein Fleisch, sondern auch kein Salz essen. Als jener Journalist darüber schreiben wollte, protestierte Ida Hofmann:
»befor si ire behauptung, dass unsere salzlose narung ungesund sei, in di öffentlichkeit bringen, möchte ich si auf einen irrtum aufmerksam machen, indem si meinen, wir genössen kein salz in unsern speisen. Sie vergessen, dass wir das reinste aler salze, das organische salz unserm körper zufüren, nur das giftige, anorganische salz meiden wir – si haben recht, wenn si di salzlose narung des fleisch- oder gemischessers für ungesund halten, den dise brauchen es, zur anregung der ferdauung irer an eiweiß u. fet überreichen narung, abgesehen dafon, dass ja die meisten ihrer speisen erst durch zusaz fon salz und gewürzen genissbar werden, nicht aber bei natürlichen pflanzenprodukten, di nicht nur im natürlichen zustand schon tadellos schmekken, sondern auch wen si auf eine weise (im reformkocher) gekocht, bei der kein wasser zugesetzt, und darum nichts von den närwerten bei der zubereitung ferloren get, dass salz bei dieser zubereitsweise (für vegetabilier wolgemerkt) gift sein muß, beweist wol das peinigende, zerende durstgefül nach genuss gesalzener speisen, u. dass unsere kochsalzfreie narung nicht ungesund sein kan, beweist wol unser gesundheitszustand, dermit ausnahme fileicht kirurgischer eingriffe bei bein- oder armbrüchen, ni eines arztes bedarf und uns, sobald die zeit natürlicher ausscheidung der früher angesammelten krankheitsstofe forüber ist, körperlich und geistig gleich leistungsfähig erhält.«
Ihre Gedanken klangen damals revolutionär – dreissig Jahre später waren sie selbstverständlich.
Wenn sich die Asconesen zunächst wenig um die Männer und Frauen auf dem Monte Verità kümmerten, so taten das die Fremden um so leidenschaftlicher. In Locarno und Lugano vernahmen sie Schauermärchen und gaben sie schnell und phantasievoll ausgeschmückt weiter. So hiess es, dass die Leute auf dem Berge nackt herumliefen, was aber nur auf ein Sonnenbad zutraf, in dem man sich ganz unbekleidet aufhalten konnte. Am meisten aber erregte es die Fremden, dass Männer und Frauen auf dem Monte Verità zusammen lebten, die nicht miteinander verheiratet waren.