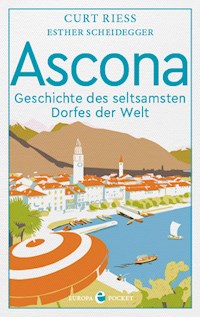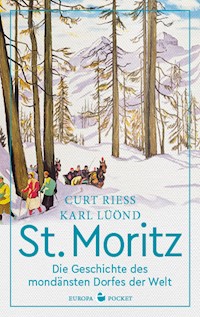Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Biografie des großen Schweizer Unternehmers zu seinem 50. Todestag. Mit einem Vorwort von Karl Lüönd. Gottlieb Duttweiler war der Gründer der Migros, dem Markt der Schweizer. Von den ersten Wagen, mit denen die Schweiz befahren wurde, um die Lebensmittel direkt an die Verbraucher zu bringen, bis zum Einstieg in die Politik als Gründer der Partei Landesring der Unabhängigen: Curt Riess beschreibt auf überaus unterhaltsame Weise das Leben eines Unternehmers, dessen erste Sorge stets dem "kleinen Mann" galt und der die Lebensmittelbranche revolutionierte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottlieb
Duttweiler
Eine Biografie von Curt Riess
© 2012 by Europa Verlag AG Zürich
Redaktion: Team Europa Verlag
Alle Rechte vorbehalten.
eISBN: 978-3-905811-38-4
Auch als Printausgabe erhältlich: ISBN: 978-3-905811-32-2
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]
G O T T L I E B D U T T W E I L E R : K A U F M A N N , A U S S E N S E I T E R , V I S I O N Ä R
Es gibt keinen Schweizer, der im 20. Jahrhundert mehr bewegt hat als Gottlieb Duttweiler (1888-1962). Die Migros, die er 1925 gegründet hat, ist vom Aussenseiter-Betrieb zum genossenschaftlich organisierten Grosskonzern geworden: 25 Milliarden Schweizer Franken Umsatz, 83 000 Mitarbeitende (Stand 2010)! Aber das ist nicht alles. Für Schweizerinnen und Schweizer ist Migros ein Lebensstil. Eine Zeitlang sah es sogar danach aus, als hätte die pragmatische Migros-Ideologie vom «sozialen Kapital» die Kraft, den viel gesuchten «dritten Weg» zwischen Kapitalismus und Kollektivismus zu gehen.
Nicht schlecht für ein Projekt, das aus dem Scheitern geboren wurde!
Die Migros war in der Tat ein Projekt der letzten Chance. Als Gottlieb Duttweiler seine fünf umgebauten Ford-Lastwagen auf die Reise schickte – mit nur sechs umsatzstarken und unverderblichen Artikeln an Bord: Zucker, Kaffee, Teigwaren, Reis, Kokosfett, Seife – war er 37 Jahre alt, ein gestrandeter Kaufmann. Nach einem Konkurs und einem missglückten Auswanderungs-Experiment war er mittellos aus Brasilien zurückgekehrt. In der Schweiz erlebte er die Demütigung, dass ihn der Verband Schweizerischer Konsumvereine in Basel nicht einmal als einfachen Einkäufer und Disponenten anstellen wollte. Die Migros-Idee war seine letzte Chance. «Wenn dieses Unternehmen nicht gelingt, fange ich nichts Neues mehr an,» sagte er damals zu Rudolf Peter, einem seiner frühesten Weggefährten. Rudolf Peter war der Buchhalter und schloss sich dem Abenteuer an. Die Abmachung lautete: «Sie machen in Draufgängertum und ich in Bodenständigkeit.»
Was war eigentlich die Migros-Idee? Eigentlich war es eine Banalität: mehr Umsatz dank weniger Gewinn. Duttweiler reduzierte die Detailhandelsmarge um die Hälfte des damals Handelsüblichen und vertraute darauf, dass die dadurch ermöglichten niedrigen Preise die beste Werbung seien. Dank kleinem Sortiment, schnellem Warenum schlag und dem Verzicht auf teure Ladenmieten konnte er die Unkosten niedrig halten. Vergleichsweise viel Geld investierte er in die Werbung.
Gottlieb Duttweiler hatte früh eine kometenhafte Karriere gemacht. Schon als Lehrling beim Importgrosshändler Pfister & Sigg wurde er auf die Reise zur Kundschaft geschickt. Als Neunzehnjähriger ging er nach Le Havre, um dort als Handelsagent den Kaffeehandel kennen zu lernen. Resolut baute er direkte Beziehungen zu Produzenten in Brasilien auf, umging den Zwischenhandel und realisierte günstige Direktlieferungen. 1914 etablierte er sich für seine Lehrfirma in Genua und wurde ein Warenschieber im grossen Stil. Die Gewinne explodierten. Duttweiler stieg zum Partner auf, doch dem Senior Nathan Sigg wurde es unheimlich. 1917 stieg er aus, fortan hiess es «Pfister & Duttweiler». Letzterer liess in Rüschlikon eine Prachtvilla bauen, die er alsbald wieder verlor. Denn 1920 war Pfister & Duttweiler pleite, weil die gehamsterte Ware dramatisch an Wert verlor. Mit seinem letzten Geld kaufte Duttweiler eine Zuckerrohrfarm in Brasilien und fuhr auch dieses Unternehmen an die Wand.
Diese brutalen Erfahrungen mit dem real existierenden Kapitalismus prägten nicht nur den Menschen Duttweiler und dessen Lebensstil. Fortan lebte er persönlich auf bescheidenem Niveau; legendär war sein winziger Fiat Topolino, in dem der grosse und breite Mann nur mit Mühe Platz fand. In der Bahn fuhr er grundsätzlich 3. Klasse.
G U E R I L L A - T A K T I K E N I N D E R Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T
Zürichs Hausfrauen verstanden Duttweilers Botschaft auf Anhieb. 1925 herrschten Lohnabbau und Arbeitslosigkeit. Die Kosten der Lebenshaltung waren in der Schweiz höher als in jedem anderen europäischen Land. Die Kundinnen strömten zu den Verkaufswagen. Zu den Hauptgründen seines Erfolgs mit der Migros gehört die Kommunikation. Das erste Flugblatt, mit der die Migros AG. ihre Verkaufswagen ankündigte, tönte militärisch: «Entweder siegen die lieben alten Einkaufsgewohnheiten der Frau, die Reklame und die Schlagwörter – oder der erhoffte Zuspruch stellt sich ein, diesfalls können wir die Preise möglicherweise noch ermässigen, andernfalls müssen wir diesen ernsthaften Versuch, den Konsumenten zu dienen, aufgeben.» Später etablierte Duttweiler seine eigenen Medien, weil ihn die bürgerliche Presse schnitt. «Die Tat» wurde ab 1935 zum Vehikel seiner politischen Ambitionen; ab 1942 begleitete «Wir Brückenbauer» die zur Genossenschaft umgewandelte Migros. In der Kampf- und Aufbauzeit der dreissiger Jahre war Duttweiler sein eigener Werbetexter. Der Kaufmann als Polemiker und Stilist. «Tat»-Chefredaktor Erwin Jaeckle Urteilte «Seine Sprache war knorrig und drastisch. (…) Viele seiner Einfälle und Aussprüche waren überraschend, ob er sie scharf oder sarkastisch, geneigt oder geisselnd formulierte. Immer dachte Duttweiler in augenfälligen Gleichnissen.»
Da ihm, dem von Markenartiklern und Konkurrenten heftig bekämpften Aussenseiter die bürgerlichen Medien verschlossen waren, erfand er zwei Guerilla-Taktiken der Öffentlichkeitsarbeit: die Vorträge und die Prozesse. Sigmund Widmer bezeichnete Duttweiler als den «letzten Volkstribun der Vor-Fernsehzeit.» Oft wurden seine Veranstaltungen ohne Thema angekündigt, einfach mit der Schlagzeile: «Gottlieb Duttweiler spricht!» Er bediente sich immer der Mundart und verfertigte seine Gedanken beim Reden. Oft schweifte er ab, manchmal brauste er auf und nahm sich schnell wieder zurück. Er konnte seine Stimme modulieren: mal ganz leise, mal polternd laut. Schlagfertig ging er auf Zwischenrufe und Widerspruch ein. Damit zog er die Zuhörer auf seine Seite.
Besonders raffiniert war Duttweilers Öffentlichkeitsarbeit über die Gerichte. Lustvoll beschimpfte er seine Gegner, zum Beispiel als «Trust-Halunken». Wenn Ortsbehörden seine Verkaufswagen behinderten, setzte er sich über Verbote hinweg und riskierte die Busse, gegen die er natürlich Einspruch erhob. Er verletzte am laufenden Band und vorsätzlich die Markenrechte der Konkurrenz, etwa als er Eigenmarken von täuschender Ähnlichkeit erfand: «Eimalzin» gegen «Ovomaltine», «Kaffe Zaun» gegen «Kaffee Hag» und – schon fast dadaistischer Sprachwitz: das Waschmittel «O-Hä» («ohne Henkel», womit der allmächtige Persil-Konzern gemeint war.) In den dreissiger Jahren kam es zu zahlreichen Zivil- und Strafprozessen sowie Verwaltungsverfahren gegen Migros und Duttweiler. Er profitierte von allen, gleichgültig, ob er verurteilt wurde oder nicht, denn er machte syste matisch das Tribunal zum Medium. Seine Auftritte vor den Schranken boten die ideale Gelegenheit zur Verbreitung seiner Kernbotschaft: Markenartikel sind zu teuer, die Migros bietet gleich Gutes viel günstiger. Mit diesen Prozessen zwang er die Zeitungen, die ihn sonst mehrheitlich boykottierten, über ihn und seine Inhalte zu berichten. Und in den Köpfen der Menschen blieben nicht die Urteile haften, sondern der Eindruck, da kämpfe ein mutiger Aussenseiter gegen die geballte Macht der in Kartellen befangenen Konzerne.
S E I N E F E I N D E V E R H A L F E N I H M Z U M E R F O L G
Vom ersten Tag an war die Migros harten Anfeindungen ausgesetzt. Der Einzelhandel und die mit ihm verbundene Markenartikelindustrie boykottierten den Aussenseiter, wo sie konnten. Es wurde Druck auf die Gemeindebehörden ausgeübt, den Verkaufswagen die Bewilligungen zu entziehen. Wo dies nicht möglich war, wurden die Gebühren massiv erhöht. Jeder Angriff und jede Schikane mobilisierte Sympathien und machte die Migros sowie ihre Leistungen bekannt. Schnell wuchs das System über Zürich hinaus. Es wurden feste Läden eingerichtet. 1931 waren es deren 44 gegenüber 33 Verkaufswagen. Längst war das Sortiment erweitert. Aber das Kartell der Einzelhändler und der mit ihnen verbündeten Markenartiklern hinderte Fabrikanten an der Belieferung der Migros, wo sie konnten. Das zwang den Händler Duttweiler, selber Fabrikant zu werden. Zuerst kaufte er die «Alkoholfreie Weine und Konservenfabrik A.-G. Meilen» und machte zum Ärger der Bierbrauer deren Süssmost populär – wie immer mit abenteuerlich niedrigen Preisen, die die Umsätze hochpeitschten. Ähnlich verfuhr er kurz darauf mit Schokolade, Joghurt, Butter und Konserven. Rund um die Migros gruppierten sich Produktionsbetriebe, welche die Handelskette von den Druckversuchen der Hersteller unabhängig machten.
Arbeitslosigkeit, Kaufkraftschwäche und Preissenkungen bedrängten den Schweizer Detailhandel in den frühen dreissiger Jahren. Dieweil blühten Warenhäuser, Einheitspreisgeschäfte und Grossverteiler, weil sie professioneller einkauften und ihre Geschäfte rationeller führten. In der Politik formierte sich eine grosse Koalition gegen die zwei besonders erfolgreichen und besonders verhassten neuen Handelsformen: die Migros und die überwiegend von Juden geführten Warenhäuser, wobei in der Polemik gegen die letzteren das antisemitische Grundrauschen unüberhörbar war. Der Gewerbeverband, die Konsumgüterindustrie und die traditionell mit der Konsumbewegung verbundenen Sozialdemokraten bildeten zusammen mit den an hohen Milchpreisen interessierten Bauern den Rückhalt für das «Filialverbot», das der Bundesrat 1933 erliess. Das war ausgerechnet der Zeitpunkt, da die erfolgreiche Migros zum Sprung in die französische und in die italienische Schweiz ansetzte. Das mit einer Sondersteuer verbundene «Filialverbot», das der Bundesrat im Wege des Notrechts erliess, war zwar verfassungswidrig, behinderte aber die Expansion von Migros und Warenhäusern für die nächsten zwölf Jahre.
Aber auch dieser von langer Hand vorbereitete Nackenschlag vermochte die Migros-Idee nicht zu stoppen. Duttweiler wich auf neue Geschäftsfelder aus und eröffnete den Hotelplan als schweizerische Antwort auf die erfolgreichen faschistischen Freizeit- und Reiseprogramme wie «Kraft durch Freude» und «Dopo lavoro». Hotelplan war Duttweilers erstes genossenschaftliches Projekt und half der darnieder liegenden Schweizer Hotellerie, indem neue Gästeschichten mobilisiert wurden. Die bezahlten zwar weniger, kamen aber in Massen. Auch die Gründung der Migros-Klubschule war eine durch das Filialverbot verursachte Ausweichbewegung auf andere Geschäftsfelder.
P O L I T I K E R A U S N O T W E H R
Das Schlüsselerlebnis mit dem willkürlichen und rechtswidrigen Filialverbot trieb Gottlieb Duttweiler in die Politik. Eigentlich habe er diesen Schritt nie tun wollen, sagte er später. «Man kann von niemandem verlangen, dass er die politischen Auffassungen und namentlich radikale oppositionelle Auffassungen seines Makkaroni-Lieferanten teilt. Die Gefahr ist sehr gross, dass man deshalb Kunden verliert. Dass man Kunden gewinnt durch die Politik, kann ich kaum glauben.»
Aber Duttweilers ausserparlamentarische Opposition gegen den amtlich verordneten Wachstumsstopp hatte nicht gefruchtet. Obwohl 230 000 Schweizerinnen und Schweizer eine Petition unterzeichneten, blieb die Migros dem Filialverbot unterstellt. Die tückische Begründung der Regierung lautete, Migros sei eben eine Aktiengesellschaft. Die genossenschaftlich organisierten Konsumläden dagegen blieben vom Filialverbot verschont. 1935 trat der Migros-Gründer mit einer «Liste der Unabhängigen» zu den Nationalratswahlen an. Im Kanton Zürich wurde die Migros-Partei mit einem StimmenanTeil von 18,3 Prozent auf Anhieb die zweitstärkste politische Kraft. Die Unabhängigen zogen, Duttweiler voran, mit sieben Mann in die Volkskammer ein. Für schweizerische Verhältnisse war dies ein Erdrutsch, zumal der «Landesring der Unabhängigen», wie sich die Bewegung später nannte, weder über eine nennenswerte eigene Presse verfügte noch vom Frauenstimmrecht profitieren konnte.
Über die Jahre gesehen blieb Gottlieb Duttweilers Wirkungsgrad als Politiker weit hinter dem des Handelsmanns zurück. Seine Themen waren Landesversorgung, Vorratshaltung, die schweizerische Hochseeschifffahrt und immer wieder die Stärkung der Flugwaffe. Interessanter als ihre politischen Theorien waren die Persönlichkeiten, die sich dem Landesring anschlossen. Die bürgerliche Presse höhnte zwar über «Duttweilers Million» (womit die siebenköpfige Parlamentsfraktion gemeint war: «Eine Eins und sechs Nullen»). Aber die Gruppe bestand aus hochkarätigen Leistungsträgern und Individualisten: Da war der erste Swissair-Direktor Balz Zimmermann, der berühmte Arzt Franklin Bircher, Erfinder des «Bircher-Müeslis», der Landwirtschaftsexperte Heinrich Schnyder und andere. Dem Landesring waren auch bekannte Persönlichkeiten wie der Schriftsteller Felix Moeschlin, der Historiker Jean Rodolphe von Salis und andere Prominente gewogen.
D I E G R O S S E G E S T E D E S V E R S C H E N K E N S
1941 erregte Gottlieb Duttweiler landesweites Aufsehen, als er seine Migros AG in eine Genossenschaft umwandelte und die AnTeilscheine an seine Kunden verschenkte. Über die Motive ist viel gerätselt worden. Die von der Publizitätsmaschine der Migros später immer wieder verbreitete Version vom heroischen Verzicht und vom Tatbeweis für die Anhänglichkeit an das altschweizerische Genossenschaftsprinzip greift zu kurz. Abgesehen davon, dass der Multimillionär Duttweiler zahlreiche der Migros vor- und nachgelagerte Firmen in seinem Privateigentum behielt: Verlässliche Selbstzeugnisse deuten darauf hin, dass Duttweiler, was den Ausgang des Zweiten Weltkriegs anging, weit weniger optimistisch war als andere erfolgreiche Gründer jener Zeit wie Walter Haefner, Emil Frey (Autos), Charles Vögele (Mode), Ueli Prager (Mövenpick-Restaurants) und andere, die sich schon während der Kriegsjahre Positionen und Standorte für den erwarteten Aufschwung nach der für sicher gehaltenen Niederlage Nazideutschlands sicherten.
Duttweiler war gezeichnet von einer historischen Erfahrung, die in der Schweiz nie richtig zur Kenntnis genommen worden war. 1932 hatte er in Berlin eine Handelsfirma übernommen, die ebenfalls mit fahrenden Verkaufsläden operierte und recht erfolgreich war. Nach Hitlers Machtergreifung häuften sich die Schikanen und Übergriffe gegen dieses Unternehmen. Auch Hitler war damals eifrig bemüht, sich bei den kleinbürgerlich-gewerblichen Massen anzubiedern. Als schliesslich Kampfbund- und SS-Truppen die an den Haltestellen wartenden Kunden belästigten, zog sich Duttweiler Ende 1933 unter Verlusten aus Berlin zurück. Gottlieb Duttweiler scheint lange daran geglaubt zu haben, dass Hitler den Krieg gewinne. Verbürgt ist seine Äusserung, es werde in einem solchen Fall dem Regime schwerer fallen, Hunderttausende von kleinen Genossenschaftern zu enteignen als einen einzigen Millionär.
« D E R G R O S S E R E C H T H A B E R »
Als Unternehmer wie als Politiker hat Gottlieb Duttweiler früher als andere neue Tendenzen nicht nur gespürt, sondern handelnd vorweggenommen. Er spürte die wirtschaftlichen und emotionalen Bedürfnisse der Massen in der Nachkriegszeit mit beinahe gespenstischer Genauigkeit voraus: Reisen, Kultur und Musik, Bildung, Kulturvermittlung, und er antwortete mit konkreten Projekten und Angeboten: Hotelplan, Ex Libris, Klubschule, Kulturprozent. Wie sein langjähriger Weggefährte Werner Schmid bezeugt, hatte Duttweiler schon 1937 die Idee eines Umwelt- und Sozial-Labels. Er nannte es etwas unbeholfen «Treue-Hand-System» und wollte damit Warenangebote kennzeichnen, die zu fairem Preis, in guter Qualität und unter anständigen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden. Am Ende seines Lebens – und das war 1962, als die schweizerische Hochkonjunktur erst so richtig anlief, war sich Duttweiler auch schon über die Wachstumsund Umweltprobleme der modernen Zivilisation im klaren, wie Sigmund Widmer bezeugt: «Duttweilers ganze Bedeutung wird uns erst klar, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass er auch die grosse Wende unseres Jahrhunderts, den Bewusstseinswandel für die Problematik des unkontrollierten Wachstums, früher als andere vollzog. Sein Plan des ‚Forum Humanum’, die Vereinigung ‚gescheiter Leute’, war ja nichts anderes als die Vorwegnahme eines ‚Club of Rome’, der dann zehn Jahre später (…) jenen Bedenken nachging, die Duttweiler in seinen letzten Lebensjahren so sehr umgetrieben hatten. Immer wieder musste man feststellen, rückblickend habe Duttweiler recht gehabt. Duttweiler sei der grosse Rechthaber der Schweiz des 20. Jahrhunderts gewesen.»
K L E I N E C H R O N I K D E S S C H E I T E R N S
Bei weitem nicht alles, was Gottlieb Duttweiler in die Hand nahm, ist ihm geglückt. Der Markterfolg des Detailhändlers war und ist auch im globalen Vergleich einzigartig. Man wird weltweit nur wenige Unternehmen finden, die – wie die Migros im Jahre 2010 – 27,3 % AnTeil am Markt des Lebensmittel-Detailhandels aufweisen. Im Non-Food-Bereich sind es auch noch 13 %. Vor diesem Hintergrund fällt doppelt auf, dass die Migros-Firmen in den vom Kerngeschäft entfernten Branchen zwar mehrheitlich gut bis ausgezeichnet unterwegs sind, aber bei weitem nicht an die Marktanteile herankommen wie im klassischen Lebensmittelhandel. Migrol ist zwar ein führender Anbieter auf dem Schweizer Treibstoffmarkt. Aber das grosse Geschäft mit den Autos haben andere gemacht. Die Migros-Bank zählt rund 800 000 Kunden, doch ist ihre Bedeutung in der Schweizer Bankenwelt nicht entfernt vergleichbar mit derjenigen der Migros im Lebensmittelhandel. Die migros-eigene Versicherung ist 1999 durch Verkauf der «Secura» an den Generali-Konzern aus dem Markt gegangen. Andere Projekte haben sich von den Intentionen des Gründers weit weg entwickelt, etwa Ex Libris, eine früher durch profilierte literarische und musikalische Programme auffallende Ladenkette mit Versandhandel. Nach schmerzlicher Gesundschrumpfung ist sie heute ein beliebiger, wenn auch in der IT-Anwendung führender Anbieter für Bestsellerware. Auch das Verlagswesen gehört nicht zu den Erfolgsfeldern der Migros. Das Projekt einer progressiven Boulevardzeitung («Die Tat») scheiterte. Auch im Bereich der Computer und der Unterhaltungselektronik haben andere Handelsketten die führenden Plätze übernommen.
Preisführerschaft, Ideenreichtum und kämpferisches Engagement, das die Migros in ihrem Kerngeschäft über die Jahrzehnte hinweg ausgezeichnet hat, wurden noch in anderen Bereichen schmerzlich vermisst: etwa im ganzen Textilbereich, aber auch beim Schnellimbiss-Wesen, wo es McDonalds gelang, an über 150 Standorten – nicht selten in der Nähe von Migros-Märkten – Fuss zu fassen. Misslich endete noch zu Duttweilers Lebzeiten der Versuch, mit einer eigenen Raffinerie und einer eigenen Hochseeflotte das Preisdiktat der Erdöl-Multis auf dem Benzinmarkt zu brechen.
An ihre Grenzen stiess die Migros auch wiederholt, als sie versuchte, ihren phänomenalen Erfolg in der Schweiz auf ausländische Märkte zu übertragen. Über den verlustreichen Rückzug aus Berlin in den dreissiger Jahren haben wir schon gesprochen. 1954 lud das Handels- und Wirtschaftsministerium Gottlieb Duttweiler zu einem Besuch in die Türkei ein. Die darauf hin gegründete «Migros Türk» entwickelte sich erfreulich, wurde aber 1975 an eine türkische Trägerschaft abgegeben, die den Namen und Teile des Systems bis heute benützt. In den neunziger Jahren scheiterte die Expansion nach Österreich, die nicht zuletzt vorangetrieben worden war, um den inzwischen vergrösserten und modernisierten migros-eigenen Produktionsbetrieben neue Märkte zu eröffnen. Als der Kooperationspartner in Schwierigkeiten geriet, hätte die Migros nur eine Alternative zum verlustreichen Ausstieg gehabt: die Übernahme der maroden «Konsum»-Kette. Dies wurde reiflich erwogen, schliesslich aber abgelehnt. In späteren Prozessen wurde klargestellt, dass die Migros von Anfang an über die finanzielle Lage ihres österreichischen Partners getäuscht worden war. Der Verlust für die Migros aus dem Österreich-Abenteuer wurde auf 300 Millionen Franken beziffert – viel Geld, aber bei der enormen Finanzkraft und Stabilität des Konzerns verkraftbar.
K A M P F B I S Z U L E T Z T
37 Jahre lang hatte Gottlieb Duttweiler die Migros begleitet. In dieser Zeit entwickelte sie sich vom Aussenseiter-Projekt in Zürichs Arbeiterquartier zum mächtigen Mischkonzern und einem der grössten Arbeitgeber der Schweiz – mehr noch: zu einer politischen und sozialen Kraft, die den Genossenschaftsgedanken neu interpretierte und die mit beispielloser Energie Einfluss nahm auf die Entwicklung der schweizerischen Konsumlandschaft und des kollektiven Lebensstils in der Nachkriegszeit. Gottlieb und Adele Duttweiler, die kinderlos geblieben waren, gaben ihr Lebenswerk an ihre Kunden und Mitbürgerinnen weiter.
Die offizielle Schweiz dankte es ihm zu Lebzeiten nicht. Die Anfeindungen hörten nicht auf. In den 50er Jahren musste Duttweiler heftig darum kämpfen, sich mit dem Migros-Prinzip der grossen Mengen und der kleinen Margen in den hoch regulierten Milchmarkt einschalten zu dürfen. 1958 gründete er – schon wieder in Vorwegnahme eines später verallgemeinerten Trends – ein Institut für Ernährungsforschung, um die Wende von der fettreichen, sättigenden zur gesunden, bekömmlichen Ernährungsweise zu stützen. Als Politiker konnte er die in den dreissiger Jahren errungenen Erdrutsch-Siege im Mief der fünfziger Jahre nicht wiederholen. 1949 war er zwar überraschend zum Zürcher Ständerat gewählt worden, doch schon 1951 wurde er von einem Gegenkandidaten verdrängt. 1955 unterlag er in einer Kampfwahl dem nachmaligen Bundesrat Willy Spühler. Vier Jahre später lehnten Duttweilers eigene Gesinnungsfreunde vom «Landesring der Unabhängigen» seine erneute Kandidatur ab. Dies empfand Gottlieb Duttweiler als kränkende Zurückweisung. Sigmund Widmer, der ihm in dieser Zeit wohl am nächsten stand, bezeugt, dass sich Duttweiler damals als ein Vereinsamter und Angefochtener verstand und unter der anhaltenden Ablehnung durch die offizielle Schweiz litt. Dazu kamen zunehmende gesundheitliche Störungen: Kreislauf, Altersbeschwerden, Übergewicht.
Auch mit seinen Nachfolgepläne für die Migros kam Gottlieb Duttweiler nicht zum erhofften Ziel. Sein Wunschkandidat, der Ernährungsexperte und nachmalige Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen, war nicht erreichbar. Dann bemühte er sich intensiv um den damals führenden Schweizer Handelsdiplomaten Hans Schaffner, der später ebenfalls Bundesrat wurde. In einem neun Seiten umfassenden, handgeschriebenen Brief bot Duttweiler ihm die Nachfolge an der Spitze der Migros an. Schaffner bestätigte später auf Anfrage, Duttweiler habe ihm dieses Angebot sogar mehrmals vorgelegt. Weil er aber lieber die im Gang befindliche Umstellung der schweizerischen Handelspolitik und die Gründung der Europäischen Freihandelszone (EFTA) begleiten wollte, sagte Schaffner ab. Gewählt wurde schliesslich Duttweilers Neffe, der Basler Nationalrat Rudolf Suter.
D I E P L Ö T Z L I C H E F R E U N D L I C H K E I T D E R F E I N D E
Als Gottlieb Duttweiler am 8. Juni 1962 nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren an den Folgen eines Herzanfalls starb, sendete das Schweizer Radio während zwanzig Minuten besinnliche Klaviermusik. Eine solche Programmänderung wurde sonst nur bei schweren Katastrophen angeordnet. Nun schienen die Feindseligkeiten, mit denen Linke und Rechte den Wirtschaftspionier und politischen Aussenseiter während vier Jahrzehnten eingedeckt hatten, wie weggewischt. Die letzte Ehre, die ihm nun von allen Seiten erwiesen wurde, war für viele Gegner auch die erste, die sie ihm in der Öffentlichkeit gönnten. Den offiziellen Nachruf im Nationalrat hielt Duttweilers alter Widersacher, der führende Sozialist Walther Bringolf. Er hob das unbequeme Wesen des Verstorbenen hervor, aber auch dessen Hartnäckigkeit und die positiven Folgen seines Wirkens.
Unversöhnlich blieb hingegen die «Neue Zürcher Zeitung», die ihren bösartig-brillanten Nachruf mit folgenden Worten beschloss: «Er war eine Gründernatur auf dem Boden und nach dem Geschmack der klassenlosen Gesellschaft, die ihren Stil noch nicht gefunden hat.» Und am anderen politischen Ufer Urteilte der kommunistische «Vorwärts»: «Wir sehen im Gründer der Migros keinen Genossenschafter, sondern den typischen Repräsentanten des neuen liberalen Kapitalismus. Wohlverstanden: Es handelt sich hier nicht um den altmodischen, ausbeuterischen und skrupellosen Kapitalismus, sondern um den sozialen Kapitalismus jener amerikanischen Firmen, die seit langem begriffen haben, dass ein Unternehmen, das heutzutage sich ausbreiten will, nicht um das Gesetz des Dienstes herumkommt und dass man das Publikum für sich gewinnen muss.»
Tief erschüttert und in ehrlicher Trauer vereint waren dagegen Hunderttausende von Namenlosen in der ganzen Schweiz. Schon der Andrang zur Zürcher Trauerfeier sprengte jeden Rahmen. Die Zeremonie wurde in die vier grossen Altstadt-Kirchen von Zürich simultan übertragen und von Tausenden besucht.
*
Erst in der zweiten Hälfte seines Lebens hat sich der Erfolgsautor Curt Riess (geb. 1902) mit schweizerischen Themen beschäftigt. 1952 heiratete er die Schauspielerin Heidemarie Hatheyer und zog mit ihr nach Scheuren auf der Forch. Frau Hatheyer wurde zu einer der prägenden Gestalten im Ensemble des Zürcher Schauspielhauses, und ihr Mann schrieb populäre Sachbücher, dies nach einer bewegten und von den kriegerischen Zeitläuften erschütterten Laufbahn.
Der klein gewachsene, oft ziemlich mürrische und fordernde Herr mit den weissen Haaren war eine bekannte Erscheinung zwischen dem Schauspielhaus am Pfauen und der Kronenhalle, wo er immer Tomatensuppe bestellte. Curt Martin Riess (eigentlich Steinam, den Namen Riess bekam er von seinem Adoptivvater) war, kaum 21jährig, Sportreporter in Berlin geworden, dann Theater- und Filmkritiker in den wilden Zwanzigerjahren. Später erzählte er immer, er habe den Nazis schon nach deren ersten Aufmärschen nicht getraut und nie vergessen, dass er aus einer jüdischen Familie stammte. Über Prag floh er nach Paris, wo er bei Pierre Lazareffs «Paris-Soir» unterkam. Riess war eine phänomenale Sprachbegabung. Er schrieb auch in Französisch, später in Englisch, zeitweise insgesamt in fünf Sprachen. Lazareff schickte ihn 1934 als Korrespondenten nach den USA. Von Hollywood aus bediente Curt Riess etwa zwei Duzend europäische Zeitungen und Illustrierte, schrieb aber auch für «Esquire» und «Saturday Evening Post». Seine Artikel diktierte er in rasendem Tempo; mit den Honoraren habe er zeitweise fünfzehn Leute ernährt, erzählte er mir einmal. Während des Krieges kam er als Kriegsberichterstatter und, wie er nicht ohne Stolz durchblicken liess, auch mit geheimdienstlichen Aufträgen nach Europa zurück. 1945 etablierte er sich als freier Schriftsteller in New York, erlebte aber die Blockade in Berlin und wurde ein gesuchter Serienautor bei den damals in hoher Blüte stehenden deutschen Illustrierten.
Aus diesen journalistischen Produktionen entstanden Curt Riess’ erste Bücher – es sind im Laufe seines langen Lebens genau 99 geworden. Grosse Beachtung fanden etwa seine Goebbels-Biografie. Andere biografische Arbeiten verfasste er über Gustaf Gründgens, Jacqueline Kennedy und Romy Schneider. Seine Filmgeschichte («Das gab’s nur einmal …») erschien in vielen Auflagen. Curt Riess wurde zum gesuchten Bestsellerautor; nebenher schrieb er auch Romane und Drehbücher. Auch für Auftragsarbeiten war er sich nicht zu schade. Als er in die Schweiz gezogen war, erschienen Bücher über die Swissair, Ascona, St. Moritz, das Schauspielhaus («Sein oder Nichtsein») und das Café Odeon, die in der Regel vorab als Serien in der «Weltwoche» erschienen. Für das Buch über Gottlieb Duttweiler habe er den alten Herrn oft getroffen, erzählte mir Curt Riess, den ich in den 80er Jahren als Theaterkritiker für die «Züri Woche» gewinnen konnte. Damals waren gerade seine polemischen Bücher gegen das moderne Theater erschienen, deren Titel schon alles sagen: «Theaterdämmerung oder das Klo auf der Bühne», «Theater gegen das Publikum». Wir entschieden uns damals für Riess, weil die «Züri Woche»mit Erscheinungstag am Mittwoch immer erst als letzte aller Zeitungen die aktuellen Theaterkritiken bringen konnte; Premièrentag war immer der Donnerstag. Also hatten wir keine andere Wahl als aufzufallen. Curt Riess verriss lustvoll die zeitgeistigen Produktionen des Schauspielhauses und scheute vor handfesten Intrigen nicht zurück, insbesondere nachdem seine Frau aus dem Ensemble der Pfauenbühne geworfen worden war.
Unter den Sachbuchautoren genoss der besessene Vielschreiber Curt Riess etwa die gleichen Reputation wie Johannes Mario Simmel oder Heinz G. Konsalik unter den Literaten: eine Mischung aus Verächtlichkeit und Neid. Bei meiner Arbeit für die kurze Biografie «Gottlieb Duttweiler – Eine Idee mit Zukunft» (Meilen, 2000) hatte ich das Privileg, die Quellen zu prüfen und die Duttweiler-Biografie von Curt Riess besonders kritisch zu lesen. Ich war überrascht und beeindruckt von der Genauigkeit und der Faktentreue, mit der die effektvolle, oft szenisch imaginierte Schreibe des alten Routiniers unterlegt war. Auch Peter P. Riesterer, der inzwischen verstorbene Vertraute und Nachlassverwalter von Duttweiler, bestätigte respektvoll dieses Urteil.
So ist es denn sinnvoll, dass diese weit ausgreifende Biografie für eine neue Generation erschlossen wird. Was Curt Riess mit dem Story-Instinkt des altgedienten Boulevard-Reporters schreibt, ist schweizerische Wirtschaftsgeschichte von hervorragender Bedeutung. Denn wie gesagt: Gottlieb Duttweiler hat die Schweiz im 20. Jahrhundert stärker verändert als jeder andere.
Karl Lüönd, 30. Mai 2011
WER WAR DIESER MANN?
An Stelle eines Vorworts
Als ich in den Jahren 1956 bis 1958 Gottlieb Duttweilers Biografie schrieb, beschäftigte mich immer wieder die Frage: Wie soll das enden? Wo? Wann? Ich schrieb damals:
«Es ist sehr schwer, unter ein Buch über Gottlieb Duttweiler den Schlussstrich zu ziehen, weil er selbst bisher noch keinen Schlussstrich gezogen hat. Immer frische Ideen, immer neue Kämpfe. Und das wird wohl erst aufhören, wenn er nicht mehr ist.»
Er lief damals sozusagen ständig seiner eigenen Biografie – und seinem Biografen – davon. Kaum glaubte ich aufhören zu dürfen, da ging auch schon das Telefon. Er hatte etwas Neues unternommen. Etwas, das ihm wichtiger erschien als alles, was er bisher getan hatte!
Dies war überhaupt sein hervorstechendstes Charakteristikum: dass er sich in jeden neuen Kampf, in die Verwirklichung jedes neuen Projektes mit der Überzeugung warf, gerade dieses neue Projekt, gerade dieser Kampf, müsse auf jeden Fall noch durchgeführt werden, gerade der augenblicklich bevorstehende Kampf sei von besonderer Bedeutung und müsse, was immer es koste, beendet und natürlich siegreich beendet werden. Alles, was er geschafft hatte, schien ihm in solchen Augenblicken von minderer Bedeutung. Nur das, was vor ihm lag, was noch geschafft werden musste, war von Wichtigkeit.
«… wird wohl erst aufhören, wenn er nicht mehr ist.» Und nun ist er nicht mehr.
Und mir will scheinen, als sei es trotzdem schwerer denn je, einen Schlussstrich zu ziehen. Weil sein Werk sich weiterentwickelt, weil es – längst vor seinem Tod – Eigenleben gewonnen hatte, weil vieles von dem, was er erst plante oder auch nur als Möglichkeit ahnte, über Nacht Wirklichkeit geworden ist. Und weil so täglich neue Wirklichkeiten entstehen.
Wie sie werten? Wie sie in das Lebenswerk des nun Toten eingliedern? Ach, und er ist nicht mehr da, um mir mit Rat zur Seite zu stehen, um zu helfen, um einen Weg zu bahnen durch dieses Dickicht von Ideen, Plänen, aus dem Boden gestampften vollendeten Tatsachen, Ereignissen, das sein Leben war.
Er war es, der mir von Anfang an half; und sei es auch nur, indem er etwa sagte: «Sie müssen nicht auf das hören, was ich Ihnen erzähle. Sie müssen mit meinen Gegnern sprechen. Die sehen das ganz anders.»
Ich sehe noch vor mir, wie es begann. Der Verleger hatte den Vorschlag gemacht, ich solle ein Buch über Duttweiler schreiben. Ich? Ich wusste doch so wenig über ihn …
Zwei oder drei Tage später kamen ein paar Kisten ins Haus. Sie barsten von Material über Duttweiler, über die Migros, über den Hotelplan, über die Kämpfe, die er hatte durchstehen müssen, es war auch viel Politisches dabei und von ihm selbst Geschriebenes. Ich las und las -und war verzagt. «Aber es ist doch schon alles über ihn und von ihm geschrieben worden!» sagte ich.
Es schien in der Tat so. Es war aber nicht so, wie ich begriff, als ich ihn, wieder ein paar Tage später, kennenlernte. Das war in einem Restaurant in Bern, er kam gerade von einer Session, er war ja Nationalrat, hatte sich als solcher mit unzähligen Problemen zu beschäftigen, die mit den zahllosen Migros-Projekten und Geschäften überhaupt nichts zu tun hatten. Auch das noch! dachte ich.
Es schien, als ahne er, was mir durch den Kopf geht, denn plötzlich sah er von seinem Teller auf, starrte mich durch seine Brillengläser belustigt an und meinte: «Ich beneide Sie nicht, dass Sie ein Buch über mich schreiben sollen!» Dann lächelte er spitzbübisch und fuhr fort: «Ich habe einen guten Titel für das Buch. ‹Mehr Glück als Verstand› müssen Sie es nennen.»
Es vergingen Monate, die ich damit verbrachte, zu lesen, zu lesen, zu lesen. Ich wälzte mich durch ganze Berge, will sagen, Kisten von Material. Das Erstaunliche, ich möchte fast sagen Einmalige: ich erfuhr jede Stunde etwas Neues – ich meine nicht das Sachliche, sondern etwas Neues über Gottlieb Duttweiler, über den Menschen. Er erschien mir in immer neuer Gestalt, in immer anderem Licht. Wer ist dieser Mann? fragte ich mich mehr als einmal.
Ich dachte, als ich mich nun entschlossen hatte, das Buch zu schreiben, es wäre das beste, wenn ich ihn einmal bei der Arbeit sehen könnte. Schriebe ich über einen Boxer, würde ich mir seine Kämpfe anschauen; wenn ein Sänger die Hauptfigur meines Buches wäre, würde ich ihn mir so oft wie möglich anhören. Warum sollte ich einen Kaufmann nicht in seinem Büro aufsuchen?
Ich ging also zur Migros, einer Firma, von der ich damals so gut wie nichts wusste, es sei denn, dass sie mit Lebensmittelhandel zu tun hatte. Es hätte auch irgendein anderer Tag sein können. Duttweiler hatte ja gesagt: «Kommen Sie, wann Sie Lust haben!» Er war bereit, mich zu empfangen, wann immer es durchaus nötig sein würde, mir die Archive des Migros-Genossenschafts-Bundes vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, vor allem auch die Publikationen seiner Gegner, und mir Gespräche mit seinen Mitarbeitern zu ermöglichen.
Er wünschte mir guten Tag und hatte mich dann sofort vergessen. Er war vermutlich so, wie er jeden Tag ist.
Und das war imponierend genug. Was mir sogleich auffiel was eigentlich jedem auffallen musste, der Duttweiler gegenüber sass: er sah gar nicht so aus, wie man sich eigentlich einen grossen Unternehmer vorstellt. Ja, wie sah er denn eigentlich aus? Zuerst hätte man auf einen Mann mit einem «geistigen Beruf» getippt, vielleicht einen Anwalt, einen Arzt. Aber da war noch etwas anderes, etwas schwer Definierbares. Auch wenn Duttweiler ernst blieb -und es handelte sich ja fast durchweg um ernsthafte Geschäfte, die er abzuwickeln hatte-, schien er zu lächeln. Irgend etwas in seinem Gesicht lächelte, war ständig belustigt, stand gewissermassen über der Situation. Also ein Philosoph? Oder ein Komödiant? Immer wieder musste ich daran denken, wie ähnlich er gewissen Schauspielern sah, die ihre Rolle spielten und mit einigem Amusement beobachteten, wie sehr die Leute mitgingen, wie sie Rolle und Wirklichkeit verwechselten … Der Mann sah imponierend aus. Was um ihn herum war, wirkte weit weniger imponierend. Duttweiler sass keineswegs in einem eleganten oder auch nur würdigen Direktions- oder Verwaltungsgebäude. Um zu ihm vorzudringen, hatte ich durch einen schmalen Hof gehen müssen, nein, nicht gehen, mich schlängeln müssen, denn der Hof stand voll von Lieferautos, es roch nach allen möglichen Lebensmitteln; Arbeiter und Arbeiterinnen, Chauffeure machten sich zu schaffen, liefen vorbei; es war so voll in diesem relativ schmalen Hof, in dem Waren aus- und eingeladen wurden, dass man nicht einmal das kleine Schild «Verwaltung» vor einem der bescheidenen Eingänge entdecken konnte. Auch das Büro Duttweilers war etwas enttäuschend – wenigstens für mich; es war nicht gerade so, wie man sich das Arbeitszimmer eines Magnaten vorstellt, der über ein riesiges industrielles Reich herrscht. Ein mittelgrosser Raum mit einem Schreibtisch, ein paar Stühlen, einem Konferenztisch – aber keineswegs dem üblichen grossartigen mit den vielen Sesseln drum herum, sondern einem ganz einfachen Tisch, wie man ihn injedem Arbeiterhaushalt finden könnte. Alles in Esche. Um in das Allerheiligste zu gelangen, das so gar nicht wirkte wie ein Allerheiligstes, musste man andere Büros durchqueren, kein distinguiert möbliertes Vorzimmer, wie man es erwartet hätte; da war kein livrierter Diener, der einen hereinführte. Dafür öffnete sich die Tür unaufhörlich, und irgendwelche Mitarbeiter kamen höchst unzeremoniell herein, brachten Papiere, machten eine Meldung und verschwanden wieder.
Er war gerade dabei, einen Artikel für den «Brückenbauer» zu verfassen. Er diktierte ruhig, langsam, aber sehr fliessend, machte nur selten eine Pause, um zu überlegen. Wenn dies geschah, murmelte er leise vor sich hin: «Ja, ja – Hm, hm.» Er verbesserte sich kaum. Der Satz stand schon beim ersten Anhieb. Er sprach leise, aber sehr deutlich.
Ich fragte ihn, ob er sich nicht vorher irgendwelche Notizen mache. Duttweiler lächelte flüchtig. «Selten. Meine Sachen gehen ja doch durch die Zensur.» Er meinte, dass seine Mitarbeiter jeden Artikel noch einmal lesen und jede von ihm angegebene Zahl, jedes Faktum kontrollieren müssten.
Inzwischen war ihm die Post vorgelegt worden. Er erklärte:
«Ich erhalte ungefähr dreissig Briefe am Tag … Ich meine persönliche Briefe, die ich beantworten muss.»
In der Post dieses Tages befand sich die Einladung zu einem Vortrag, der Hinweis auf eine Verabredung mit irgendeiner Persönlichkeit, eine Aufforderung, in einem Seminar in Wiesbaden über die Automation der WarenverTeilung zu sprechen, der Brief eines amerikanischen Freundes, der Brief eines Presseagenten aus Paris, ein Schreiben, in dem Duttweiler aufgefordert wurde, etwas für das Frauenstimmrecht in der Schweiz zu tun, ein anderes mit der Bitte, sich zur Bergbauernfrage und über die St. Gallische Bauernhilfskasse zu äussern. Er sollte nach Bonn kommen. Er sollte nach Boston kommen, um eine Auszeichnung in Empfang zu nehmen. Wollte er ein Hotel in Wien übernehmen? Wollte er in Brasilien ein Migros-Unternehmen starten? Einer kleinen Gemeinde zu einem neuen Pfarrhaus verhelfen?
Duttweiler steckte sich eine neue Zigarre an. Er bestellte auch Kaffee, aber vermutlich nur, weil ich da war. Er blätterte in einer grossen Zahl von Dossiers: «Wenn ich anderen erst erklären soll, was sie tun müssen und warum sie es tun müssen, erledige ich es doch viel schneller selbst.» Er paffte: «Das ist natürlich falsch bei einem Siebenhundert-Millionen-Konzern – dass ich so viel selbst mache … Meine Arbeit sollte es sein, den anderen Arbeit zu machen …»
Jemand brachte Duttweiler ein grosses schmales Heft mit festem Einband. Er blätterte es aufmerksam durch: «Die täglichen Umsätze … Das ist immer Balsam … In der letzten Woche stiegen die Umsätze um fünfunddreissig Prozent – wegen der Hamsterei. Übrigens interessant: In Zürich hamstert heute niemand mehr. Dagegen geht es jetzt erst in den kleinen Dörfern und den weit abgelegenen Tälern, im Tessin und im Wallis los. Es handelt sich hier gewissermassen um Spätzündung … Die Schweiz hat eben Geld. Wenn man arm ist, wird man nicht so leicht hysterisch …»
A propos Dörfer. Duttweiler holte einen Brief des Polizeidepartements des Kantons Schwyz vom 3. November heraus, der sich mit der Frage befasst, ob die Migros-Verkaufswagen im Kanton zuzulassen seien oder nicht. Der zuständige Regierungsrat war dagegen …
«Trotzdem beginnen wir in zwei Wochen. Es wird schwierig werden. Denn im Kanton Schwyz kennt jeder jeden, und da wird viel Druck ausgeübt. Aber es wird in Schwyz nicht anders kommen als anderswo auch. Zuerst werden die Frauen eine Stunde weit laufen, um dort, wo sie nicht beobachtet werden, zu kaufen, und dann wird es ihnen zu langweilig werden, und dann …»
Ständig kamen Mitarbeiter ins Zimmer, um über Ungarn zu sprechen. Das Wort Ungarn hing an diesem Tag in der Luft. Es war der schicksalshafte 22. November 1956, die Ungarn hatten sich gegen die sowjetische Gewaltherrschaft erhoben. Die Migros hatte bereits die ersten Lastzüge mit Lebensmitteln nach Ungarn geschickt. Die Aktion war sozusagen ganz spontan entstanden, in einer Konferenz der Geschäftsleiter im Zürcher Kongresshaus. Jeder der anwesenden Herren hatte hundert Franken gestiftet, im Nu waren zweitausendfünfhundert zusammen. Duttweiler sagte dann für die Migros fünfzigtausend zu. Schon am Montagabend waren die ersten beiden vollbeladenen Lastzüge nach Budapest unterwegs.
Zwei, drei Tage später kamen Schweizer Studenten zu Duttweiler mit dem Vorschlag, Lastwagen nach Ungarn zu schicken, um Kinder aus den Städten herauszuholen, in denen der Bürgerkrieg tobte. Angeblich sollten die Russen sich dazu bereit erklärt haben, unter einer Bedingung: Für jedes Pfund Lebendgewicht eines Kindes, das aus Ungarn herausgeholt würde, sollte ein Pfund Fleisch oder Mehl oder Fett geliefert werden …
Duttweiler konnte niemals feststellen, ob dieses grauenhafte Angebot wirklich so gemacht wurde. Über die Lastautos, die er nach Ungarn sandte, sagte er nur, das habe mit dem Geschäft nichts zu tun: «Man kann doch Menschen nicht verhungern lassen!» meinte Duttweiler. «Auch nicht aus politischen Gründen! In Bulgarien, zum Beispiel, hungern die Menschen. Wenn wir jetzt den Kontakt abbrächen, dann sagen sich die Bulgaren: ‹Aha, der Westen interessiert sich nicht mehr für uns! Wir müssen uns also den Russen für immer verkaufen, um nicht zu verhungern!›»
Übergangslos kam er auf Bern zu sprechen, auf die Regierung, auf das Parlament, dem er als Nationalrat angehörte, auf seine Kämpfe für die Rechte der kriegsgeschädigten Auslandschweizer, die nach seiner Ansicht zu kurz gekommen waren. Warum tat Bern nichts für diese Auslandschweizer? Er war sogar in Bonn gewesen und hatte die Frage aufgeworfen. Deutsche Zeitungen hatten darüber berichtet, zum Teil in etwas sensationell entstellter Form. Die Schweizer Presse hatte das aufgegriffen. Gerade in diesen Tagen wurde wieder viel über und gegen Duttweiler geschrieben.
«Ich kann das alles gar nicht lesen! Wo nähme ich die Zeit her?» In der Tat, es hätte mehr als eines Lebens bedurft, um alles zu lesen, was über Duttweiler in den letzten dreissig Jahren geschrieben worden war. Über seine unzähligen Gründungen. Über seine Anregungen und Projekte. Über die Migros und den Landesring, über seine Prozesse gegen Trusts und die ersten Selbstbedienungsläden, über seine Vorratswirtschaft im Krieg und den Hotelplan und die Kleidergilde, über die BeTeiligung an einer Filmgesellschaft und die Gründung eines Buchklubs.
«Übrigens machen wir in einer Woche einen neuen Laden auf, einen Migrosmarkt in Oerlikon. Sie müssen hinkommen! Ganz Oerlikon wird dort sein!»
Da der elfte Stadtkreis, dessen Zentrum Oerlikon ist, 75.000 Einwohner zählt, erbat ich eine Durchlasskarte.
Duttweiler drückte nicht auf einen Knopf, diktierte nichts durchs Telefon oder ins Mikrofon, sondern schrieb ein paar Worte auf seine Visitenkarte. «Zeitersparnis», kommentierte er lächelnd. Ein anderer Mitarbeiter stand in der Tür. Es handelte sich um Hotels, die Duttweiler mieten wollte, um Ungarnflüchtlinge aufzunehmen. Das war gar nicht so leicht. Im Augenblick gab es zwar viele leerstehende Hotels, die aber bis Ostern wieder geräumt werden sollten, da dann der Fremdenverkehr einsetze.
Die Regierung in Bern wollte ursprünglich nur zweitausend Flüchtlinge in die Schweiz lassen. Duttweiler protestierte wie viele andere auch: «Man kann keine Menschenkontingente einführen wie bei Uhren oder Käse.»
Duttweiler las bereits wieder in einem anderen Dossier, telefonierte, diktierte, qualmte und trank den Kaffee, der inzwischen gekommen war.
Dies war nicht meine erste Begegnung mit Duttweiler. Aber ich hatte bisher viel weniger mit ihm gesprochen, als mir über ihn erzählen lassen. Ich dachte, wenn man ein Buch über Duttweiler schreibt, ist es ja wohl auch gut, wenn man hört, was die Leute über ihn zu sagen haben. Die Leute? Irgendwelche Leute. Ich wollte ja keinen wissenschaftlich fundierten Gallup Pool machen. Ich wollte ja nur mal herumhören.
Eine Hausfrau sagte mir: «Duttweiler? Ich kaufe gern in den Migros-Läden. Die Preise sind billiger als anderswo. Mein Mann ist zwar dagegen. Er ist Taxichauffeur. Sie verstehen.., die Sache mit den gelben Taxis …»
Ich verstand damals noch nicht, was sie meinte, später umso besser.
Eine Angestellte in einem Frisiersalon erklärte: «Ich kaufe nichts bei der Migros. Mein Mann würde es nicht erlauben …» Warum? Der Mann hatte einen Onkel, und der hatte ein Lebensmittelgeschäft.
Eine städtische Beamtenfrau: «Dem haben wir hier in der Schweiz viel zu verdanken. Ausserdem habe ich das Gefühl, dass es Duttweiler mit den Menschen gut meint, besonders mit den ‹Kleinen›, die vorher überhaupt nicht gefragt wurden …» Eine Bauernfrau: «Ich würde mich schämen, bei der Migros einzukaufen. Da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ausserdem berücksichtigt er bei seinen Grosseinkäufen die einheimische Landwirtschaft viel zu wenig und bevorzugt das billigere, wenn auch qualitativ viel schlechtere Ausland …»
Man sollte nach alledem vermuten – und ich zumindest hatte es ja auch anfangs geglaubt -, dass Duttweiler der Verkäufer von Lebensmitteln sei. Aber da hörte ich ihn gerade einen längeren Artikel zu Ende diktieren, der mich eines Besseren belehrte.
«Der Mensch mit seinem Drang nach persönlicher Freiheit, Frieden und staatlicher Unabhängigkeit ist des Sieges sicher. So sicher, wie jedes Terrorregime immer wieder sein Ende gefunden hat. Darauf kommt es an: Einen festen Glauben an diese elementaren Kräfte der Selbstbehauptung braucht es, um zurückzuschrecken vor den blutigen Auseinandersetzungen zwischen Ideologien, wie zum Beispiel der Dreissigjährige Krieg, der die Bevölkerung in manchen Gegenden Mitteleuropas auf ein Drittel reduzierte … Ich erinnerte mich, dass ein Architekt mir erzählt hatte: «Ich schätze seine Zivilcourage. Der Glaube an die gute Sache gibt ihm den Mut zu kämpfen. Lasst doch den Kerl mal drei Jahre lang regieren, gebt ihm die Chance, die Schweiz ein paar Jahre lang in die Finger zu nehmen, dann wird sich herausstellen, was er politisch kann.»
Duttweiler war bereits bei einem neuen Artikel angelangt – und bei einer neuen Zigarre. «Seit langem verkaufen wir verschiedene Früchte und Gemüse, auch einzelne Haushalt-Artikel nicht in Cellophan, sondern in Polyäthylen(Plastik)-Säcken verpackt. Die Selbstbedienung verlangt ja nach solchen Fortschritten in der Verpackung. Der ausserordentliche Umsatz hilft die Kosten tragen.
Solche Plastiksäcke werden von unseren Hausfrauen, nach Herausnehmen des Inhalts, als ‹Frischbeutel› verwendet. Wenn sie nun einige Stücke aufbewahrt haben, übergeben sie wohl die hinzukommenden dem Kehrichtkübel.
Was bei uns nicht einmal mehr Aufbewahrungswert hat, ist aber in anderen Ländern geradezu eine Kostbarkeit!
Die Präsidentin eines türkischen Hausfrauenvereins fragte mich, als ich kürzlich in der Türkei war: ‹Würden die Schweizer Hausfrauen die Plastik-Säckli wirklich ohne Entgelt abliefern?› War meine Antwort richtig: ‹Es widerstrebt der Schweizer Hausfrau, etwas, das einen Wert darstellt, wegzuwerfen. Es ist ihr wohler dabei, wenn sie es zu weiterer Verwendung ohne Entgelt zurückgeben kann. Und wenn sie weiss, dass es anderen Frauen dient, so würde die grosse Mehrzahl die Säcklein zurückbringen … ›»
Ich blätterte in meinen Notizen. Was war mir nicht alles über Duttweiler berichtet worden …
Eine Chefsekretärin in einem Reklame-Beratungsbüro in Basel hatte mir erzählt: «Mir persönlich hat Duttweiler das Leben ungeheuer erleichtert und vereinfacht mit seiner Migros. Ich arbeite acht Stunden und mehr am Tag, habe einen Haushalt und zwei Kinder. Ich muss mit einem relativ kleinen Budget auskommen und habe zudem sehr wenig Zeit zum Einkaufen. Allein die Tatsache, dass die Migros über Mittag geöffnet ist, hat für Leute, die im Büro arbeiten, schon einen grossen VorTeil. Wie Duttweiler als Mensch ist, als Politiker, darüber habe ich nie nachgedacht, als Erfinder der Migros finde ich ihn grossartig, und als wir ein Jahr in Paris lebten, wo ich in den Läden oft anstehen musste, wurde meine Sehnsucht nach der Migros immer grösser.»
«Es gibt auch andere Stimmen über mich», sagte Duttweiler und lächelte wieder sein unergründliches und doch so selbstironisches Lächeln. «Sie müssen mit meinen Feinden sprechen … »
Ich hatte auch mit seinen «Feinden» gesprochen. Mit einem Kaufmann, der Duttweiler bezichtigte, die Kleinhändler «aufzufressen». Mit einem jungen Grafiker, der erklärte, Duttweiler sei politisch ein Narr. Mit einem Medizinstudenten, der die Behauptung aufstellte, Duttweiler gebe zwar vor, die Trusts zu bekämpfen, bilde aber selbst den gefährlichsten Trust.
Natürlich gab es auch andere «Feinde», die man nicht so einfach interviewen konnte. Die grossen Konzerne und Trusts, mit denen er sich in ständigem Kampf befand: Henkel, Sunlight, Unilever, Geigy, Nestlé, Maggi; die zahllosen Teigwaren-, Speisefett-, Zucker- und Seifenfabriken, die Grandhotels, die Schweizer Konsumgenossenschaften – und natürlich ein grosser Teil der Presse. Gerade die Verantwortlichen jener Presse, die Duttweiler ständig angriff, wurden recht schweigsam, als ich versuchte, von ihnen zu erfahren, was sie nun eigentlich gegen Duttweiler zu sagen hätten.
Immerhin hatte ich mit genug «Feinden» gesprochen, und das verschwieg ich Duttweiler auch nicht.
«Und was haben sie gesagt?» Der alte Mann war plötzlich enorm interessiert. «Sie müssen mir das unbedingt erzählen!»
Während ich vor ihm sass, entstand ein Bild Duttweilers für mich – es war etwa so, wie wenn man einen Film ins Entwicklungsbad wirft und langsam Einzelheiten der Fotografie Gestalt annehmen -, das Bild eines sehr aktiven Mannes, eines Unternehmers, der nicht nur Kaufmann war, eines Politikers, der nicht nur Politik machte. Eines Mannes, dem die Kultur sehr am Herzen lag und der doch die Zuckerpreise auf dem Weltmarkt bis auf eine Dezimalstelle genau im Kopfe hatte. Einer, der auf ein grosses Lebenswerk zurückblicken konnte, aber es vorzog, vorwärts zu schauen. Er arbeitete schon wieder an einem neuen Plan, einem ganzen Komplex von neuen Plänen. Und noch bevor dieses Buch zu Ende geschrieben war, sollte sich die Öffentlichkeit mit dieser neuen Sache befassen: Nicht nur die schweizerische, sondern die europäische Öffentlichkeit. Denn diesmal plante Duttweiler nicht, die Schweizer Hausfrauen mit billigen Waren zu versorgen, sondern Europa mit billigerem Benzin. Diesmal gedachte er, den gigantischen internationalen Öltrusts, die er schon gelegentlich beunruhigt hatte, eine wirkliche Schlacht zu liefern …
Er ahnte nicht, dass dies sein schwerster Kampf werden, er ahnte nicht, dass es sein letzter sein und dass er ihm das Herz brechen würde.
«Aber bis dahin wird noch etwas Zeit vergehen», meinte er. «Ein paar Monate. Vielleicht sogar ein paar Jahre … »
Und ich überlegte, vielleicht zum hundertsten Male: Wer ist dieser Mann? Ein Querulant oder ein Volksbeglücker? Ein Publizist oder ein Organisator? Ein Kaufmann oder ein Politiker? Und ich begann dieses Buch nicht zuletzt, um Klarheit zu schaffen.
Ich nahm mir vor, den ganzen Duttweiler nachzuzeichnen. Nicht nur den Kaufmann oder den Politiker, den Publizisten oder den Organisator, den Volksbeglücker oder den Querulanten, den sie im Volksmund den «Lebensmittelheiland» nannten.
Damals schrieb ich: Ein Buch über Duttweiler kann nur dann einen Sinn haben, wenn der Leser nicht nur dies oder jenes über ihn erfährt, was er bisher vielleicht noch nicht wusste oder nicht so genau wusste, wenn also nicht nur eine Anhäufung von Statistiken und volkswirtschaftlichen Erklärungen gegeben wird, oder eine Folge von politischen Dissertationen … sondern das Bild eines Menschen. Sondern: der ganze Duttweiler.
Und nun ist er also nicht mehr da, um mir zu helfen. Dafür waren seine Freunde und seine Mitarbeiter da. Und vor allem seine Witwe Adele, die mit geradezu übermenschlicher Ruhe und Sachlichkeit über die letzten Jahre berichtete. Sie hatte einen kleinen Taschenkalender zur Hand, in den sie alles eingetragen hatte. «Er mochte es gern, wenn ich mir Notizen machte … »
Ich habe die unzähligen Nachrufe gelesen, die des Inlandes und des Auslandes. Ich habe noch einmal mit dem einen oder anderen seiner Gegner gesprochen, von denen jetzt, da er unter der Erde liegt, viele nicht mehr seine Gegner gewesen sein wollen. Wie ich ihn kannte, hätte er das gar nicht so gern gehabt. Es störte ihn nie, dass man auf ihn schimpfte. Es störte ihn nur, wenn man ihn, besser: wenn man sein Werk – denn nur darauf kam es ihm an – totzuschweigen versuchte. Dann konnte er recht unangenehm werden – und unter Umständen auch handgreiflich.
Nun, es wird noch lange dauern, bis sich Stillschweigen über ihn und über sein Werk breiten wird. Und wenn der Versuch, der hier unternommen wird, das Buch über ihn zu Ende zu bringen, über seine letzten Jahre und Tage zu berichten, dazu beitragen kann, diesen Zeitpunkt, der ja einmal kommen muss, weil er für alle und alles einmal kommt, hinauszuschieben, dann ist die Mühe nicht umsonst gewesen.
Erster Teil
DER KAUFMANN
Erstes Kapitel
DUTTWEILER HAT EINE IDEE
Gottlieb Duttweiler kam, knapp sechsunddreissigjährig, im Frühling 1924 aus Brasilien nach Zürich zurück, wo er aufgewachsen war und eine dramatische Niederlage erlitten hatte. Zürich, damals noch eine kleine Grossstadt von rund 200 000 Einwohnern, hatte sich doch ziemlich verändert. Dabei war Duttweiler nur ein Jahr fort gewesen.
Eigentlich hatte er in Brasilien bleiben wollen – sein ganzes Leben lang oder doch mindestens die entscheidenden Jahre des Lebens. Vielleicht später, wenn er einmal viel, viel Geld verdient hatte, würde er nach Zürich zurückkommen. Später, wenn dort vergessen war, was sich im Jahr vor seiner Abreise abgespielt hatte. Wenn er es selbst vergessen haben würde … Vergessen, dass er eigentlich eine gescheiterte Existenz war, als er seine Heimatstadt verliess.
Und nun? Was hatte sich geändert?
Es waren schöne Frühlingstage, die ihn begrüssten. Aber er hatte in dieser Zeit nicht viel Sinn für das Wetter, den stillen See, die blühenden Bäume. Er musste Geld verdienen. Er musste sich selbst und seine Frau ernähren. Er suchte – zum erstenmal in seinem Leben -eine Stellung. Er hatte vorher nur eine einzige Stellung gehabt, und in die war er hineingewachsen. Vom Lehrling über den Angestellten und Juniorpartner zum vollgültigen Teilhaber in der Firma. Nun musste er also von vorn anfangen. Das war nicht leicht.
Duttweiler war damals ein recht gut aussehender Mann, der jünger als seine Jahre wirkte, mit klugem, aufgewecktem Gesicht, mit Augen, die sehr unbefangen und ein wenig herausfordernd in die Welt blickten, mit einem unternehmungslustigen Schnurrbart. Er war recht schlank – ein Resultat des Jahres in Brasilien, in dem er über dreissig Pfund abgenommen hatte.
Duttweiler bekam also keine Stellung, und er sagte sich: «Wenn ich schon von vorn anfange, kann ich auch für mich selbst anfangen!» Was er auch tat.
Von vorn anfangen … Für sich selbst anfangen … Er hatte eigentlich nur eines gelernt: Nahrungsmittel kaufen und verkaufen. Es war also logisch, dass er kein Schuhgeschäft oder Kino aufmachte.
In Brasilien hatte er unter anderem Kaffee gepflanzt. Er hatte festgestellt: Es dauerte fünf Jahre, bis man einen Kaffeestrauch abernten konnte. Fünf Jahre. So lange war er gar nicht in Brasilien gewesen. Immerhin wusste er, was der Pflanzer für das Kilo Kaffee bekam, nachdem er fünf Jahre lang den Strauch gepflegt hatte.
Eines Tages stand er vor einem Lebensmittelgeschäft in der Zürcher Altstadt und stellte fest: Ein Kilo Brasil-Kaffee kostete Franken 4.80. Das war fast das Dreifache von dem, was der Pflanzer für das Produkt seiner fünfjährigen Arbeit bekam.
Da stimmte doch etwas nicht! Hier wurde doch jemand übervorteilt. Hier wurde der Kunde, der Konsument übervorteilt, aber auch der Produzent.
Duttweiler stellte das fest. Und das liess ihn nicht mehr zur Ruhe kommen. Er wollte mehr, er wollte alles wissen, was damit zusammenhing. Es war nicht schwer für ihn, herauszufinden, dass die Betriebsaufschläge, die sogar Konsumgenossenschaften nach Abzug der Rückvergütung erhoben, in den letzten Jahren von 21,3 % auf 27,1 % und schliesslich auf 31,6 % gestiegen waren. Dann waren sie wieder auf 27,8 % gefallen.
Das bedeutete also, dass bei jedem Franken, der im Geschäft eingenommen wurde, achtundzwanzig Rappen für das Verkaufen eingerechnet wurden. Und das war zuviel.
Da musste man doch irgend etwas tun!
Kaffee in der Schweiz war zu teuer. Alle Lebensmittel waren
zu teuer! Und das in einer Zeit, in der viel zu viel Nahrungsmittel produziert wurden – nicht zu viel, um die Hungrigen zu ernähren, aber viel zu viel, um verkauft zu werden in einer Zeit, in der es den Menschen keineswegs gut ging, in der sie sich langsam von den letzten Wirtschaftskrisen erholten oder sich nicht erholten.
Aber niemand dachte daran, die Nahrungsmittel zu verbilligen. Im Gegenteil, um die Preise zu halten, wurde die Produktion gedrosselt. In Brasilien schütteten sie Kaffee ins Meer. In Amerika verbrannten sie Weizen und Mais. In Kalifornien wurden Hunderttausende von Tonnen Früchte vernichtet. Die Milch goss man in Flüsse. Schafe wurden getötet und samt ihrer Wolle verscharrt.
Und überall auf der Welt hungerten Menschen.
Das war erstaunlich, das war geradezu verblüffend. Aber Duttweiler gehörte nicht zu den Menschen, die sich gern verblüffen lassen. Er gehörte vielmehr zu jenen, die danach fiebern, etwas zu tun. Etwas tun! Das Falsche ändern! Helfen! Die Verblüffung verwandelte sich in Empörung. Der Konsument, die Hausfrau, die Hungrigen wurden übervorteilt. Hier musste etwas geschehen!
Und warum sollte er es nicht sein, der dieses Etwas geschehen liess? Schliesslich war er arbeitslos. Schliesslich musste er irgend etwas unternehmen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Warum nicht etwas Nützliches? Warum nicht etwas Notwendiges?
Duttweiler grübelte. Er wusste: in den Industrien sparte man ein, wo es ging. Riesige Fabriken kauften kostspielige Maschinen, um auf die Dauer ein Promille oder auch nur ein Zehntel von einem Promille bei der Produktion einzusparen und so einer nicht kaufkräftigen Kundschaft entgegenzukommen. Und im Lebensmittelhandel? Da schlug man lustig Prozente auf. Es kam ja auf ein paar mehr oder weniger nicht an. Vor fünfzig Jahren hatten Konsumvereine die Hechte im Karpfenteich gespielt, waren den Lebensmittelhändlern unangenehm geworden, hatten ihnen oft schmerzhaft klargemacht, dass die Kirche irgendwie im Dorfe bleiben müsse. Sie war inzwischen wieder weit aus dem Dorf geraten.
Duttweiler beschloss, sich einzuschalten.
Das heisst, er beschloss, Lebensmittel billiger zu verkaufen. Als Grossist? Das hätte wenig genutzt. Übrigens ging es auch nicht. Er hatte, als er vor ungefähr zwei Jahren die Firma Pfister & Duttweiler liquidierte, mit seinem früheren Geschäftspartner abgemacht, dass er nie wieder einen Engros-Lebensmittelhandel betreiben würde. Er wollte Pfister keine Konkurrenz machen.
Also ein Detailgeschäft? Nein, das lag ihm nicht. Das war ihm zu klein. Wenn er wirklich etwas erreichen wollte, genügte es nicht, zu den vielen hundert in Zürich bestehenden Lebensmittelläden noch einen hinzuzufügen. Ja, mit fünfzig neuen Detailgeschäften hätte er es vielleicht geschafft. Doch dazu gehörte Geld. Und gerade Geld besass er zu diesem Zeitpunkt nicht.
Er erinnerte sich einer Reise in die Vereinigten Staaten im letzten Jahr des Weltkrieges. Man hatte ihm von grossen Omnibussen erzählt, die gefüllt mit Lebensmitteln durch den Westen des Landes fuhren, durch Dörfer und Farmen. Diese Omnibusse hielten vor der Haustür der Konsumenten und verkauften, was diese gerade brauchten. Das war bequem, die Farmer hätten sonst kilometerweit fahren müssen, um den nächsten Laden zu erreichen. Diese Zeitersparnis bezahlten sie gern mit einem Aufgeld. Und so rentierte es sich für die Unternehmer jener Omnibusse, ihre Wagen luxuriös einzurichten.
Diese Wagen drüben «im wilden Westen» Amerikas verkauften also teurer als die Läden. Duttweiler aber wollte billiger verkaufen, musste billiger verkaufen. Natürlich konnte er Autos umherfahren lassen, die weniger luxuriös eingerichtet waren. Er konnte ganz einfach Lastwagen mieten … Wie wäre es, wenn er das Ganze auf die Basis des Hausierertums stellte? Es gab Hausierer genug in der Schweiz. Es war gar nicht schwer, eine Hausiererlizenz zu bekommen. Freilich, die Hausierer verkauften nur wenige Waren: Schuhwichse, Putzlappen, Seife; Lebensmittel so gut wie gar nicht. Aber das könnte ja geändert werden. Eines Tages fragte Duttweiler seine Frau: «Würdest du auf die Strasse gehen, um etwas einzukaufen?»
«Warum nicht, wenn es billiger wäre?»
«Natürlich nur, wenn es billiger wäre … » Das war also eine Möglichkeit, Ware billiger an die Kundschaft zubringen …
Die junge Frau Adele fuhr fort: «lch würde es tun. Aber wie es sich mit den anderen Frauen verhält, kann ich dir nicht sagen! Frauen sind unberechenbar.»
«Sie werden schon kommen», erklärte Duttweiler.
Seine Idee, kaum geboren, hatte bereits Besitz von ihm ergriffen. Er war dumpf entschlossen, sie auszuführen. Zum erstenmal seit seiner Verheiratung interessierte er sich für das Haushaltungsbuch seiner Frau. Er wollte wissen, wieviel sie für das oder jenes ausgab. Er studierte die Ziffern eingehend und machte sich Notizen.
Er notierte nicht nur, er ärgerte sich auch. Er fand, dass seine Frau, dass alle Hausfrauen viel zu viel für den Haushalt ausgaben. Der Unterschied zwischen dem, was sie hätten ausgeben sollen, und dem, was sie ausgeben mussten, mochte nur ein paar Franken betragen. Es waren nicht die wenigen Franken, die ihn empörten. Es war die Tatsache, dass überall in Zürich, vermutlich überall in der Schweiz, ja, in ganz Europa, jede Woche ein paar Franken zuviel für Lebensmittel ausgegeben wurden. Man musste diese paar Franken mit Millionen multiplizieren. Auch sein Ärger multiplizierte sich.
«Das muss anders werden!» schrie er, als ob er eine Versammlung von tausend Besuchern anredete.
Nach und nach erfuhr die Frau, was er zu tun gedachte. Es handelte sich darum, Autos mit Lebensmitteln durch die Stadt Zürich zu schicken und die Lebensmittel relativ billig zu verkaufen.
Und die Frage der Hygiene? Konnte man Waren einfach auf Autos laden und sie verkaufen? Musste man nicht befürchten, dass sie verschmutzten, dass sie schlecht wurden, dass sie verfaulten?
Gewiss, das war ein Problem. Eines von vielen Problemen.
Aber Probleme waren für Duttweiler da, um gelöst zu werden. Die Rechnung war doch ganz einfach! Er kaufte Lebensmittel zum Engrospreis ein und lud sie auf Wagen; damit entfielen zahllose Spesen: die Miete eines Ladens, die Gehälter von Verkäufern, die Spesen für Innenausbau, Licht, Heizung.
Er war Feuer und Flamme. «Die Frauen werden kommen!» rief er immer wieder aus.
Er erzählte der Schwester, Anna Suter, von seinem Vorhaben. Sie war die Frau eines Lehrers und wohnte in Küsnacht bei Zürich. Die Schwester äusserte sich ein wenig skeptisch: «Wäre das nicht ein grosses Wagnis?» Gewiss, es war ein Wagnis. «Es ist vielleicht besser, wenn die Mutter vorläufig nichts davon erfährt», meinte Duttweiler.
Die Mutter hatte immer ein wenig Angst um ihren Gottlieb, ihren einzigen Sohn neben seinen drei Schwestern. Sie glaubte an ihn, sie hatte immer an ihn geglaubt; aber sie wusste auch: Er war ein unverbesserlicher Draufgänger, er konnte für einen neuen Einfall alles aufs Spiel setzen. Ihr Gottlieb litt an zu grossem Optimismus. Und so war es gekommen, dass er alles, was er sich erarbeitet hatte, wieder verlor. Sogar zweimal, wenn man Brasilien mitrechnete.
Nein, die Mutter hätte den neuen Plan nicht gutgeheissen. Sie hoffte immer noch, dass ihr Gottlieb eines Tages ein vernünftiger und geruhsamer Mann werden würde wie die meisten jungen Männer seines Alters. Aber tief in ihrem Herzen glaubte sie wohl nicht so recht daran: Ihr Gottlieb war eben anders. Wer hätte das besser wissen können als die eigene Mutter?
Manchmal gingen ihre Gedanken zurück zu dem Tag, an dem er geboren wurde; dem 15. August 1888. Er war das dritte Kind. Seine Ahnen waren Bauern aus dem Wehntal. Er war übrigens ein hübsches Kind. Die Jugend war wolkenlos. Die Eltern hatten ihr Auskommen; der Vater hatte viele Jahre bei der Schweizerischen Nordostbahn gearbeitet, eine Wirtschaft betrieben, war dann zwei Jahre vor Geburt seines einzigen Sohnes als Verwalter in den Lebensmittelverein Zürich eingetreten, eine Genossenschaft, die sich damals stark im Kommen befand. Er hatte sich dort als ausgezeichneter Einkäufer, vorzüglicher Organisator und Kenner des Publikums erwiesen. Er verstand es, die zahllosen Menschen, die alle ein Recht hatten, in die Geschäftsführung hineinzureden, davon zu überzeugen, dass er gerade für ihren persönlichen Rat besonders dankbar sei. Manche Talente, die zwanzig und dreissig Jahre später seinen Sohn berühmt, beliebt und gefürchtet machen sollten, waren ErbTeil des Vaters. Der Sohn hing sehr an seinem Vater und bewunderte ihn.
Die Zeit, in der Gottlieb Duttweiler heranwuchs: Acht Jahre vor seiner Geburt war der Durchstich des Gotthardtunnels erfolgt. Ein Jahr später wurde ds erste Telefonnetz in der Schweiz installiert. 1884 wurde die Ciba, ein Chemie-Konzern, in Basel gegründet. Um diese Zeit zählte Zürich 26.900 Einwohner. Das schloss nicht die Aussengemeinden ein (Aussersihl, Wollishofen, Enge, Wiedikon, Fluntern, Hottingen, Hirslanden Oberstrass, Unterstrass und Riesbach). Gross-Zürich – also mit Einschluss dieser Aussengemeinden – hatte schon 84.800 Einwohner, war aber noch ein idyllisches Städtchen.