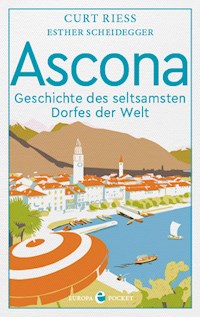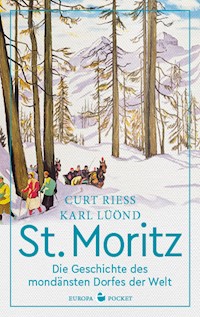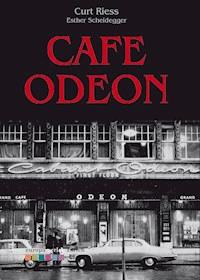
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Das "Odeon" – weltberühmtes Kaffeehaus am Bellevueplatz in Zürich. Literaten, Künstler, Schauspieler, Dirigenten und wichtige Männer und Frauen des letzten Jahrhunderts waren dort zu Gast. In seiner unterhaltsamen Chronik erzählt Curt Riess die Geschichte des Kaffeehauses und seiner Gäste, von Klaus Mann über Albert Einstein bis zu Else Lasker-Schüler und vielen anderen. "
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erstausgabe © 1973 by Europa Verlag AG Zürich
2. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010
© 2010 by Europa Verlag AG Zürich
Redaktion: Lars Schultze-Kossack, Nadja Kossack, Sophie von Vogel
Covergestaltung: Christine Paxmann text • konzept • grafik
Cover: Fred Tschanz Management AG
Druck und Bindung: Aalexx Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
eISBN: 978-3-905811-43-8
Auch als Printausgabe erhältlich: ISBN: 978-3-905811-24-7
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Curt Riess
Vorwort
DAS ODEON, EINE ZÜRCHER INSTITUTION, WIRD 100
Hundert Jahre sind ein schönes Alter, sagt man. Hundert Jahre wird schliesslich nicht jede und jeder, und auch nicht jede Institution. Das Grossmünster, Zürichs Wahrzeichen, soll der Sage nach Karl der Grosse gegründet haben, das ist Jahrhunderte her. Die Universität wurde 1833 eröffnet, die Confiserie Sprüngli 1836 – ihre weltberühmten Luxemburgerli sind allerdings viel jünger, die erfand der luxemburgische Konditor Camille Studer 1957. Der heutige Hauptbahnhof wurde 1871 gegründet und der National-Circus-Knie 1919. Die legendäre Buchhandlung Oprecht an der Rämistrasse dagegen überlebte nur 78 Jahre: Sie wurde 2003 geschlossen, weil sie nicht mehr rentierte. Das Café Odeon nebenan jedoch wird am 1. Juli 2011 hundertjährig!
Das Odeon ist nicht irgendein Starbucks, es war während Jahrzehnten ein einzigartiger Treffpunkt. Es war der Ort, wo – Selbstdeklaration – «Politik diskutiert wurde, künstlerisches Geschehen eine Wiege fand, Menschen verschiedenster Völker, Kulturen und Religionen eine Zuflucht fanden, oder einfach in Kaffeehausatmosphäre Ablenkung erfuhren». Der mit vielen Wassern gewaschene, weltläufige Journalist und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) fand im Café Odeon Material genug für ein Buch, für einen Roman. Dieser erschien 1973 im Europa Verlag Zürich und ist nun wieder aufgelegt worden; im wieder aktiven Europa Verlag Zürich. Gegründet hatte diesen, 1933, der rastlos engagierte Verleger und Buchhändler Emil Oprecht, Emigranten-Lebensretter und als Präsident des Verwaltungsrates Kopf und Herz des Zürcher Schauspielhauses. Im Schaufenster seiner schon 1925 an der Rämistrasse 5 eröffneten Buchhandlung baute er damals einen Scheiterhaufen aus «verbotenen Büchern» auf. Diese Bücher wurden freilich nicht verbrannt wie in Deutschland, sondern verkauft! Oprechts Verlag war das wichtigste Schweizer Forum für Exilliteratur in der Zeit von 1933 bis 1945. 1937 wurde Oprecht aus dem Börsenverein der Deutschen Buchhändler ausgeschlossen. Seine Publikationen wurden aber auch von der «Sektion Buchhandel» in der «Abteilung Presse und Funkspruch im Armeestab» in der Schweiz von Schweizern akribisch überwacht. Seine nächsten Freunde nannten ihn «Opi». Thomas Mann rühmte ihn als «schweizerischen Europäer».
Emil Oprecht starb 1952. Sein Freund Curt Riess schrieb über ihn in einem Nachruf: «Er stopfte in die 57 Jahre, die er zu leben hatte, mehr hinein, als sonst fünf Menschen bewältigen. Er wollte überall dabei sein, und er war auch überall dabei. Er war ein Elementarereignis. Es ist schon heute schwer, denen, die Opi nicht kannten, zu erklären, was er war und wie er war. In Zukunft wird es noch viel schwerer halten, den Menschen klarzumachen, dass es da einen gab, der nur dafür lebte, dass weniger Unrecht auf dieser Welt geschehe, und der sich im Kampfe gegen das Unrecht rücksichtslos verschwendete. Für uns Freunde aber, die wir Opi kannten – und alle, die ihn wirklich kannten, mussten seine Freunde werden – für uns wird die Welt ohne ihn nicht mehr die gleiche sein».
Den Verlag und die Buchhandlung übernahm seine tatkräftige Witwe Emmie Oprecht. Sie lebte bis zu ihrem Tod, 1990, in der nahe gelegenen feudalen Wohnung am Hirschengraben 50, die für unzählige Flüchtlinge in schweren Zeiten d i e rettende Adresse gewesen war, die Zuflucht bot, etwas zu essen, zu trinken und machmal sogar etwas zu lachen. Ein ständiger Gast war Else Lasker-Schüler (1869-1945), die deutsche jüdische Lyrikerin, die sich auch Prinz von Theben nannte. Emmie Oprecht erinnerte sich an sie – und an einen Hund – in einem Interview mit Maja Wicki im Januar 1989: «Dort auf dem Sims war der Lieblingsplatz unseres ersten Airedales, von dort aus beobachtete er die belebte Rämistrasse und das Kaffee an der Ecke, wo jetzt das Auktionshaus Koller ist. Er hatte eine besondere Antipathie gegen Else Lasker-Schüler. Wenn sie das Kaffeehaus verliess oder sich der Buchhandlung näherte, kläffte er sie von oben herab durchs geschlossene Fenster an. Wir hatten schon 1937 ihr ‹Hebräerland› herausgegeben, sie ging bei uns aus und ein, und wir unterstützten sie auch nach Kräften. Eines Tages, als sie vor uns die Rämistrasse hinunter zum Odeon ging, konnte der Hund es nicht lassen, sie am Mantel zu schnappen. Noch etwas Merkwürdiges geschah, als sie von Palästina zurückkehrte, weil sie es in Jerusalem einfach nicht aushielt. Sie stand an der Schweizer Grenze und wurde nicht hereingelassen, es war ein langes Hin und Her. Mein Mann wurde benachrichtigt, und er setzte sich sofort ans Telefon und bestürmte den Rothmund in Bern, man solle der Lasker-Schüler die Einreise genehmigen; die längste Zeit sprach er schon mit Rothmund, als plötzlich der Hund zu bellen anfing. Ein starkes Stück, dachte ich, dass seine alte Antipathie aufkommt, wenn er nur den Namen hört! Da wurde sachte die Tür geöffnet, ein Hut und ein altes Gesicht schoben sich langsam durch den Spalt, und eine bekannte Stimme, hoch und scherbelnd, sagte ‹Ich bin’s!› Der Hund hatte sie zum voraus gewittert!» Oprechts hatten im Odeon ihren reservierten Tisch. Ihre langjährige Buchhändlerin Barbara Sidler taucht heute noch gelegentlich auf ein Glas dort auf.
Der Odeon-Chronist Curt Riess (1902-1993) war, wie Oprecht, ein engagiert antifaschistischer, genussfreudiger und über das Weltgeschehen bestens informierter Zeitgenosse. Der jüdisch-deutsche Journalist, der eigentlich Kurt Martin Steinam hiess, alias Peter Brandes, alias C.R. Martin und alias Martin Amstein, hatte Berlin 1933 verlassen müssen. Er emigrierte nach Paris und liess sich 1941 in Manhattan nieder. Riess wurde ein populärer, rühriger Autor von Büchern und Serien über Zeitgenossen und Zeitgenössisches, über Theater und Film. 1946 publizierte er im Europa Verlag «George 9-4—3-3: ein Spionageroman aus dem zweiten Weltkrieg», 1949 «Joseph Goebbels: Eine Biographie», 1964 «Ascona: Geschichte des seltsamsten Dorfes der Welt» und 1973 eben «Café Odeon: unsere Zeit, ihre Hauptakteure und Betrachter». Zahlreiche Werke erschienen in anderen Verlagen, zum Beispiel «Sein oder Nicht sein, der Roman des Zürcher Schauspielhauses», «Ehrliches Pferd gesucht: eine Geschichte des Inserats» oder «Erotica! Erotica! Eine Geschichte der verbotenen Bücher». Er veröffentlichte, die übersetzten Ausgaben mitgerechnet, über hundert Publikationen. In der Schweiz liess sich Curt Riess 1952 definitiv nieder. Er heiratete die österreichische Schauspielerin Heidemarie Hatheyer und lebte fortan bis zu seinem Tod in Scheuren auf der Forch, im Kanton Zürich.
Riess hat die ersten 52 Jahre des Café Odeon (auf schweizerdeutsch wird das erste o betont) weitschweifig detailliert beschrieben. Im Mai 1972 wurde es geschlossen. Riess orakelte damals: «Aber was auch immer kommen wird und was sich möglicherweise Café Odeon nennen wird – es wird nicht mehr das Café Odeon sein, das wir kannten». Diese Meinung teilte Jahre später auch Hugo Loetscher, in seinem Buch «Lesen statt klettern»: «Das Bellevue, wie wir Zürcher den Bellevue-Platz nennen (mit Betonung der ersten Silbe bitte), war ein Knotenpunkt in der Kulturgeographie der fünfziger Jahre. Hier lag das Café Odeon; zwar liegt es, von einer Apotheke um die Hälfte seiner Fläche gebracht, noch immer dort. Aber das Odeon von heute hat mit dem von damals wenig zu tun. Mit dem Odeon besass Zürich ein Literatur-Café in bester Wiener Manier. Wie sehr es Tradition hatte, wurde manifest, als man dort fünfzig Jahre Dadaismus feierte.»
Das war 1966. Erfunden wurde Dada allerdings nicht im Odeon, wenn man seinen Erfindern glauben will. Hans Arp bekannte 1916: «Ich erkläre hiermit, dass Tzara das Wort Dada am 6. Februar 1916 um 6.p.m. erfand. Ich war gegenwärtig mit meinen 12 Kindern, als Tzara zuerst das Wort äusserte … das geschah im Café de la Terrasse in Zürich, und ich trug ein Brioche in meinem linken Nasenloch.» Für Tristan Tzara dagegen begann Dada mit einer Nudelsuppe: «Dada? Ich sass in der Bierhalle Wolf am Limmatquai und ass Nudelsuppe; das ist von eminenter Wichtigkeit. Denn in diesem Augenblick stürzte ein längst gesuchter Raubmörder in das Lokal und eilte zum hintern Ausgang wieder hinaus, bevor die ihm knapp nachfolgende Polizei ihn sehen konnte. Als Augenzeuge wollte ich – mit der einen Hand nach der hinteren Türe zeigend – die Fluchtrichtung weisen, doch vor Erregung konnte ich aus meinem noch mit Nudeln verstopften Mund nur das Wort ‹Da – da, da – da› lallen; das grosse Wort war geboren.»
Honi soit qui mal y pense. Unbestritten ist, dass die Dadaisten eine Zeitlang im Odeon verkehrten, als sparsame Konsumenten aber nicht besonders geschätzt wurden. Der Schriftsteller und Kulturjournalist Peter K. Wehrli hat sie jedenfalls dort noch gesehen. Und auch die scharfzüngige Claire Goll:
«Im Übrigen fiel mir bei jedem Aufenthalt in Zürich auf, dass diese Stadt viel lebendiger war als Lausanne oder Genf. (…). Dieses Volk von Bankiers und Bergbauern, dessen Herz so trocken ist wie sein berühmtes Bündnerfleisch, ging völlig unsentimental mit uns um. Zahlreiche Formulare waren auszufüllen, und jeder Stempel kostete drei bis fünf Franken, eine beachtliche Summe für mittellose Flüchtlinge. Aber Grosszügigkeit war in dieser Gesellschaft von Profitmachern eine seltene Eigenschaft. Goll und ich erfuhren es bald. Eines schönen Morgens, zur Stunde des Milchmannes, platzten zwei Polizisten in unser Hotelzimmer. Während Goll aufstand, versteckte ich mich unter der Bettdecke. ‹Die Papiere, bitte!› Wir waren verstört. Waren vielleicht gestern irgendwelche neuen Vorschriften erlassen worden, aufgrund derer man uns ausweisen konnte? Yvan zeigte seine Identitätskarte. Der eine Polizist prüfte sie lange, während sein Kollege breitbeinig die Tür verbarrikadierte. ‹Und was ist mit der Dame?› fragte der erste und deutete aufs Bett. ‹Meine Frau›, sagte Goll. ‹Darf ich mir erlauben, auch um ihre Papiere zu bitten?› Goll öffnete meine Tasche und gab ihm meine Ausweise. ‹Madame Claire Studer?› Sie ist zwar Frau, aber nicht Ihre, Herr Goll». Der Polizist zückte sein Protokollbuch. ‹Das macht sechs Franken, bitte.› Die Schweiz verdient sogar an wilden Ehen, und ihr Geschäftsgeist macht vor der heimlichsten Liebe nicht halt! Trotz allem fühlte ich mich wohl. Der stickige deutsche Mief hatte sich verflüchtigt (…). Im Café Odeon, dem Treffpunkt unserer Generation, verbrachten wir unsere Nachmittage mit Diskussionen über die Kriegsberichte und neue künstlerische Ereignisse, zum grossen Teil aber kreisten unsere Gedanken jetzt um den expressionistischen Tanz. Der Musiker Laban hatte nämlich in der Seehofstrasse einen Tanzkurs eröffnet. Sophie Täuber, Arps Freundin, tanzte dort, und alle Ballerinenliebhaber tanzten hinterher. Für die Mannsbilder war die Jagd auf ein kleines Hinterteil und expressionistische Kurven eine ebenso ernsthafte Beschäftigung wie Malerei oder Schriftstellerei …».
Hundert Jahre und immer noch lebendig! Obwohl immer wieder totgesagt. Das Odeon ist täglich ab 7 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts geöffnet. Am Freitag und am Samstag bis 4 Uhr früh und am Sonntag erst ab 9 Uhr. Zürichs ältester gastlicher Treffpunkt ist es übrigens nicht. Die wegen der Kunst an ihren Wänden weltberühmte Kronenhalle wurde 1862 erbaut, die legendären Wirtsleute Hulda und Gustav Zumsteg übernahmen sie 1925. Aber auch die Kronenhalle ist nicht mehr, was sie war, meinen manche Gäste. Was ist denn überhaupt noch wie früher? Die spanische Bodega im Haus zum Blumengeschirr vielleicht, die seit 1874 ausschenkt, oder die 1801 erstmals als Weinwirtschaft dokumentierte Öpfelchammer (Apfelkammer), von der es hartnäckig heisst, sie sei Gottfried Kellers Stammlokal gewesen, was nicht stimmt. Dass Keller (1819-1890) gelegentlich dort zechte, ist allerdings verbrieft. Einmal jedenfalls war er dort mit seinem Freund, dem Maler Arnold Böcklin und mit dem Maler Stauffer-Bern, der den Abend farbig schilderte:
«Einmal in der Öpfelchammer, wo wir miteinander zu einem Dutzend hockten, geriet es mir so mit allerhand Schnurren, dass sie (Keller und Böcklin) mir richtig zuhörten und mich ein paar Mal über ihren dicken Augensäcken lustig anlächelten … Wir trieben es den beiden Alten so, dass sie mit vollen Rotweinbäuchen lachten, wie wenn Fässer übers Pflaster rollten. Als wir nach Mitternacht aus dem Weinsarg wieder an die Luft krochen und auf die Gasse kamen, musste der schwere Böcklin, obwohl er selber schon auf sehr breiten Füssen ging, den kleinen Gottfried wie ein altes Frauchen leiten, das, seinen Gesangbuchvers brummelnd, mühselig den Kirchsteig hinunterwackelt». Schade, dass Keller das Odeon verpasste, er hätte damals gut hineingepasst.
«Das Kaffeehaus ist eine Weltanschauung, deren Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen», sagte einer, der es wissen musste. Alfred Polgar nämlich, der ewige Wiener Emigrant, der bis zu seinem Tod, 1955, Stammgast war im Odeon, und der auch erklärte, das Kaffeehaus sei ein Ort für Leute, die allein sein wollen, dazu aber Gesellschaft brauchen. Auch der Zürcher Dichter Albert Ehrismann (1908-1998), der in den zwanziger Jahren praktisch neben dem Odeon wohnte, im Haus zum Pilgerschiff an der Schifflände, liess sich wohl dort inspirieren:
Drei Takte aus einem Kaffeehaus
Wenn ich einmal sterben werde/ Ganz verborgen und allein/
Lass es, guter Geist der Erde,/ Dann in einem Café sein.
Nicht, dass es die Menschen sehen/Und die frohe Lust zerbricht./
Nur – wenn sie nach Hause gehen/Bleibe ich und gehe nicht.
Aber ihren Liederweisen/ Will ich lauschen bis zuletzt/
Bis sich dann der Tod im leisen/Letzten Takte zu mir setzt.
Dann im gläubig stummen Flehen/ Einer Geige lösch ich aus;/
Wenn die vielen Menschen gehen/ Bin nur ich noch Gast im Haus.
Nur ein Kellner wird mich finden/ Wenn er das Lokal aufräumt/
Und der denkt, dass da im milden/
Schlaf ein Mensch vom Glücke träumt.
(Aus «Lächeln auf dem Asphalt», 1930).
Andere, heute vergessene Schweizer Dichter widmeten dem Odeon fröhlichere Zeilen, so Heinrich Federer (1866-1928), ein katholischer Priester, der wegen seines Asthmas den Kirchendienst quittierte und 1900 Redaktor bei den Neuen Zürcher Nachrichten wurde. Zwei Jahre später wurden ihm – Skandal! – angebliche sexuelle Kontakte mit einem ihm anvertrauten Privatschüler angelastet. Als freier Schriftsteller schaffte er 1911 mit seinen Lachweiler Geschichten den Durchbruch als Schriftsteller. Federer schrieb:
«Mir läutet das Wörtlein Odeon/
Am Abend wie ein besonderer Ton,/
Wie etwa nach einem müd-verschwitzten/
Andante – die Spässe des Rondo blitzen.»
Der Schriftsteller Paul Ilg (1875-1957), der Autor von «Die Brüder Moor» (1912), «Das Menschlein Matthias» (1913) und «Der starke Mann. Eine schweizerische Offiziersgeschichte» (1916) veralberte sich und andere Odeon-Stammgäste folgendermassen:
«Wir halten uns wacker auf unsern Sitzen:/
Krakeeler, Strategen, Hausierer mit Witzen./
Wir fühlen, wir könnten Besseres leisten./
Und die es fühlen – kommen am meisten.»
Der als Auslandschweizer im italienischen Modena sozialisierte Zürcher Schriftsteller Jakob Humm (1895-1977) rekapitulierte in «Bei uns im Rabenhaus» – dieses befindet sich am Hechtplatz – 31 Jahre Literatenleben an der Limmat. In seinem autobiografischen Roman «Carolin»(1944) schilderte er eine verspielt frivole Liebesszene mit Aline Valangin (1889-1986) an der Fasnacht 1933 im ersten Stock des Odeon. Sie war in jenem Zeitpunkt mit dem brillanten russisch-jüdischen Anwalts Wladimir Rosenbaum (1894-1984) verheiratet, aber auch gerade noch mit dem italienischen Schriftsteller Ignazio Silone liiert, der im Schweizer Exil 1930 «Fontamara» schrieb. Die Rosenbaums führten in ihrem grossbürgerlichen «Baumwollhof» an der Stadelhoferstrasse einen luxuriösen Salon. Auch Humm schwärmte: «Der Baumwollhof war eine richtige Volière für durchziehendes fremdes und einheimisches geistbegabtes Volk.» Es ging ein und aus, wer sich langweilte, Hunger hatte, Freunde treffen, tanzen wollte, diskutieren oder in die Gastgeber verliebt war.
Im 1929 erworbenen Sommerhaus in Comologno im Tessin begann Aline Rosenbaum-Ducommun unter dem Pseudonym Aline Valangin selber zu schreiben. Hier gewährte sie wie in Zürich Verfolgten des Naziregimes Unterkunft und Unterstützung. Wladimir Rosenbaum hatte auch Kontakt zu C. G. Jung, war befreundet mit Vertretern des Dadaismus, machte gleichzeitig Karriere als Strafverteidiger. Er engagierte sich gegen Nationalsozialismus und Antisemitismus. Im Jahr 1936 wurden Waffentransaktionen für den spanischen Bürgerkrieg über seine Anwaltskanzlei abgewickelt. Rosenbaum wurde 1937 in der Schweiz verhaftet, sein Anwaltspatent entzogen. 1938 verurteilte ihn das Bundesgericht zu einer Gefängnisstrafe. Nach seiner Freilassung zog er nach Ascona, wo er bis zu seinem Tod als Antiquar und Kunsthändler lebte, mit seiner dritten Frau, Sybille Kroeber. Begraben liessen sich Wladimir, Aline und Sybille Rosenbaum im gleichen Grab auf dem Friedhof von Ascona.
Das Odeon konnte durchaus Himmel, aber auch Fegefeuer sein. Max Frisch notierte 1948 in seinem Tagebuch:
«Gestern Vormittag im Odeon höre ich, wie jemand am Nebentisch meinen Namen sagt, viel Genaues höre ich nicht, sehe aber, dass der Mann, der mich persönlich nicht kennt, mit dem Namen einen deutlichen Hass verbindet, nicht nur Geringschätzung, sondern Hass. Soll ich mich vor-12 stellen? Ich tue es nicht, zahle, nehme den Mantel und gehe. Man hasst sich selber nicht selten. Dennoch, zeigt sich, bin ich betroffen, wenn ich diesen Hass an einem andern sehe, einem Fremden. Dabei ist es ganz erklärlich; wenn man selber gewisse Leute hasst, keinen Hehl macht aus seinem Hass, kann das Echo nicht ausbleiben. Trotz dieser Erklärung ist es mir unmöglich, wieder an die Arbeit zu gehen. Das Selbstgefällige, das in solcher Verblüffung liegt, ist mir bewusst. Am Nachmittag ins Kino. Kein geschriebener Satz ist möglich. Nicht einmal ein Gedanke, ohne dass ich das Missdeutbare sehe; aber mehr als das: es braucht gar keine Missdeutung, um hassenswert zu sein. Der Mann, ohne dass ich seine genauen Worte gehört habe, hat recht. Es gibt kein Argument gegen einen Hass. Dabei wird mir fast zum erstenmal bewusst, dass man immer, wenn man schreibt, eine Sympathie voraussetzt. Vielleicht geht es ohne diese Voraussetzung überhaupt nicht, aber es ist gut, um diese Voraussetzung zu wissen, und man müsste froh sein um einen solchen Schock, ein solches Signal –.»
Martin Walser schickte in seinem 1966 erschienen Roman «Das Einhorn» den schriftstellernden Protagonisten Anselm Kristlein ins Odeon, wohin den sonst?:
«Zum Glück fuhr gleich ein Taxi her. Anselm packte seine Tasche … und sagte: Ins Odeon bitte. (Ich hoffe, Moumoutte, Du bist einverstanden, dass ich uns zuerst im Odeon verabrede. Gleich im Hotel, das sieht aus, als wäre alles ganz einfach …). Anselm fand einen Platz, von dem aus er beide Eingänge kontrollieren konnte. Dieses Kontrollieren fiel ihm gleich schwer. Offenbar gehört der Raum dieses Cafés zu den Räumen, die einen mindestens transportieren wollen. Aus orientalischem Wien, marmornem Rom und kaiserlichem Paris erhebt sich Reisewind, flott und benommen geht es dahin … Anselm wurde gestört. An seine Schulter tippte jemand. Er schaute auf, musste nicht fragen, frisch aus dem Nass-Schnee kommend stand vor ihm: Frau Sugg. Ich stehe schon einige Zeit neben Ihnen», sagte sie. Anselm sagte: «Ach. Das Café Odeon landete wieder …»
Denn man wagte sich, wie der bereits zitierte Schriftsteller Hugo Loetscher (1929-2009), schliesslich doch ins Odeon:
«Nicht ohne Respekt sind wir am Odeon vorbeigegangen. Da verkehrten Professoren und was man gemeinhin Persönlichkeiten nannte (…) Aber eines war klar, eines Tages werden wir im Odeon verkehren, und nicht mehr als Extravaganz einen türkischen Kaffee bestellen ( wie im ehemaligen Café Marökkli der Gymnasiasten, Anm. der Autorin), sondern einen Wiener-Kaffee, und wienerisch war, wenn ein Glas Wasser dazu serviert wird. Nun ging es ja nicht um Kaffee, sondern um ‹standing›. Es war ein literarisches Café. Als ich das Odeon kennenlernte, stand in einem Fach neben der Treppe (…) ein altehrwürdiges Konversationslexikon. Dort befand sich auch der Zeitungsständer. Wiener Café hiess, viele Zeitungen zu einem einzigen Kaffee lesen zu dürfen. Als Jungliterat gefiel es mir, dass man sich von einem Kellner wie Sepp Utensilien an den Tisch bringen lassen konnte, eine Schreibunterlage und einen entsprechenden Stift, das nahm sich aus, als hätte man einen Einfall gehabt.»
Deshalb ging auch der Zürcher Maler und Bildhauer Ernst Gubler am 13. November 1927 ins Odeon, um seinem Bruder Max zu schreiben – Briefeschreiben ist auch heute nicht verboten. «Ich gehe mit dem Vorwand Dir zu schreiben ins Odeon. Es ist furchtbar öde, nur im Letten wäre es nicht öde, aber nicht so leicht. Ich habe mich wieder etwas an den Schulschlauch gewöhnt und komme mit der Arbeit wieder in Gang. Dein Kopf ist ziemlich fertig; der Arm ist an der Figur, die Füsse daran auch angelegt, nun kommen noch Hände und Gesicht und dann Verschiedenes.»
Oder man ging eben nicht ins Odeon, Bettina Zweifel schrieb ihrem Verlobten, dem Schriftsteller Meinrad Inglin:
«Liebster, nicht verzweifeln! Denk’ doch, die Welt war ja auch einmal auf einem Riff & ging nachher so schön der Vollendung entgegen! Das Schönste wächst ja meistens aus dem Leid heraus! Komm doch ein wenig hierher! Wir gehen zusammen zur Sonne & lassen sie in unser Herz hinein scheinen; wir nehmen von Mamas Speisekammer etwas mit & brauchen dann gar kein Geld. W. Mertens hätte sicher Freude, wenn Du länger als nur für einen Hupf kämest. Auf seinem ‹Olymp› kannst Du dann arbeiten & die Abende geniessen wir zusammen unter Gottes freiem Himmel. Das Odeon guckst Du nur krumm an. So brauchst Du
gar kein Geld!»
Auch der Filmemacher Kurt Früh ging ins Odeon. Um den Film Café Odeon zu drehen. Warum Curt Riess ihn in seinem Buch zu erwähnen vergass, muss offenbleiben. Vielleicht weil seine Frau, die Schauspielerin Heidemarie Hatheyer, nicht mitspielte? Wie dem auch sei, der Schweizer Volksdarsteller Emil Hegetschweiler (1887-1959), im Volksmund Hegi genannt, hatte eine Paraderolle als Odeon-Kellner Walter in einer ziemlich unsäglichen Geschichte: Eine Unschuld vom Land kommt in die Stadt, ins Kaffeehaus am Bellevue, um ihre Schwester zu besuchen. Dass diese als Prostituierte arbeitet, weiss sie (noch) nicht. Früh hatte einen knallharten Film aus dem Zürcher Milieu drehen wollen, doch das war für Verleiher und Geldgeber zuviel Realismus. Was schlussendlich Ende der fünfziger Jahre ins Kino kam, war offenbar noch happig genug, jedenfalls wurde der Film damals im katholischen Luzern, in der Innerschweiz, im Wallis und im Waadtland verboten.
Nochmals Hegi: Anfangs der fünfziger Jahre darauf angesprochen, dass das Odeon geschlossen werden solle, explodierte er im kurzen Gespräch mit einem Journalisten: «Abbruch! Chasch dänke (denkste). Das ist doch ausgeschlossen. Das Odeon, das gehört doch zu uns, das ist ein Stück Heimat. Sehen Sie, mit dem Odeon geht es mir wie mit meinem Elternhaus an der Spiegelgasse (in der Altstadt). Es ist, als müssten einem die Tränen kommen. Weil wir es lieben, weil wir es gern haben, das Odeon gehört zu Zürich wie – ‹wie Sie, Hegi, zu Zürich gehören›, ergänzte ich. Und somit wird also das Odeon als Stätte des weltoffenen Zürcher Geistes bestehen bleiben. Hoffen wir es!»
Wie es im Café Odeon zuging, und wie es dann doch fast geschlossen wurde, lesen Sie auf den nächsten Seiten.
Esther Scheidegger
EPILOG ALS PROLOG
Das «Tagblatt der Stadt Zürich» vom 1. Juli 1911 enthielt auf Seite 18 eine Annonce, die verkündete …
Nein, beginnen wir fast auf den Tag 61 Jahre später. Ende März, Anfang April 1972 war in den meisten Schweizer und in vielen europäischen Blättern eine Notiz zu finden, dass das Café Odeon in Zürich – stadtbekannt, wenn nicht weltbekannt – seine Pforten am 1. Juni schliessen werde. Es schloss sie dann schon in den ersten Maitagen, nach höchst tumultuösen Zwischenfällen und Schlägereien zwischen den Besuchern, bei denen die Fensterscheiben des Cafés immer wieder zerschlagen wurden.
Der Anfang vom Ende schien mit dem Café Odeon nichts mehr zu tun zu haben. Er kann eineinhalb Jahre vor der Schliessung auf den Anfang des Jahres 1971 fixiert und mit der Tatsache begründet werden, dass die Stadt Zürich dem Wunsch der jungen Menschen, irgendeine Stätte zu haben, wo sie sich treffen konnten, nur in sehr begrenztem Masse entsprach. Ein von ihnen sodann okkupiertes leerstehendes Warenhaus wurde von der Polizei «gesäubert». Ein Bunker, der ihnen zur Verfügung gestellt worden war, wurde wieder geschlossen, weil sie sich «ungehörig» benommen hatten. Einige ihrer Lokale, in denen es, zugegeben, nicht eben ruhig und züchtig zuging, wurden ebenfalls geschlossen.
In dieser mit Dynamit geladenen Situation engagierte der erst vor kurzem eingestellte junge Geschäftsführer des Café Odeon einen Führer der zornigen Jugendlichen als Kellner. Der zog seine Freunde und deren Freunde nach. Bald war das Café, früher Treffpunkt von Künstlern, Politikern, Schauspielern, Schriftstellern, aber auch Gutbürgerlichen, nur noch von den «Langhaarigen» gefüllt, die, wenn auch nicht durch Gewalt, so doch durch ihr Benehmen und nicht zuletzt durch den Geruch, der Haschischrauchern anhängt, das Stammpublikum vertrieben.
Es kam zu Reibereien mit den Kellnern, da viele der neuen Gäste zu gehen versuchten, ohne zu bezahlen, es verschwanden Löffel, die Vorhänge wiesen quadratische Löcher auf – man hatte aus ihnen ein Stück herausgeschnitten, wenn man gerade kein Taschentuch bei sich hatte oder überhaupt keines besass. Auf Sitzbänken fehlte plötzlich ein Stück Lederbezug: der eine oder andere Gast hatte es herausgeschnitten. Glasschäden waren an der Tagesordnung; der zuständige Glaser hatte ständig die entsprechenden Grössen parat, damit das Café schon zwei oder drei Stunden nach einer Demolierung wieder verglast werden konnte.
Demolierung: es kam zu wahren Schlachten im Café, vor allem zwischen Türken und Malaysiern. Es ging darum, wer das Monopol des Hasch-Verkaufs im Odeon an sich reissen konnte. Das Café musste vorübergehend geschlossen werden. Die Polizei schlug eine mehrtägige Schliessung vor, der Besitzer weigerte sich – schliesslich musste er auf seine Angestellten Rücksicht nehmen, die in all dem Tohuwabohu treu zu dem Lokal gestanden hatten, wenn auch mit gelegentlichen Absenzen – bedingt durch Nervenzusammenbrüche.
Die Verluste stiegen ins Gigantische. Der Besitzer hatte immer noch Hoffnung. Als aber die Behörden, denen es nicht gelungen war – und vielleicht nie gelingen wird –, den Handel mit Haschisch und dessen Konsum durch Jugendliche zu verhindern, Schwierigkeiten zu machen begannen und ihm drohten, das Café wegen des Überhandnehmens der Haschsüchtigen zu schliessen, hatte er genug.
Als ob er und nicht vielmehr die Polizei versagt hätte! Er setzte die Schliessung des Lokals auf den 1. Juni 1972 fest. Es folgte ein Protest der Jugendlichen, von denen sich einige zu einer Gemeinschaft «Rote Steine» zusammengeschlossen hatten, mit etwas unklaren Parolen wie «Wir setzen der Gewalt des Systems die Gewalt des Volkes entgegen!»
Die Revolte im Café Odeon fand nicht statt, da es am 1. Mai diesmal geschlossen blieb.
Am folgenden Tag gab es ein teach-in, das zwar ruhig verlief, aber immerhin klarmachte, dass die Anwesenden es nicht als Privatangelegenheit des Besitzers ansahen, was er mit seinem Haus anzustellen gedachte. «In Zürich muss ein Lokal schon allein darum verschwinden, weil es nicht so viel Gewinn abwirft, wie dies der Geschäftslage entsprechen würde», beklagten sie sich.
Es wurden übrigens auch Komitees zur Rettung des Odeons gegründet. Es gab viele Proteste gegen die Schliessung, aber keine Alternativen. Dass dann nicht einmal der Termin vom 31. Mai gewahrt blieb, hat mit den turbulenten Vorkommnissen in den Tagen nach dem 1. Mai zu tun, von denen noch die Rede sein wird.
Das Café Odeon wurde also geschlossen. Für immer? Man wird sehen …
Zurück zum Anfang: das «Tagblatt der Stadt Zürich» vom 1. Juli 1911 enthielt also auf Seite 18 eine Annonce, die verkündete, dass am selbigen Tage, um sechs Uhr abends, die «Eröffnung des Café ODEON» stattfinden werde. Als besondere Attraktionen waren vermerkt: «Eigene Konditorei, 10 Neuhusen-Billards, 2 Match-Billards» sowie «Münchner Löwenbräu» und «Pilsner Kaiserquell». Als Wirt zeichnete der Münchner Cafétier Joseph Schottenhaml.
Ja, so begann es. Ein Café Odeon, ein Café unter vielen Cafés der Stadt Zürich, die damals schon Grossstadt war, freilich eine kleine Grossstadt. Ein Café am Bellevueplatz, sehr schön gelegen, abseits vom Betrieb der Bahnhofstrasse, wo es täglich, ja stündlich vorkam, dass Autos einander begegneten. Immerhin, die elektrische Strassenbahn, seit dem Frühjahr 1894 in Zürich installiert, überquerte bereits den Bellevueplatz und fuhr die Rämistrasse hinauf, die, ebenso wie der Sonnenquai, von kleinen, bescheidenen Häuschen flankiert war. Aber Spaziergänger – und es gab deren viele – hatten eher den Eindruck, sich in einem Kurort zu befinden.
Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Es gab zwei Weltkriege und eine Unzahl kleinerer Kriege – wenn es erlaubt ist, von Unternehmungen, bei denen Menschen andere Menschen in möglichst grosser Zahl umbringen, als «klein» zu sprechen; es gab Revolten und Revolutionen, blutiger und unblutiger Art. Es gab Börsenhaussen und Börsenstürze. Es wurden viele Erfindungen gemacht und ungeheure Vermögen erworben und verloren. Kurz, es wurde das Unterste zuoberst gekehrt.
In diesem halben Jahrhundert passierte eine Unmenge Menschen die Eingänge des Café Odeon. Sie sassen ein paar Minuten oder ein paar Stunden dort, und die meisten von ihnen, ob sie nun kurz oder lang blieben, ob sie ein paar Monate oder ein halbes Leben Stammgäste waren, unterschieden sich doch von den Besuchern anderer grosser Cafés in Paris oder in Wien, in Berlin oder in Prag.
Wer verkehrte im Café Odeon? Die Namen der Besucher würden unzählige Seiten füllen. Da waren der Schweizer Schriftsteller Ernst Zahn und der russische Emigrant Uljanow, der unter dem Namen Lenin berühmt wurde; der Dirigent Wilhelm Furtwängler und der Dramatiker Frank Wedekind. Da waren der geniale Chirurg Ferdinand Sauerbruch und der englische Schriftsteller Somerset Maugham, im Nebenberuf Geheimagent, die Schauspielerin Elisabeth Bergner, der Maler Mopp (Max Oppenheimer), und da war Jakob Christoph Heer und Else Lasker-Schüler, Franz Lehâr und Eduard Korrodi, Richard Strauss und Klaus Mann, der Tänzer Nijinsky und General Wille, Arturo Toscanini und der Clown Grock, die Schriftsteller Erich Maria Remarque und Thornton Wilder und Carl Zuckmayer, Friedrich Dürrenmatt und … und … und
Teil I
DIE LETZTEN JAHRE DES FRIEDENS
Als der Oberst Julius Uster, von Beruf Kaufmann und Besitzer einer kleinen Fabrik, sich entschliesst, den Usterhof an der Ecke Rämistrasse und Sonnenquai zu bauen, lässt er sich auf eine ziemlich gewagte Spekulation ein. Er muss rund neuntausend Quadratmeter Boden kaufen, und der kostet damals 150 000 Franken. Er muss eine Reihe alter Häuser, Baracken und Läden abreissen lassen. Der Neubau, von den Architekten Bischoff und Weideli ausgeführt, sehr modern – die Tuffsteinfassade wird später als «künstlerisch wertvoll» geschützt werden – soll 400 000 Franken kosten.
Und dann kostete der Bau des Hauses wohl wesentlich mehr. Jedenfalls ging Oberst Uster das Geld aus. Mitte 1910 wurden die Bauarbeiten abgebrochen. Monatelang stand das halbfertige Gebäude da, noch umrahmt von Gerüsten. Diejenigen, die immer alles wissen, wussten, dass der Bau nie zu Ende geführt werden würde.
Aber dann geschah das erste Wunder in der an erstaunlichen Ereignissen so reichen Geschichte des Café Odeon. Oberst Uster kam ganz plötzlich wieder zu Geld: er gewann, kaum glaublich, aber wahr, das Grosse Los der Spanischen Nationallotterie.
Man schrieb das Jahr 1910. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es in Zürich elektrisches Licht gibt. Es ist erst knapp zehn Jahre her, dass die Pferdebahn, das «Rössli-Tram», abgeschafft wurde. Zürich hat bereits 190 000 Einwohner.
Am 17. April wird bei strömendem Regen das Kunsthaus Zürich eröffnet.
Am 7. Mai stirbt Eduard VII. in London, und knapp drei Wochen später geht in Madrid eine Höllenmaschine los: offenbar ein Attentat auf den König, aber es kommt niemand um, mit Ausnahme des Täters, der sich erschiesst.
In den nächsten Tagen gibt es Erdbeben in der Schweiz. «Am 1600 Meter hohen Rossberg bei Schwyz ist eine Fläche von tausend Quadratmetern in Bewegung, die Dörfer wurden in der letzten Nacht geräumt. In der Bevölkerung herrscht grosse Bestürzung», meldet die Presse.
Und in Dübendorf bei Zürich wird vom 22. bis 26. Oktober eine Reihe von Flugtagen geplant.
Die Züricher lächeln überlegen. Sind die Dübendorfer verrückt geworden? Wer wird schon nach Dübendorf hinauspilgern, um sich Flugzeuge anzusehen und Gefahr zu laufen, dass sie einem auf den Kopf fallen?
Die Dübendorfer bauen eine 2500 Meter lange und 2 Meter hohe Bretterwand, einen 1000 Meter langen starken Drahtverhau, vier Kassenhäuschen und eine Tribüne für – man glaubt es kaum! – 2400 Personen.
Die berühmtesten Flieger der Welt hat man verpflichtet. Ein Preis von 5000 Franken ist für denjenigen ausgesetzt, der vom Flugfeld aus in ununterbrochenem Fluge das Schloss von Uster umkreist und auf den Startplatz zurückkehrt.
Der Optimismus der Dübendorfer behält recht. Am Sonntag, den 22. Oktober, kommen 25 000 Besucher in sieben Extrazügen zum Flugfeld. Held des Tages wird vorläufig der junge Franzose Georges Legagnieux, der mit einem Blériot-Eindecker bis auf 750 Meter aufsteigt und zum erstenmal Zürich – die ganze Stadt! – umkreist.
Schliesslich starten auch die anderen Maschinen, und nach den ersten Probeflügen werden sogar einige mutige Fluggäste aus dem Publikum mitgenommen. Unter anderen meldet sich auch ein Herr Ogurkowski. Er ist indessen zu dick; dem Piloten gelingt es nicht, ihn und seine Maschine zum Flugfeld zurückzubringen: das Flugzeug sackt in einen Wassergraben ab. Allgemeine Aufregung. Alles eilt zu dem Wassergraben aber Herr Ogurkowski ist nur etwas nass geworden.
Am 26. Januar 1911 findet die Uraufführung des «Rosenkavaliers» in Dresden statt. Die Kritiker schreiben, dies sei das grösste Werk des Komponisten Richard Strauss, die erste wirklich grosse Oper des zwanzigsten Jahrhunderts.
Inzwischen bricht die Marokko-Krise aus. Französische Truppen besetzen die Hauptstadt des Landes. Der deutsche Kaiser äussert unmissverständlich, dass Deutschland ja wohl auch ein Wort in Marokko mitzusprechen habe, und schickt das Kanonenboot «Panther» nach Agadir. Die Welt hält den Atem an. Wird ein Krieg ausbrechen?
Der Tag, an dem das Kanonenboot «Panther» in Agadir eintrifft, ist der 1. Juli 1911.
Und an diesem 1. Juli 1911 wird das Café Odeon eröffnet. Über die künstlerische Ausstattung der Innenräume ist die Ansicht des Publikums geteilt. Besonders der rötliche Marmor, mit dem die Wände verkleidet sind, gibt Anlass zur Kritik, und einige besonders witzige Leute taufen das Odeon um in «Café Schwartenmagen».
Etwas anderes freilich besass das Café Odeon bis wenige Wochen vor der Eröffnung nicht: Toiletten.
Man hatte sie einfach vergessen. Nun muss man sie in letzter Minute schnell noch irgendwie einbauen.
Einmütige Begeisterung erweckt die Konditorei des Cafés, die im Keller untergebracht ist und über einen fest gebauten Backofen verfügt. Chefkonditor Sigg bäckt herrliche Kümmelstengel aus Blätterteig, eine Unzahl von Torten, gefüllt mit Fruchtgelees, Schokoladenund Vanillecrème. Ganz Zürich eilt ins Odeon, um dort Kuchen oder Gebäck zu verzehren.
Glückliche Zeiten! Die Menschen fürchten sich noch nicht davor, dick zu werden. Und so kommt es, dass eines Tages ein junger Mann das Café betritt, der mit besonderer Vorliebe Kuchen und Torten, Cremeschnitten und andere Leckereien verzehrt, und zwar in ganz gewaltigen Mengen. Er braucht keine Angst zu haben, zuzunehmen, denn er ist sehr gross und sehr schlank, man könnte fast sagen hager.
Er geht mit Riesenschritten aufs Buffet zu, um sich drei oder vier Stück Torte auszusuchen, die er dann hastig an einem kleinen Tischchen verzehrt. Warum so hastig? Weil er sich noch eine neue Portion holen will? Er hat doch Zeit! Der Zug, der ihn nach Italien bringen soll, geht ja erst in drei oder vier Stunden. Warum blickt er immer wieder auf, warum schaut er wie prüfend zu den anderen Gästen des Cafés hin?
Er hat Angst. Es wäre ihm ein wenig peinlich, wenn man sich seiner in Zürich erinnerte. Denn der junge Mann mit dem edlen, ja, schönen Gesicht, mit ausdrucksvollen blauen Augen, mit herrlichem blonden, ein wenig zu langem Haar, ist kein anderer als der junge Wilhelm Furtwängler, nicht unbekannt in Zürich, denn er war erst vor ein paar Jahren am Stadttheater tätig gewesen. Zwanzigjährig war er als Chor-22 dirigent nach Zürich gekommen. Der Direktor mochte ihn. Er schlug ihm vor, «Die lustige Witwe» zu dirigieren. Furtwängler stürzte sich mit Begeisterung auf diese erste grosse Aufgabe in einem Theater. Er dirigierte mit so viel Hingabe, mit so viel Konzentration, dass es eher aussah, als dirigiere er die «Götterdämmerung».
Die «Lustige Witwe» war ganz nett, wenn man sie einmal hörte. Sie war nicht mehr nett, wenn man sie einige Dutzend Male dirigieren musste.
Furtwängler begann sich zu langweilen. Er konnte sich einfach nicht mehr konzentrieren. Bei der zigsten Aufführung, die er dirigierte, geschah es. Er hörte die letzte Aussprache und die obligate Versöhnung des Liebespaares wie im Halbschlaf. Es fiel ihm auf, dass dieser Dialog viel länger dauerte als sonst, und dass die Liebenden sich zu wiederholen schienen. Was ihm nicht auffiel, war, dass er das Stichwort zum Einsatz des Orchesters zum drittenmal verpasst hatte.
Nun aber hatte der Operettentenor genug. Was bildete sich denn der junge sogenannte Dirigent ein, dieser … wie hiess er doch gleich? Wütend stürzte er zur Rampe und donnerte Furtwängler an: «Dann eben nicht!» Vorhang.
Am nächsten Tag liess der Direktor Furtwängler rufen. Er meinte: «Vielleicht sind Sie doch nicht so talentiert für die Operette!»
Während der junge Furtwängler gen Italien fährt, wird – am 24. August 1911 – in Paris bekannt, dass Leonardo da Vincis Wunderwerk, «La Gioconda», im Volksmund meist «Mona Lisa» genannt, spurlos aus dem Louvre verschwunden ist. Das Bild ist fein säuberlich aus seinem Rahmen geschnitten worden. Die Polizei setzt ihre besten Kräfte ein, aber es wird fast ein Jahr dauern, bis man es findet.
Am Quai d’Orsay und in der Wilhelmstrasse in Berlin handelt man den sogenannten Marokkovertrag aus. Deutschland erhält dafür, dass es die französische Schutzherrschaft anerkennt, Gebiete in Kamerun.
Roald Amundsen, der norwegische Forscher, hat sich aufgemacht, um den Südpol zu entdecken.
Die Besucher des Café Odeon lesen nicht nur in den Blättern, die ihnen mit Kaffee, Kuchen, Eiern im Glas serviert werden, was sich in der Welt alles abspielt, sie erfahren es gelegentlich auch am eigenen Leib. So am Abend des 16. November 1911 um zehn Uhr, 27 Minuten und 15 Sekunden: plötzlich erfolgen drei heftige Stösse. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden – und die Gäste des Café Odeon verlieren ihre Fassung nicht ob dieses Erdbebens –, denn um ein solches handelt es sich natürlich. Sie geraten erst am nächsten Tag in Erregung, als sie in ihren Zeitungen nachlesen können, was die Erdbebenwarte darüber alles zu berichten hat.
Weniger gefasst zeigen sich die Besucher des nahegelegenen Corso-Theaters. Sie drängen zum Ausgang, werfen Tische und Stühle um, Weingläser und Flaschen zerbrechen, die grossen Spiegelscheiben an der Wand werden eingedrückt. Viele stürzen und werden von denen, die über sie hinweg nach draussen wollen, niedergetrampelt.
Am nächsten Morgen schreibt die «Zürcher Post»: «Wenn die Leitung des Corso-Theaters nicht selbst dafür Sorge tragen kann, dass in Fällen der Panik wie der gestrigen die Türen zu den Ausgängen sich leicht öffnen lassen, so gibt ihr vielleicht die Polizei die nötige Anweisung dazu.»
Aber die Polizei hat anderes zu tun. Nur zwölf Tage später, am 28. November, verkündet sie im «Städtischen Amtsblatt»:
«Die langen, über die Hutränder oder die Hutköpfe der Damen herausragenden Hutnadeln bilden überall da, wo die Trägerinnen ins Gedränge oder überhaupt mit anderen Personen in Berührung kommen, im Tramwagen, im Theater und Konzert, selbst auf stark begangenen Strassen, eine Gefahr für Dritte.
In Anwendung des § 94 lit. a des Gemeindegesetzes wird die Verwendung solcher Nadeln in ungeschütztem Zustande anmit unter Androhung polizeilicher Konfiskation derselben und Bestrafung der Fehlbaren mit Polizeibusse bis zu Fr. 15.– verboten. Die Sicherung der Nadeln mittelst Schutzhüllen ist obligatorisch.»
Ein neues Jahr. In Zürich ist es entsetzlich kalt.
«Ober, einen heissen Tee!»
«Ober, einen Grog!»
«Ober, einen Glühwein!»
Und was bringen die Zeitungen?
Roald Amundsen hat den Südpol erreicht – schon am 14. Dezember 1911, aber die Meldung kommt erst viel später – und Robert Scott, dessen Expedition zur gleichen Zeit startete, erfriert mit allen Teilnehmern. Die letzten Zeilen, die er schreibt: «Bringt dieses Tagebuch meiner Frau – meiner Witwe!»
Ferner meldet die Presse, dass Professor Albert Einstein, zurzeit an der Universität Prag, durch den Bundesrat auf den neu geschaffenen Lehrstuhl für mathematische Physik bei der Eidgenössischen Technischen Hochschule berufen worden ist. Aber Professor Einstein gehört nicht gerade zu den Berühmtheiten des Tages; was er tut oder nicht tut, ist kein Lesestoff für die grossen Zeitungen, die im Odeon aufliegen.
Hingegen lesen eines Tages die entsetzten Besucher des Café Odeon, dass am 14. April der Riesendampfer «Titanic» mit einem Eisberg zusammengestossen und gesunken ist. Wie? Haben sie recht gelesen? Gibt es denn das noch?
Als der Zeitungsverkäufer durch das Odeon eilt, beginnt eine ältere Dame, die in einer Fensternische sitzt, plötzlich zu weinen. Ein Herr mit einem kleinen weissen Spitzbart, offenbar ihr Mann, beugt sich über sie. «Was hast Du?»
«Die ‹Titanic›! Die Frölicher sind doch auf der ‹Titanic›!»
«Unsinn, die sind doch mindestens schon vor drei Wochen nach drüben gefahren.»
«Eben nicht! Es war doch wegen der Tochter Margret. Die hätte nicht mitfahren können, weil sie noch mitten in der Matura stand, und sie wollte doch so gern nach Amerika! Da hat der Vater auf die ‹Titanic› umgebucht!»
Die Zeitungsberichte der nächsten Tage schildern die furchtbare Tragödie der «Titanic» in allen Einzelheiten. Margret Frölicher befindet sich bereits auf der ersten Liste der Geretteten übrigens auch ihre Eltern.
Zürich ist im Begriff, sich zu einer Weltstadt zu entwickeln. Noch 1911 hatte die Stadt 195 638 Einwohner, ein Jahr später ist die Zahl 200 000 bereits überschritten. Offiziell ist die Einwohnerzahl 200 676.
Grosse Dinge gehen in Zürich vor. Der Konsumhof an der Waisenhausgasse ist am 1. April abgebrochen worden, um einem gewaltigen Neubau Platz zu machen.
«Haben Sie gehört?» raunt man sich im Odeon zu. «Ein Cinematographentheater soll auch in dem Haus sein!»
«Ein richtiges Theater für Filme? Auf was die Leute nicht alles kommen …»
Der «Zürcher Telephon-Zeiger» meldet, dass täglich 32 000 Gespräche in der Stadt geführt werden. «Diese Arbeit wird von 185 Telephonistinnen bewältigt. 1890 waren es 17 Telephonistinnen, und 1100 Züricher hatten ein Telephon …
Dies und anderes verschlingen die Besucher des Odeons. Ihre Haare sträuben sich, als sie am 11. Juli den «Neuen Zürcher Nachrichten» entnehmen müssen, dass ein Teil der auswärtigen Leser die heutige Nummer wegen des Generalstreiks leider verspätet erhalten würde. «Es ist kaum eine Möglichkeit für die Spedition gegeben, da die Streikenden alle Fuhrwerke und Automobile und so weiter aufhalten. Wir bitten um gütige Nachsicht …»
Generalstreik? In Zürich? Ja, es ist wirklich zu einem Generalstreik gekommen, wenn auch nur zu einem eintägigen, durch den die organisierte Arbeiterschaft gegen den Import von billigen Arbeitskräften aus dem Ausland protestieren will.
«Ich habe jede Zeile über den Generalstreik gelesen, das können Sie mir glauben!» sagt der etwa fünfundvierzigjährige, nicht mehr ganz schlanke Herr mit dem gepflegten Spitzbart, der gerade seine Partie Billard im ersten Stock des Odeons beendet hat und die Treppe herunterkommt, zu dem Kellner, der ihn zu einem Ecktisch führt. «Die Affäre hat ja Aufsehen auch jenseits der Grenzen erregt – die Reisenden aus Italien, die in das Bahnhofrestaurant von Göschenen kamen, fragten mich beklommen, ob es sehr gefährlich sei, nach Zürich zu fahren?»
«Und was haben Sie geantwortet?»
«Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ruhig weiterfahren. Es wird schon nicht so schlimm sein, was da in Zürich geschieht!»
Der Herr mit dem Spitzbart ist aber nicht nur Bahnhofswirt in Gö-schenen; er ist ein sehr bekannter und erfolgreicher schweizerischer Schriftsteller namens Ernst Zahn.
Hier, im Café Odeon, das weiss er sehr gut, nimmt man ihn nicht recht ernst. Man wirft ihm vor, dass er zuviel schreibt. Man tut ihn ab als einen «Heimat-Schriftsteller», weil seine Romane in den Bergen spielen, die er so gut kennt, unter den Menschen, die in den Bergen leben und schweigsam und spröde sind …
Der junge Mann mit dem auffallend karierten Sportanzug, der unbegreiflicherweise an die Zukunft der Flugzeuge glaubt, unterhält sich mit dem Ober Mateo, einem Spanier mit dem bürgerlichen Namen Canellos, der sein schwarzes Haar stark pomadisiert und sich eines kühn aufgezwirbelten Schnurrbarts à la Wilhelm II. rühmen darf.
Mateo war nicht so sehr Ober als vielmehr Freund der Gäste und ihr Informant. Er wusste einfach alles.
«In Oerlikon wird jetzt eine Radrennbahn gebaut!»
«Das ist doch viel zu weit von der Stadt entfernt! Da gehen die Leute nie hin!»
«Das Inserat sagt, fünfzehn Minuten vom Central mit der Strassenbahn.»
«Na, ich sage Ihnen ja, fünfzehn Minuten!»
Morgens zwischen acht und neun Uhr ist es meist ruhig im Odeon. Die Kellner geben der Buffetdame Anweisungen. Einer stapelt Würfelzucker, ein anderer schneidet Zitronenscheiben, ein dritter putzt an einer hochglänzenden Kaffeemaschine herum.
Der Ausläufer einer Bäckerei bringt einen Riesenkorb mit frischem Gebäck.
Ein Mann kommt herein, den man im Odeon recht gut kennt, obwohl er in den letzten eineinhalb Jahren in Prag weilte. Wer vermöchte auch den mittelgrossen Mann zu übersehen, der sogar jetzt, Ende Juli, eine Lodenpelerine trägt, obwohl er durchaus nicht friert. Vielleicht hat er sie nur aus Zerstreutheit umgelegt.
Ja, dieser Mann mit der sehr hohen Stirn, mit den seidigschwarzen, langen Haaren, ist nicht zu übersehen. Die grossen braunen Augen sind ernst wie bei einem Kind, das über alles erstaunt ist, was es erblickt. Der Mund ist gross, fast sinnlich, und hat doch etwas Weiches, fast Resigniertes.
«Wir haben Sie lange nicht mehr hier gesehen, Herr Professor», sagt Mateo, der ihm die Pelerine abnimmt.
Der Ankömmling nickt. «Ich bin ja auch erst vor ein paar Tagen nach Zürich zurückgekommen. Da hiess es vor allen Dingen, erst einmal eine Wohnung suchen. Wir haben jetzt eine hübsche gefunden, an der Hofstrasse 116, oben auf dem Zürichberg. Viel Sonne …»
«Einen Schwarzen, wie immer, Herr Professor Einstein?»
Ganz weit hinten an einem Fenster zur Torgasse hin sitzt ein alter Herr mit einem Zwicker an einem schwarzen Band, der ihm beständig von der Nase zu rutschen droht. Er verschlingt Zeitungen mit solcher Intensität, als habe er Angst, nicht mehr alles zu erfahren, bevor ihn der Tod dahinrafft.
Er liest: «Der Stadtrat beantragte dem Grossen Stadtrat, dass von nun an die Coiffeurgeschäfte an öffentlichen Ruhetagen geschlossen werden müssen.»
Die Frage der Regelung des Automobilverkehrs kommt immer noch nicht zur Ruhe. Mit Recht wendet sich die «Zürcher Post» gegen die spiessbürgerliche Idee, am Sonntag von morgens 10 bis abends 6 Uhr den Automobilverkehr zu verbieten. Man soll allenfalls die Maximalgeschwindigkeit auf 25 Kilometer pro Stunde beschränken.
Eine Dame von Anfang dreissig betritt das Café schnell mit erwartungsvollem, freudig gespanntem Gesicht. Sie sieht sich um und entdeckt den nicht, um dessentwillen sie gekommen ist. Auf die Frage des Obers, was er bringen dürfe, macht sie eine vage Geste. «Bringen Sie mir irgendetwas …»
Es hat sich nichts verändert, denkt Professor Einstein. Nein, es hat sich nichts verändert in den achtzehn Monaten, die er in Prag verbrachte. Wenigstens nicht in diesem Café. Nur dass er früher selten allein hierher kam. Er hatte immer ein paar Studenten oder Studentinnen im Schlepptau. Er hatte es gern, wenn sie nach dem Kolleg einige Fragen an ihn stellten. Aber vielleicht hat der Wunsch nach Kontakt mit seinen Schülern auch damit zu tun, dass es zuerst so wenig Schüler gab. Im Wintersemester 1908/09, als er in Bern seine ersten Vorlesungen über «Theorie der Strahlungen» hielt, hatte er immerhin vier Zuhörer. Im nächsten Semester meldete sich nur noch einer.
Bern … Als er sich habilitieren will und dem Professor für experimentelle Physik, Aimé Forster, seine Schrift «Elektrodynamik beweg-28 ter Körper» einreicht, bekommt er sie mit den Worten zurück: «Was Sie da geschrieben haben, verstehe ich überhaupt nicht!»
Das ist jetzt genau sieben Jahre her. Vor vier Jahren hat er es dann doch geschafft, als Dozent in Bern zugelassen zu werden. In der Zwischenzeit Arbeit am «Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum» als technischer Experte dritter und später zweiter Klasse, mit einem jährlichen Einkommen von 4500 Franken.
Ein Vermögen! Und deshalb hat er auch ausgerufen: «Ja, was soll ich denn mit dem vielen Geld anfangen?»
Der Herr in dem schwarzen Anzug mit dem sehr hohen Kragen, der Anhänger von Zeppelinen, ist wieder erschienen und hat sich zu dem Wildkarierten gesetzt.
Nach fünf Minuten streiten sie sich bereits wieder über Probleme der Aviatik.
«Was sagen Sie denn zu der ganzen Fliegerei, Herr Professor?» erkundigt sich der Ober Mateo. Das heisst, eigentlich ist er jetzt gar kein Ober mehr, sondern Herr Canellos. Er hat sich in der Nische neben Einstein niedergelassen, raucht eine Toscani und trinkt ein Glas Veltliner. Dies ist seine Freizeit, jetzt ist auch er Gast.
Einstein schreckt auf: «Ich?»
Herr Canellos beugt sich vertraulich zu ihm hinüber. «Ich las da neulich einen Artikel, da stand ein Satz drin, den habe ich mir gemerkt. Der hiess: Der liebe Gott braucht nur zu niesen und das ganze Fliegen ist zum Teufel!»
«Der liebe Gott …» Einstein lächelt.
«Vermutlich glauben Sie gar nicht an den lieben Gott, Herr Professor … ein so gebildeter Herr wie Sie …»
«Ich kann mir keinen persönlichen Gott vorstellen, der die Handlungen jedes einzelnen von uns beeinflusst, wenn Sie das meinen … Aber ich bin durchaus bereit, zuzugeben, demütig zuzugeben, dass die Wirklichkeit, von der wir so wenig wissen, nicht denkbar ist ohne einen unendlich überlegenen Geist …»
Die Dame, die so freudig ins Café Odeon gekommen ist und die von dem Kaffee, den der Kellner vor sie hinstellte, nicht einen Schluck trank, sieht auf die Uhr, steht langsam auf, geht zum Eingang Rämistrasse. Noch unter der Tür dreht sie sich um, als erwartete sie, dass der Mann, um dessentwillen sie kam, wie durch ein Wunder erschienen sei. Ihr Gesicht ist recht traurig.
«Pardon!» Ein Mann drängt sich an ihr vorbei, sieht Einstein und eilt auf ihn zu, um ihn herzlich zu begrüssen.
Am Nebentisch erklärt der Wildkarierte: «Das Flugzeug ist nicht aufzuhalten. 1908 gab es auf der ganzen Welt fünf Flieger, heute gibt es schon über sechstausend!»
Der andere schüttelt den Kopf, soweit ihm das sein hoher Kragen erlaubt: «Auch ich studiere Statistiken. Im Jahre 1908 hat sich einer zu Tode gestürzt, in diesem Jahr gibt es bereits 136 Todesopfer der Aviatik. Stellen Sie sich das einmal vor! 136 Menschen gehen in einem Jahr zugrunde, bloss weil es diese verfluchten Flugzeuge gibt. Das kann nicht so weitergehen!»
Der Bekannte von Einstein, der sich zu ihm gesetzt hat: «Dann ist also Ihre Allgemeine Relativitäts-Theorie noch nicht bewiesen?»
«Nein. Ich arbeite ja erst seit einem Jahr daran … Aber seit einem Jahr bin ich von ihrer Gültigkeit überzeugt. Nun, ich werde mindestens bis zur nächsten Sonnenfinsternis warten müssen, um zu wissen, ob ich recht habe oder nicht.»
«Und die Sonnenfinsternis findet wann statt?»
«1920.»
«Ist es nicht schlimm für Sie, acht Jahre warten zu müssen?»
«Ach, wissen Sie, wer wie ich so viel von dem, worüber er gegrübelt hat, in den Papierkorb werfen muss, ist nicht mehr so versessen darauf, zu wissen, ob er recht behalten wird.» Der deutsche Kaiser Wilhelm II. mit seinem ehrfurchtgebietenden Schnurrbart soll am 3. September Zürich besuchen und die Manöver der Schweizer Armee besichtigen.
An diesem Nachmittag ist das Café Odeon fast verödet. Eine grosse Menschenmenge hat sich zum Bahnhofplatz begeben oder steht längs der Strassen, an denen der Kaiser vorbeikommen wird.
Herr Schottenhaml, mittelgross, dunkelblondes Haar, das sich freilich schon ein wenig lichtet, mit jovialem Gesicht, der Pächter des Café Odeon, tritt auf den Sonnenquai hinaus und wirft einen Blick in Richtung Limmatquai.
Dort kommt eine Dame auf das Café Odeon zu geradelt. Jawohl, eine Dame auf einem Fahrrad. Und sie fährt sehr schnell, als wolle sie einen Rekord brechen, und der lange Schleier, den sie um ihren Hut gebunden hat, weht im Winde.
Herr Schottenhaml tritt schnell ins Café zurück. Aber das nützt gar nichts, denn die Dame steigt vor dem Café ab, lehnt ihr Rad an die Hauswand und kommt herein.
«Ich wusste gar nicht, dass sie in Zürich ist!» murmelt Herr Schottenhaml.
Der Ober Mateo ist neben ihn getreten. «Kennen Sie sie denn, Herr Schottenhaml?»
«Aber natürlich! Das ist doch die Gräfin Reventlow! Die war oft in meinem Münchner Café. Sie lebt in München …»
Die Dame hat sich im Café umgesehen. Sie ist gross, schlank und überaus reizvoll. Ihre dunklen Augen, die etwas schwermütig dreinblicken, bilden einen pikanten Kontrast zu ihrem blonden Haar. Auch aus nächster Nähe würde man nicht sehen, dass sie bereits über vierzig ist.
«Die Gräfin Reventlow!» flüstert Herr Schottenhaml. «Die Königin der Münchner Bohême. Die Aristokratin, die so viele Skandale verursacht hat, dass halb Europa von ihr weiss … von der könnte ich Ihnen Geschichten erzählen!»
Die Gräfin hat jetzt den Herrn gesehen, der an einem Ecktisch sass und aufgesprungen ist, ein guter Fünfziger, sehr soigniert. Sie eilt auf ihn zu. Und mit einem Blick über das leere Café: «Mein Gott, wie angenehm, einmal allein zu sein …»
Der Herr: «Wenn Sie allein sein wollen, Gräfin, warum gehen Sie dann in ein Café?»
Sie lächelt: «Nur im Café ist man allein …» Der Herr hat Billette erworben, die ihn berechtigen, den Kaiser vorbeifahren zu sehen.
«Glauben Sie wirklich, dass mich das interessiert? Diese Fürsten, Grafen und Barone … wie dumm sie alle sind! Wie beschränkt!»
Der soignierte Herr lächelt: «Schliesslich sind Sie ja auch eine Gräfin …»
«Meine Familie hat sich von mir losgesagt und ich mich von ihr!»
«Aber um Gottes willen, warum denn?»
«Weil ich durchgebrannt bin – mit hundert gepumpten Mark! Das ist lange her. Damals war ich einundzwanzig. Ich wollte frei sein!»
«Ja … hm … waren Sie denn nicht frei?»
«Meine Eltern gaben mir das, was man eine gute Erziehung nennt. Aber wissen Sie, eine gute Erziehung und das Aufwachsen in einer erstklassigen Umgebung beeinträchtigt die Entwicklung der praktischen Instinkte … die Existenzfrage spielt da keine Rolle.» Die Gräfin lacht dazu und sieht wunderschön aus.
«Wovon hat die Gräfin Reventlow denn nun eigentlich gelebt in den letzten Jahren?» will Mateo wissen.
«Das weiss niemand so recht. Sie war wohl gelegentlich verheiratet, aber es klappte nie. Sie hatte ein paar Freunde, aber die lebten eher von ihr als sie von ihnen.» Herr Schottenhaml überlegt. «Ich weiss, dass sie französische Romane übersetzt, und man sagt, ihre Arbeiten seien vorzüglich. Und dann schreibt sie auch selbst Romane oder Novellen, und die erscheinen, und es heisst, sie hätten geradezu literarischen Wert. Jedenfalls amüsant sind sie. Dafür bekommt sie natürlich Geld. Aber man sagt, es werde ihr immer gleich weggepfändet.»
Er wendet sich noch einmal zur Gräfin. «Werden Sie jetzt längere Zeit in Zürich …?»
«Nein. Ich lebe in Ascona. Das ist unten im Tessin. Ein Fischerdorf. Niemand kennt es …»
Herr Schottenhaml erzählt dem Kellner, einer ihrer Freunde habe ihr geraten, sich psychoanalysieren zu lassen.
«Psychoanalysieren?»
«Das ist so eine neue Methode – so eine Modesache, die vermutlich bald wieder vergessen sein wird!» flüstert Herr Schottenhaml Mateo zu.
Das Café Odeon füllt sich. Alle Welt spricht vom Kaiser.
Und dann wird sein Besuch schnell vergessen.
Ein Zeitungsverkäufer geht mit der zweiten Abendausgabe der «Neuen Zürcher Zeitung» durch das Café Odeon. Auf der zweiten Seite befindet sich eine kleine Notiz, die leicht zu übersehen ist:
«Nach den letzten Meldungen hat Wilson in vierzig Staaten den Sieg davongetragen und verfügt im Wahlkollegium über 442 Stimmen, während Roosevelt darin über 77 Stimmen und Taft über 12 Stimmen verfügen.»
Es geht gegen fünf Uhr nachmittags, und da es Januar ist, verbreitet die Deckenbeleuchtung im Odeon schon längst ihr mildes, milchiges Licht. Draussen stürmt und schneit es sogar ein wenig, wenn auch der Schnee nicht liegenbleibt: das richtige Wetter, um Grippe zu bekommen – nur nennt man es damals noch nicht Grippe, sondern Influenza. Vor der Tür zur Rämistrasse hat der Ober Mateo einen schweren Vorhang anbringen lassen, um die Gäste, und nicht zuletzt sich selbst, vor dem ständigen Luftzug zu schützen.
Auf den Strassen um das Odeon geht es ziemlich lebhaft zu. Schon gibt es fünf Strassenbahnlinien, die über das Bellevue fahren: die Linien 1, 2, 4, 5 und 9, und sie verkehren alle fünf Minuten. Dazu die Extrawagen vom Hauptbahnhof, wenn Schnellzüge angekommen sind, oder die am Bellevueplatz nach Schluss der Stadttheater-Aufführungen für das Publikum bereitstehen. Für zehn Rappen kann man schon ein ganzes Stück weit fahren, für fünfzehn durch die halbe Stadt, für zwanzig von einer Endhaltestelle bis zur anderen.
Der Ober Mateo zwirbelt an seinem Schnurrbart. Er ist erstaunt, dass es schon so viele Autodroschken gibt. «Haben Sie gelesen, Herr Schottenhaml? Es gibt jetzt in Zürich 1244 Personen mit Autofahrbewilligung.»
Herr Schottenhaml schüttelt misstrauisch den Kopf. «Das ist doch sicher übertrieben!» Und da erinnert er sich, dass er auch etwas Unangenehmes in der Zeitung gelesen hat, nämlich, dass es in Zürich schon dreizehn Kinos gibt! Man bedenke: 13 Kinotheater! Natürlich fassen die meisten nicht mehr als fünfzig bis hundert Personen, und sie sind auch nicht immer gut besucht. Aber wenn das so weitergeht, werden sich die Kinos geradezu zu einer Konkurrenz der Cafés entwickeln. Nun, so weit wird es doch nicht kommen, so verrückt sind doch die Leute nicht, dass sie, anstatt eine Tasse guten Kaffees zu trinken, sich die Augen im Kino verderben! Auch hat es ihn gefreut, zu lesen, dass die Züricher Theaterpreise erhöht worden sind denn das Stadttheater ist umgebaut worden, und im Pfauentheater gab es ebenfalls gewisse kostspielige Veränderungen. Jedenfalls kostet ein Proszeniums-Logenplatz für Opernvorstellungen jetzt 6 Franken und im Pfauentheater in der ersten Reihe 4 Franken. Da sitzt man doch weitaus billiger im Café Odeon!
Der Wildkarierte liest einen Aufruf des Schweizerischen Offiziersvereins an das Schweizervolk, in dem es unter anderem heisst: «… Heute hat die Aviatik aufgehört, dem reinen Sport zu dienen … Der Mensch hat heute, allerdings nur unter Verlust einer leider nur allzu grossen Zahl von Opfern aus der Reihe der tapferen Flieger, die Herrschaft über den Luftraum soweit erworben, dass das Flugzeug im praktischen Leben verwertet werden kann.»
Die Besucher des Café Odeon lesen in ihren verschiedenen Zeitungen auf Deutsch, Französisch, Englisch, Ungarisch und Spanisch:
«Am 1. März 1913 kreuzte der Zeppelin ‹Victoria Louise› unter der Führung des Grafen Zeppelin, eskortiert von einem Dampfer, auf dem sich das deutsche Kronprinzenpaar befand, über dem Bodensee und überflog Rorschach.»
Erhitzte Diskussion zwischen einem älteren Herrn in schwarzem Anzug mit ungeheuer hohem und ungeheuer steifem Kragen, und einem Mann von fünfundzwanzig Jahren in sportlichem, ziemlich wild kariertem Anzug.
Der mit dem hohen Stehkragen: «Ja, Zeppeline werden das Rennen machen!»
«Alle Augenblicke explodiert doch einer!» wendet der Wildkarierte ein.
«Sie mit Ihren Flugzeugen! Haben Sie gestern in der ‹Wiener Freien Presse› gelesen: Das Wettrennen zwischen dem Flugzeug und dem Zug? Es war noch dazu ein Bummelzug, der auf jeder Station hält, und trotzdem hat er das Flugzeug überholt!»
«Es herrschte aber auch heftiger Gegenwind!»
Nun ist es schon fast Frühjahr geworden. Die Wiese auf dem Bellevueplatz ist grün, die Bäume haben kleine Blätter. Die Frauen tragen hellere Kleider und Sonnenschirme, damit um Gottes willen ihr weisser Teint nicht Schaden leidet. Herr Schottenhaml ist etwas traurig, denn dies sind keine guten Zeiten für das Café Odeon. Im Frühling wollen die Gäste im Freien sitzen, wo sie sich dann bekanntlich erkälten.
Plötzlich runzelt Herr Schottenhaml die Stirn. Ein Herr hat das Café betreten, bei dem er sicher ist, dass er ihn noch nie gesehen hat. Ein Herr? Ein recht gewöhnlich aussehender, untersetzter Mann, sa-34 lopp, ja, schlecht gekleidet, mit dunklem Haar und einem Schnurrbart. Der Mann trägt eine Menge Papier unter dem Arm, setzt sich an einen leeren Tisch und beginnt sofort – als sei dies das Selbstverständlichste von der Welt – die Papiere auszubreiten und ein leeres Blatt mit seiner Schrift zu bedecken.
Herr Schottenhaml nähert sich mit einer Verbeugung. «Womit kann ich dienen?»
Der Mann schreibt weiter. Schliesslich sieht er auf, hält im Schreiben inne und sagt: «Einen Kaffee!»
Mateo flüstert Schottenhaml zu, nachdem beide sich einige Schritte zurückgezogen haben: «Ein Ausländer! Ein Italiener vermutlich! Er ist mir nicht ganz geheuer …»
«Seine Augen!» sagt Herr Schottenhaml. «Es ist der Ausdruck seiner Augen … Er sieht wie ein Kranker aus oder wie einer, der Angst hat!»
Der Kellner Giuseppe tritt zu den beiden. «Ich glaube, er ist ein Sozialist oder ein Anarchist … Ich habe ihn schon irgendwo gesehen. Vielleicht wird er auf der morgigen Maifeier sprechen!»
Ja, morgen ist der 1. Mai, morgen finden überall in Zürich Maifeiern statt: eine Kinderfeier um zehn Uhr im grossen Volkshaussaal, eine Nachmittagsfeier, ein Demonstrationsumzug. Es werden Reden gehalten, und alles wird mit einem Frühlingsfest enden. «Falls es nicht regnet …» Die italienischen Genossen werden sich im Velodrom in Oerlikon versammeln.
«Und Sie meinen, dass er …?» sagt Herr Schottenhaml.
«Ja, ich glaube. Aber seinen Namen habe ich vergessen …»
Was ist schon ein Name, wenn man der Sohn eines armen Schmiedes aus Predappio ist, der die Monarchie und die Kirche hasst und von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch für die armen Italiener träumt? Was ist schon ein Name, wenn man mit neunzehn Jahren aus dem Vaterland flieht – unter Mitnahme von fünfundvierzig Lire, die man der Mutter entwendet hat? Was ist schon ein Name, wenn man nach Passieren der Schweizer Grenze als Handlanger Ziegelsteine auf einen Neubau trägt, wenn man unter Brücken nächtigt, wenn man von Unterstützungen leben muss? Und wenn man schliesslich ausgewiesen wird, weil man keine «Schriften» besitzt?
Wie rasend fährt die Hand mit dem Bleistift über das Papier. Ich werde eine Rede halten, die sie nicht so rasch vergessen sollen, denkt der Mann, während er schnell einen Schluck Kaffee trinkt. Er weist auf die so disziplinierte Generalstreikbewegung der belgischen Genossen hin. Er brandmarkt die Machtlosigkeit der europäischen Diplomatie. Er kritisiert auch die eigene Partei, er erklärt, warum einige prominente Mitglieder ausgeschlossen werden mussten – Säuberungsaktionen können nie schaden – denn Kompromisse darf man nicht machen!