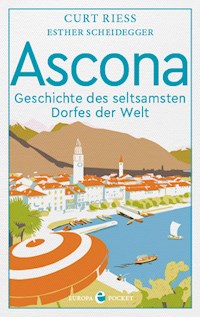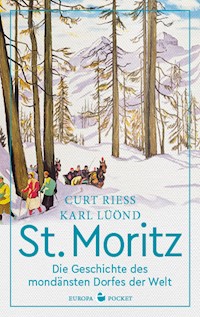
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer an St. Moritz denkt, hat blauen Himmel, Berge, Wasser, Sport, Vergnügen und Luxus vor Augen. Wie es gekommen ist, dass dieser kleine Flecken im abgelegenen Hochtal Graubündens zum mondänsten Dorf Europas wurde, in dem sich die Prominenz aus aller Welt ein Rendezvous gibt, erzählt Curt Riess in seiner unterhaltsamen Zeitchronik. Dabei lässt er das "alte" St. Moritz wieder auferstehen – und die Erinnerung an berühmte Besucher wie Marlene Dietrich, Gunter Sachs, Hans Albers und Charlie Chaplin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Curt Riess | Karl Lüönd
ST. MORITZ
Die Geschichte des mondänsten Dorfes der Welt
INHALT
Denk ich an St. Moritz …
Aller Anfang ist ganz anders
Hotels, Hotels, Hotels – Der entdeckte Winter – Nachricht aus der Säule – Wetten, dass …! – Frische Luft kann nicht schaden – Sportgeschichte – Good enough! – Prominente Gäste – Zwei Meter über dem See – Ein gewisses Wagnis – Segantini
Kriegszeit – Krisenzeit
Hotels in Schwierigkeiten – Wer kam? – Katzenjammer – Und fiel und fiel und fiel … – Zwei Musiker
Die «goldenen» Zwanzigerjahre
Ein seltsamer Handel – Engadiner Autorevolution – Glorreiche Ungewissheit des Sports – Die Heinzelmännchen – Keine Ruhe vor dem Sturm – Die Bar – Mysteriöser Herr
Vergnügungs-Kurort
Teddy Stauffer spielt! – Namen, Namen … – Trotzdem: Man amüsiert sich – Spionage
Und wieder einmal Krieg!
«Es muss etwas geschehen!» – Ausradiert – Grandhotel – Ein Augenzeugenbericht
Wiederauferstehung
Die Umschichtung – Olympische Spiele 1948 – Auch Könige sterben
Wie wird St. Moritz gemacht?
Das Steffani – Unfallarzt – Ein seltsamer Club
Vorhang auf – Vorhang zu
Überleben unter der Geldlawine von Karl Lüönd
Über die Autoren
DENK ICH AN ST. MORITZ …
… und jeder, der einmal dort gewesen ist, denkt gern an dieses Dorf. Und dann hat man gewisse Assoziationen. Jedenfalls ich habe sie. Ich denke an Berge. An ewigen Schnee. An einen ruhigen See, der unendlich tief zu sein scheint. Ich denke an die Sonne, an sehr viel Sonne. Und an Hotels.
Und wenn ich an Hotels denke, dann muss ich immer an Theater denken. Sie haben so vieles gemeinsam, die Hotels und die Theater. Hier wie dort gibt es eine Art Zweiteilung: Vor den Kulissen und hinter den Kulissen. Es gibt Menschen, die alles aufbieten, um andere Menschen zu amüsieren, zufriedenzustellen, glücklich zu machen.
Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Ich denke hier an die Theater, denn in St. Moritz ist es noch immer geschafft worden.
St. Moritz ist nicht nur Bergkulisse. Schneekulisse, Waldkulisse, Seekulisse. St. Moritz ist nicht nur das, was sozusagen hinter den Kulissen vorgeht. Auch die Zuschauer dieser Schau, St. Moritz genannt, waren und bleiben stets interessant. Wie viele erlauchte, ja gekrönte Persönlichkeiten sind in St. Moritz gewesen!
Wie viele Prominente sind hier durchpassiert! Wie viele berühmte Stars! Wie viele Sportgrößen! Wie viele der geheimnisvollen Beherrscher der Welt, von denen man sonst nur in den Zeitungen liest und hört, dass sie ihre Jachten durch die Ozeane fahren, kann man hier in Fleisch und Blut besichtigen!
Die meisten Orte, wohin man pilgert, fährt oder fliegt, sind mehr oder weniger Modesache. Sie kommen ganz plötzlich ins Gespräch, «man» muss dort gewesen sein. Und ganz plötzlich kommen sie wieder aus dem Gespräch. Um nur ein ren – schon von St.Tropez gewusst? St. Moritz gibt es schon lange …
Aber wie lange es St. Moritz schon gibt, habe ich erst erfahren, als ich mich an das Studium der zum Teil uralten Historien, Akten, Briefe, Dokumente machte.
St. Moritz ist sehr, sehr alt. Erstaunlich, wie jung es sich erhält. Manche Frau könnte von diesem Ort lernen.
Aber genug der Vorreden! Vorhang auf!
ALLER ANFANG IST GANZ ANDERS
Kurdirektor Peter Kasper sagt:
«Vor allem heißt es nicht St. Móritz, sondern St. Morítz!» Er fügt erklärend hinzu: «Wir nennen uns nämlich nach Mauritius. Das war der Führer einer Thebäischen Legion, die vom römischen Kaiser Maximilian gegen die Christen in Gallien entsandt wurde. Unterwegs meuterten seine Truppen, und er selbst starb den Märtyrertod. Im Engadin wurde er Patron einer Kirche – jedenfalls vor 1139 gebaut, denn damals kaufte sie zusammen mit vielen anderen Kirchen für 800 Mark Silber und 60 Unzen Gold der Bischof von Chur. Um die Kirche gruppierten sich ein paar Häuser. Später wurde ein Dorf daraus: St. Morítz!»
«Es heißt auch nicht die Bernina, wie allgemein gesagt wird, sondern der Bernina. Unser Heimatdichter J. C. Heer hat ja ein sehr schönes Buch über das Engadin geschrieben, aber dass er unseren Piz Bernina verweiblicht hat, werden wir ihm nie verzeihen. Natürlich hätte sein Buch heißen müssen ‹Der König des Bernina›, aber das hat ihm wohl nicht gefallen, und er machte daraus ‹Der König der Bernina›. Es mag besser so klingen, ist aber falsch.»
Übrigens muss man Heer zugeben: Er hat die einmalig schöne Landschaft wirklich einmalig schön beschrieben: Die frühen Reiseführer von St. Moritz schreiben nur, St. Moritz sei das «höchstgelegene Dorf des Engadins, umgeben von malerischen, meist schneebedeckten Bergen, die um die 3000 Meter hoch sind. Im Hintergrund Gletscher und auf den Abhängen dichte Wälder …»
Aber es war wohl ein Dichter notwendig, um den See, der meist von einem seltsamen geheimnisvollen Grün ist, zu beschreiben, oder wie die berühmten Berge innerhalb weniger Sekunden ihr Aussehen völlig ändern.
Es sind bald einzelne Riesen, die wie Brillanten glitzern, bald unheildrohende Türme, die auf einen niederzustürzen drohen, jetzt hinter hineilenden Nebelschleiern verschwinden und plötzlich wieder auftauchen, bald beängstigend nah, bald unnahbar fern. Und die duftenden Wälder – eigentlich sind es Märchenwälder, man kann sich in ihnen verlieren, man kann, in ihnen geborgen, alles vergessen, sogar den Betrieb von St. Moritz, auch wenn es nur ein paar Schritte entfernt ist.
Aber zurück zu St. Mauritius – auch San Murazzan genannt – oder eigentlich viel, viel weiter zurück. Es begann ja nicht mit ihm, es begann früher, nicht das Dorf St. Moritz, aber die Quelle. Die war wohl immer schon da. Die Heil spendende Quelle, in der man badete, die gab es schon in der Bronzezeit. Wissenschafter haben das festgestellt.
1519 war es, als Papst Leo X. an der Stätte des heiligen Mauritius Ablass verlieh – nicht ohne ein kleines oder auch größeres Entgelt zugunsten der St. Peterskirche in Rom. Er hatte sich über Mangel an Kundschaft nicht zu beklagen, es kamen zahlreiche Fürstlichkeiten aus den benachbarten Ländern über die verschiedenen Pässe ins Engadin, allerdings nicht nur, um ihr Seelenheil zu finden, sondern weil sie um ihr leibliches Wohl besorgt waren, kurz, um aus der Quelle zu trinken.
1535 erschien der große Arzt Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, in St. Moritz und stellte über die Quelle fest: «Ein acetosum fontale (=Sauerbrunnen), das ich für alle so in Europa erfahren habe, preise, ist im Engadin zu Sanct Mauritz; derselbige Brunn laufft im Augusto am säuristen. Der desselbigen Trancks trinket wie einer Arztney gebührt, der kann von Gesundheit sagen …»
1566: eine schreckliche Überschwemmung, die das Engadin verwüstete. Der Chronist Ulrich Campell berichtete: «Die gewaltige Überschwemmung währte vom 24. bis 30. August; in ganz Rätien wurden die meisten Brücken weggerissen. Allein im Engadin deren zwölf, viele Häuser zerstört, Wiesen und Felder überschüttet. Das ganze Tal Engadin wurde völlig entstellt, die Sauerquelle von St. Moritz wurde mit hohem Schutt überdeckt. Es dauerte fast 50 Jahre, bis das Engadin sich von diesem Schlag erholte.»
Was nun die Kur anging, sie war, um es gelinde zu sagen, anstrengend. Gemäß einer Trinkordnung des italienischen Arztes Antonia Casati, die im Jahre 1674 gedruckt wurde, musste der Kurgast mit einem Liter pro Tag beginnen und es innerhalb von zehn Tagen bis auf zehn Liter pro Tag bringen, danach in weiteren zehn Tagen auf einen Liter zurückgehen. Das Wasser musste drei bis vier Stunden vor der ersten Mahlzeit geschluckt werden. Wie der Kurgast das fertigbrachte, war seine Sorge …
Trotzdem oder gerade deshalb kamen, wie schon gesagt, hohe und höchste Herrschaften, es kamen insbesondere adelige und hochadelige Damen, manchmal brachten sie ihren Gatten mit, wie etwa die Frau des Herzogs Franz Farnese, 1699, zu dessen Empfang die drei Bünde eine eigene Gesandtschaft absandten. Manchmal kamen auch die Männer nicht mit, ja, es ist anzunehmen, dass die hohen und höchsten Damen gelegentlich St. Moritz insgeheim aufsuchten, und zwar aus einem ganz bestimmten Grunde.
Sie waren schwanger. Und sie wollten es nicht bleiben.
Die geschilderte Rosskur hatte vor allem diesen Zweck. Darüber wurde ganz offen gesprochen – wenn auch nicht den Gatten gegenüber –, ja, sogar geschrieben.
Später erschienen dann auch Damen, wieder adelige und hochadelige, aus dem genau entgegengesetzten Grund ihrer früheren Besuche. In einem Reisebereicht des Landgrafen von Hessen aus dem 17. Jahrhundert findet sich der Passus:
«Das Bad ist gesund,
Schwanger wurden Frau, Magd und Hund!»
In den nächsten Jahren, bis tief ins 18. Jahrhundert hinein, machte man sich immer wieder Gedanken über den Gehalt der Quelle, Analysen wurden durchgeführt, und über die Möglichkeit, den Austritt der Quelle zu verlegen, wurde unendlich oft debattiert; einmal brachte man sogar Granitplatten an, aber das geschah gegen den Rat vieler, die meinten, die Qualität des Wassers würde sich dadurch verschlechtern.
Stark umstritten war auch die Frage der Unterbringung der Kurgäste. Im Neujahrsblatt des Jahres 1811 ließ sich die «Gesellschaft zum Schwarzen Garten» in Zürich wie folgt vernehmen:
«Die Celebrität, die dies heilsame Wasser hat, könnte den, der noch nie hier gewesen, leicht auf den Gedanken bringen, eine Menge schöner geräumiger Häuser vorzufinden, aber wie sehr würde diese Erwartung getäuscht; denn nichts als ein kleines Häuschen erblickt man über der Stelle, an der dieses Wasser der Erde entquillt, dessen Äußeres sowie seine innere Einrichtung bis noch vor zwei Jahren alle Begriffe von Armseligkeit überstieg …
Beim Eintritt ins Gebäude selbst, ebenen Fußes, sieht man einen aus roten Granitplatten bestehenden Wasserbehälter von etwa drei Schuh ins Gevierte, dessen Grund und Seitenwände ganz mit Eisenocker überzogen sind. Hier, in einem engen Raum, wo sich kaum ein Dutzend Personen bewegen können, drängen sich die Kurgäste pêle-mêle zum Brunnen, um von dem bestellten Aufseher (Fontaniere) sich ihre Gläser und Gläschen aus einer eisernen Kelle füllen zu lassen.»
Auch war es nicht gerade bequem, in die Nähe der Quelle zu gelangen. Der Inn trat ständig über seine Ufer, die Straße zum Dorf befand sich meist in einem miserablen Zustand.
Hotels, Hotels, Hotels
1831 wurde schließlich – von Johann von Flugi – eine Aktiengesellschaft gegründet, ein Kurhaus gebaut, das allerdings den Gästen keine Unterkunftsmöglichkeiten bot, aber immerhin einen geräumigen Trinksaal und überhaupt einen etwas «eleganteren» Badebetrieb ermöglichte.
Die Aktiengesellschaft wurde vergrößert, die Weltkarriere von St. Moritz hatte begonnen. Hotels schossen in für damalige Verhältnisse unwahrscheinlichem Tempo aus dem Boden, um den Zustrom der Gäste zu fördern, oder, was ebenso wichtig war, zu verhindern, dass sie mit vor Entsetzen gesträubten Haaren gleich wieder abfuhren.
1856 entstand das Kulm, 1863/65 wurde das alte Kurhaus umgebaut, 1866 das Beau-Rivage (das heutige Palace) und das Belvedère eröffnet, 1869 der Bären, das Steffani und das Bellevue, 1870 das Hotel Caspar Badrutt, 1875 das Victoria und das Du Lac, um nur die ersten zu nennen.
Es fehlte nicht an sogenannten Empfehlungen. Richard Wagner zum Beispiel war ganz besonders von der Engadiner Landschaft angetan. Dort, wo der Piz La Margna hinter den Vorbergen hervortritt, soll er gesagt haben: «Da, wo alles schweigt, denkt man sich die Wesen, die da walten, nicht mehr vom Wachsen und Werden berührt.»
Conrad Ferdinand Meyer: «Hier ist es so schön, so still und so kühl, dass man die Rätsel des Daseins vergisst und sich an die klare Offenbarung der Schönheit hält. Wenn ich die schöne Zeichnung der Berge mit dem Auge verfolge, oder die Farben der Seen oder der Luft bewundere, ja, nicht selten vor Bildern stehe, an denen kein Claude Lorrain etwas ändern dürfte, Bilder, die eigentliche Typen des landschaftlich Schönen sind, so sage ich mir, dass derselbe Meister, der dies geordnet hat, auf dem ganz anderen Gebiete der Geschichte gewiss auch seine, wenn auch für mich verborgenen Linien gezogen hat, die das Ganze leiten und zusammenhalten.»
Bekanntlich lebte auch Friedrich Nietzsche nicht weit entfernt von St. Moritz – in Sils.
Um auch ihn zu zitieren: «Das Engadin ist das Rechte für mich. Ich halte es hier besser aus als irgendwo. Mir ist, als hätte ich lange gesucht und endlich gefunden … Wälder, Seen. Die besten Spazierwege und die erquickliche Luft, die beste in Europa – das macht mir den Ort lieb. Täglich bin ich dieser Luft dankbar. Das Engadin ist der einzige Ort, der mir entschieden wohltut bei gutem und schlechtem Wetter.»
Was das St. Moritzer Wasser anging (es gab nun schon verschiedene Quellen, die teils entdeckt wurden, teils selbstständig den Weg ins Freie gefunden hatten), war es nun klar, dass es nicht das Schicksal so vieler Quellen erleiden, nämlich versiegen würde.
Neue Hotels entstanden, sie schossen gleichsam aus dem Boden: 1878 das Eden, 1880 das Privathotel Badrutt und das Waldhaus, 1885 der Schweizerhof, 1890 das National, 1893 bis 1896 das Palace – man erkennt schon an der Länge der Bauzeit, dass es sich da um etwas Besonderes handelte. Es gab auch schon eine Zeitung oder vielmehr Zeitungen, das «Allgemeine Fremdenblatt» und den «Engadiner Expreß & Alpine Post».
St. Moritz nannte sich nun Bad (1789 Meter über dem Meeresspiegel) und «hochalpiner Kurort». Der Gehalt des Kurwassers wurde angepriesen; ebenfalls die Tatsache, dass das neue Stahlbad-Hotel in St. Moritz schon 1894 über einen Grillroom und eine American Bar verfügte. Es gab Kurlisten. Ihnen ist zu entnehmen, dass Gäste aus aller Welt herbeiströmten.
1894 konnte die «Engadin Post» mit einer besonderen Sensation aufwarten: «Da die Heuernte unter dem Dorf vollendet ist, werden die Spiele des Golfclubs sofort beginnen. Dieselben werden hier oben in einem Zentrum des Fremdenverkehrs mehr als anderswo lebhaften Aufschwung nehmen.»
Damals bereits war es charakteristisch für St. Moritz, dass die dort Bediensteten sehr lange bleiben. Eine Subskriptionsliste aus dem Jahre 1898 wies die verehrten Gäste darauf hin, dass mindestens zwei der im Bad beschäftigten Personen, Herr Jakob Durisch und Herr Christoffel Durisch, 40 Jahre, seit 1858, Dienst getan hatten. Es wurde gelegentlich wegen dieses Jubiläums zu Spenden für sie aufgefordert, und sie kamen auch ein. Unter den Spendern befanden sich die Herzogin Wera von Württemberg mit 50 Franken, während der Kurverein St. Moritz sich zu 100 Franken aufschwang und die Kurverwaltung sogar zu 400 Franken. Andere machten es billiger.
1892 gab es schon, was es heute nicht mehr in St. Moritz gibt, eine elektrische Straßenbahn, was den Heimatdichter Heer zu einem Begeisterungsausbruch veranlasste: «Warum sollte man St. Moritz nicht ein Städtchen nennen? Es hat zwar nur 700 ständige Einwohner, aber es besitzt ein Tramway, Trottoirs, einen Überfluss an elektrischen Bogenlampen, ein Kasino, ein Theater, schöne neue Kirchen für alle Bekenntnisse, Kaufläden und Bazars jeder Art, eine Menge Spielplätze für Jung und Alt und mehr herrschaftliche Kutschen als manch große Stadt. Alles ist städtisch, am meisten die Bodenpreise. Ein kleines Stück Abhang von St. Moritz Dorf ist ein kleines Vermögen wert, ein Quadratmeter von St. Moritz Bad ist gar nicht mehr zu kaufen; der meiste Grund und Boden ist unveräußerlich im Besitz der großen Hoteliers und Hotel-Aktiengesellschaften, die keine Konkurrenzunternehmen wünschen.»
Die Straßenbahn wurde übrigens nicht in der Schweiz hergestellt, sondern aus Stuttgart bezogen. Eine Fahrt vom Bad ins Dorf kostete 40 Rappen, Fahrtdauer zehn Minuten.
Als ein Passagier, der im Bad eingestiegen war, den Kondukteur fragte, ob er wohl bis zum Bahnhof fahren könne, antwortete der Befragte: «Natürlich können Sie bis zum Bahnhof fahren …» Dann aber hielt die Bahn am Schweizerhof und fuhr nicht weiter. Der Fahrgast wollte wissen: «Wo muss ich denn umsteigen?» Und bekam die Antwort: «Ja, es tut mir leid, die Schienen sind mir ausgegangen …»
Lange bevor es zu den auf den letzten Seiten geschilderten Ereignissen kam, war etwas geschehen, das viel entscheidender für die Zukunft von St. Moritz sein sollte als das Bad, als der Quell, der ursprünglich die Fremden hergelockt hatte.
St. Moritz hatte den Winter entdeckt. Genau genommen war es nicht St. Moritz, sondern Johann Heinrich Mayr aus Arbon im Thurgau. Er erschien im Winter 1834 auf 1835.
Von ihm muss nun erzählt werden, und auch von dem Mann, der begriff, was daraus zu machen war, dass es in St. Moritz einen Winter gab.
Dieser Mann hieß Johannes Badrutt.
Der entdeckte Winter
Den Namen Mayr wird man sich merken müssen.
Der Thurgauer Fabrikant kam – wie aus seinen Tagebüchern hervorgeht – häufig nach St. Moritz, das heißt, er kam fast jeden Sommer. Eines Tages erschien er auch im Winter. Aus seinen Aufzeichnungen:
«Samada, den 20. November 1834.
Mein Fuhrmann war ein guter Kerl, aber kein Säumer der Gegend und des Berges nicht kundig; die Schlittengeleise sind schmal, und nicht mehr als dreimal warf er mich heute um, das erste Mal in den Schnee, das zweite Mal auf’m Sand und das dritte Mal auf’n Felsen, über eine Woche schmerzte mich die Hüfte, ich war noch wohl zufrieden. Gott bewahre, etwas zu brechen in diesen Gegenden!
Ich wollte weiter und in Weißenstein übernachten: Durch tiefen Schnee ging’s den gähen Berg hinan; mit Sonnenuntergang war ich im Quartier.
Ich hatte wenig Hoffnung auf ein Lager. Es war besser, als ich erwartete! Ein niederes hölzernes Zimmer mit zwei Betten, tüchtige Federdecken und ebensolche Unterbetten. Bald war ich erwarmet und schlief recht gut, bis gegen Morgen mich der Geruch der alten Federn des Bettes belästigte. Kaum dämmerte der Morgen, so stand ich auf, ich hatte den Pass über’m Albula vor mir; das Wetter war ruhig, es schneite zart.
Vor halb neun Uhr saß ich auf dem Schlitten, herrliche Windstille. «Welch herrliche Reise», sagte ich; «denn nur Wind ist gefährlich.» Ich ließ den Fuhrmann auf dem Schnee neben der Tiefe gehen, denn da umgeworfen zu werden und einige Kirchturmhöhen in die Tiefe zu rollen, stund mir nicht an, und dass der Bursche kein Hexenmeister seines Faches sei, erfuhr ich gestern genugsam, meine Hüfte schmerzte mich sehr.
Endlich war die Höhe erreicht, und sogleich ließ sich etwas Wind merken. Einhundert Schritte weiter ward er heftig und andere hundert Schritt, dass ich meinte, vom Schlitten geworfen zu werden! Der Schnee wirbelte empor, dass die Luft verdunkelt ward; man sah keinen Pfad mehr. Ich konnte das Pferd nicht mehr sehen. Das war in wenigen Minuten eine gewaltige Umänderung! Noch heftiger tobte der Wind. Das wäre g’spässig, dachte ich, wenn ich jetzt noch unweit von St. Moritz sollte unter die weiße Decke zu schlafen kommen.
Das eigentlich Missliche der Sache mochte etwa drei Viertelstunden gedauert haben; senkrechte Tiefe ward erreicht, und der Wind hatte weniger Gewalt mehr; noch eine Viertelstunde tiefer, und ich meinte das Überstandene unmöglich! Es kam mir beinah vor wie ein augenblicklicher Traum, denn auf einmal war Windstille, und fleckenweiß sah man hellen Himmel. Nichtsdestoweniger war ich froh, tief unten La Punt zu erblicken. Doch hatte ich Freude, auch diese Lage erfahren zu haben, ein in jeder Hinsicht schauderhaftes Seitenstück der Sandöde in Ägypten, wenn der Chramsi den unübersehbaren Flugsand brennend emporwirbelte, den Gesichtskreis verdunkelt, der Sonne ihre Helle nimmt und man, in Glut, Hitze und Staub erstickend, keine sechs Schritte vor sich sieht, hier im Gegensatz Kälte und Schneegestöber, das Gesicht mit Eiskruste überzieht. Es ist eine eigene Sache um diese beiden Gegenstücke, und der dies schreibt, kann auch von beiden erzählen.»
Trotzdem sollte es noch einige Zeit dauern, bis St. Moritz und das Engadin als Winteraufenthaltsort populär wurden. Bis dahin waren die Winter schwer – wirtschaftlich schwer für die Bevölkerung. Im Sommer gab es die Kurgäste, gab es waghalsige Fremde, die Berge besteigen wünschten, und infolgedessen verdingten sich viele Einheimische als Bergführer.
Im Winter war eigentlich nichts zu tun, als zu überwintern.
Dass es anders wurde, ganz anders, ist das Verdienst von Johannes Badrutt.
Nachricht aus der Säule
Natürlich weiß ganz St. Moritz, wer Johannes Badrutt war, was er vollbracht hat, was man ihm verdankt. Über ihn selbst, über seinen Alltag, über sein Familienleben, über das, was er von seinen fünf Söhnen und drei Töchtern hielt, über die Menüs, die er seinen Gästen vorsetzte, über die Preislisten, die Fremdenlisten wüsste man nichts, wenn nicht Ende 1955 in seinem ersten St. Moritzer Hotel, heute das «Kulm» – damals Pension Faller genannt –, Modernisierungen hätten vorgenommen werden müssen, denen auch eine alte Säule zum Opfer fiel. Und in diese Säule hatte Badrutt ein Päckchen gelegt, das alle möglichen Dokumente und Akten enthielt. Man studierte sie, fotografierte sie wohl auch, soweit sie noch leserlich waren, und packte alles wieder in wasserdichtes Papier, das in einer neuen Säule der neuen Halle des Kulm Platz fand.
Er heiratete früh, schon 1843, und leitete zusammen mit seiner Frau Maria, Schwester des später in St. Moritz praktizierenden Dr. Peter Berry, der später eine Art Berühmtheit werden sollte, das von seinem Vater erbaute Hotel Bernina in Samedan. Die Aussicht war wundervoll, Küche und Keller vorzüglich. Aber Johannes schien das Hotel viel zu klein, er suchte nach größeren Aufgaben.
St. Moritz! Dorthin kamen damals prominente Gäste, ja, regierende Fürsten. Jedoch es waren kaum Hotels vorhanden, die ihnen Unterkunft bieten konnten. Viele mussten – wie bereits geschildert – in primitiven Bauernhäusern logieren.
Ein neues Hotel zu bauen, hätte zu viel Zeit, auch zu viel Geld verschlungen. Beides besaß der junge Johannes Badrutt nicht. Aber da gab es eine Pension Faller, deren Besitzer sie abgeben wollte. Allerdings verlangte er die Unsumme von 2000 Franken Pacht pro Jahr; dabei konnte das Haus jährlich höchstens während der zwei oder drei Sommermonate insgesamt zwölf Gäste beherbergen.
Aber Herr Faller ließ nicht mit sich handeln; das Geschäft schien geplatzt zu sein. Da rutschte Maria Badrutt, als sie das Haus verließ, auf den vereisten Stufen aus und setzte sich sehr unsanft auf einen gewissen Körperteil. Dies schien Johannes eine Art Zeichen des Himmels zu sein, nicht fortzugehen.
Faller war amüsiert, als er hörte, aus welchem Grunde sich der Sinn Badrutts gewandelt hatte, brachte aber nun seinerseits Bedenken vor. Es sei nicht gut, wenn die Öffentlichkeit – die paar Hundert Einwohner von St. Moritz – erfahren würde, dass einer, der nicht einheimisch sei – Johannes Badrutt stammte schließlich aus Samedan, einige Kilometer entfernt! –, sich in St. Moritz anzusiedeln gedenke. Ein Strohmann musste vorgeschoben werden.
Trotzdem gab es Schwierigkeiten genug mit den lieben St. Moritzern. Sie rochen sehr bald den Braten. Sie trauten Badrutt nicht über den Weg und protestierten – freilich nur an ihren Stammtischen.
1855 hatte er die Leitung der Pension Faller übernommen. Anfang 1858 tat er den entscheidenden Schritt.
Aus seinem Geschäftsmemorial des Jahres 1869: «1858, den 20. Februar, habe ich bangen Herzens, und nachdem die wenigen meiner vernünftigen Freunde und Verwandten, die ich in dieser hochwichtigen Sache befragt hatte, abgeraten, dennoch die Pension Faller in St. Moritz um Franken 58.500 ersteigert, und von dem Tag an war mein Trachten und Sinnen in St. Moritz, und ich sammelte Material, Kräfte und gute Gedanken – und meine liebe Frau unterstützte mich –, und es ist gelungen, was wir uns erträumten, das Haus zu kaufen und sofort jährlich zu bauen.»
Wetten, dass …!
Schon zwei Jahre vor Badrutts endgültiger Übersiedlung nach St. Moritz waren mitten im Winter Leute aufgetaucht, die von den St. Moritzern für verrückt gehalten wurden. Einmal waren sie Ausländer. Ferner führten sie seltsame Geräte mit sich, die sie Ski nannten und an die Füße schnallten. Und mit diesen Geräten wollten sie die verschneiten Berge hinunterrasen! Engländer offenbar – wer sonst konnte auf solche wahnwitzigen Ideen kommen! Dies jedenfalls war die Meinung der Stammtischler. Das Seltsame war, dass diese Männer – tatsächlich waren es Norweger – mit den merkwürdigen Geräten auch wirklich unten ankamen, und zwar durchwegs lebendig, wenn auch manchmal mit einem gebrochenen Bein.
Nicht alle schüttelten die Köpfe. Da war der Silser Hufschmied Pedrun, der sich schon in den nächsten Monaten eigene Ski anfertigte. Sie wurden allgemein Gianellas genannt, auch