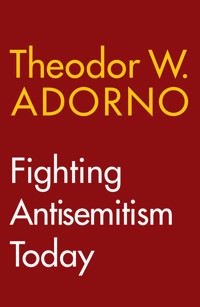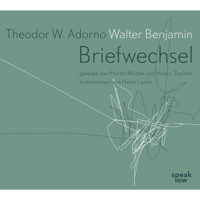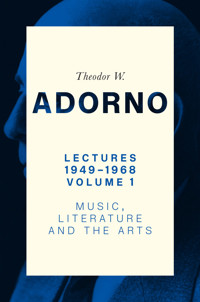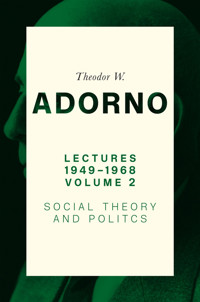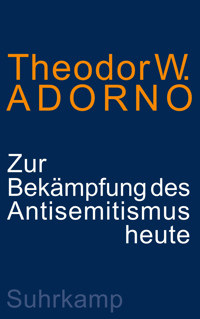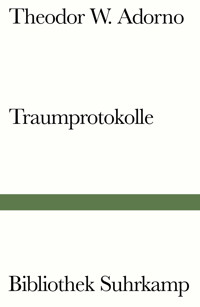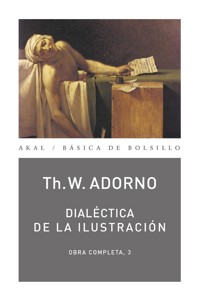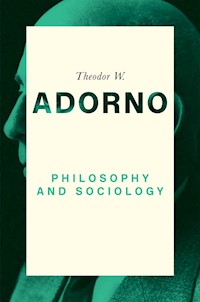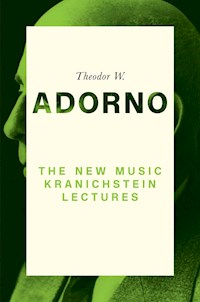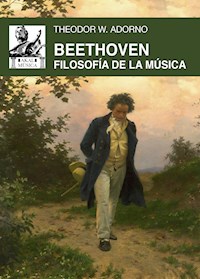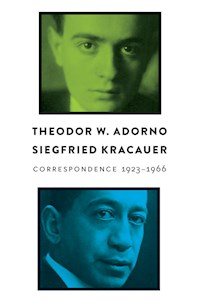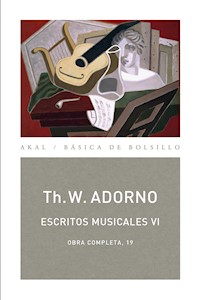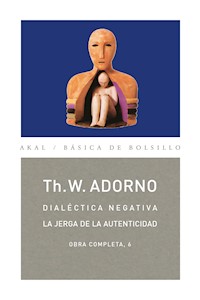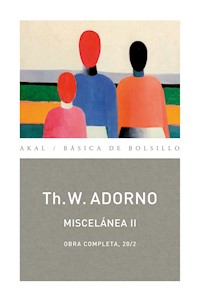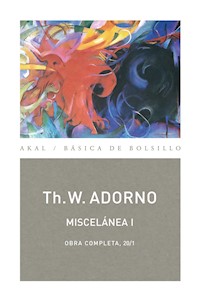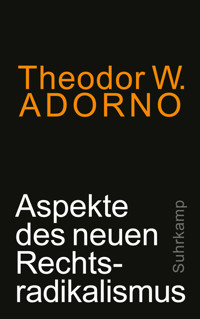
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 6. April 1967 hielt Theodor W. Adorno auf Einladung des Verbands Sozialistischer Studenten Österreichs an der Wiener Universität einen Vortrag, der aus heutiger Sicht nicht nur von historischem Interesse ist. Vor dem Hintergrund des Aufstiegs der NPD, die bereits in den ersten beiden Jahren nach ihrer Gründung im November 1964 erstaunliche Wahlerfolge einfahren konnte, analysiert Adorno Ziele, Mittel und Taktiken des neuen Rechtsradikalismus dieser Zeit, kontrastiert ihn mit dem »alten« Nazi-Faschismus und fragt insbesondere nach den Gründen für den Zuspruch, den rechtsextreme Bewegungen damals – 20 Jahre nach Kriegsende – bei Teilen der bundesdeutschen Bevölkerung fanden.
Vieles hat sich seitdem geändert, manches aber ist gleich geblieben oder heute, 50 Jahre später, wieder da. Und so liest sich Aspekte des neuen Rechtsradikalismus wie eine Flaschenpost an die Zukunft, deren Wert für unsere Gegenwart Volker Weiß in seinem Nachwort herausarbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
3Theodor W. Adorno
Aspekte des neuen Rechtsradikalismus
Ein Vortrag
Mit einem Nachwort von Volker Weiß
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Aspekte des neuen Rechtsradikalismus
Editorische Notiz
Nachwort
Über die Autoren
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
7Aspekte des neuen Rechtsradikalismus
9Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich möchte versuchen, nicht etwa mit dem Anspruch auf Vollständigkeit Ihnen eine Theorie des Rechtsradikalismus zu geben, sondern in losen Bemerkungen einige Dinge hervorzuheben, die vielleicht Ihnen nicht allen so gegenwärtig sind. Ich möchte damit also andere theoretische Interpretationen nicht außer Kraft setzen, aber ich möchte einfach versuchen, das, was man so allgemein über diese Dinge denkt und weiß, ein bißchen zu ergänzen.
Ich habe im Jahr 1959 einen Vortrag gehalten, »Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit«, in dem ich die These entwickelt habe, daß der Rechtsradikalismus dadurch sich erklärt oder daß das Potential eines solchen Rechtsradikalismus, der damals ja eigentlich noch nicht sichtbar war, dadurch sich erklärt, daß die gesellschaftlichen Voraussetzungen des Faschismus nach wie vor fortbestehen. 10Ich möchte also davon ausgehen, meine Damen und Herren, daß die Voraussetzungen faschistischer Bewegungen trotz des Zusammenbruchs gesellschaftlich, wenn auch nicht unmittelbar politisch, nach wie vor fortbestehen. Dabei denke ich in erster Linie an die nach wie vor herrschende Konzentrationstendenz des Kapitals, die man zwar durch alle möglichen statistischen Künste aus der Welt wegrechnen kann, an der aber im Ernst kaum ein Zweifel ist. Diese Konzentrationstendenz bedeutet nach wie vor auf der anderen Seite die Möglichkeit der permanenten Deklassierung von Schichten, die ihrem subjektiven Klassenbewußtsein nach durchaus bürgerlich waren, die ihre Privilegien, ihren sozialen Status festhalten möchten und womöglich ihn verstärken. Diese Gruppen tendieren nach wie vor zu einem Haß auf den Sozialismus oder das, was sie Sozialismus nennen, das heißt, sie verschieben die Schuld an ihrer eigenen potentiellen Deklassierung nicht etwa auf die Apparatur, die das bewirkt, sondern auf diejenigen, die dem System, in dem sie einmal Status besessen haben, jedenfalls nach traditionellen Vorstellungen, kritisch gegenübergestanden haben. Ob sie das heute noch tun und ob ihre Praxis das heute noch ist, das ist eine andere Frage.
11Nun, der Übergang zum Sozialismus oder, bescheidener gesagt, auch nur zu sozialistischen Organisationen ist diesen Gruppen von jeher sehr schwer geworden und ist heute, zumindest in Deutschland – und meine Erfahrungen beziehen sich naturgemäß in erster Linie auf Deutschland –, noch viel schwerer, als das früher der Fall war. Vor allem deswegen, weil ja die SPD, die deutsche sozialdemokratische Partei, mit einem Keynesianismus, einem Keynesschen Liberalismus, identifiziert ist, der auf der einen Seite zwar die Potentiale einer Veränderung der Gesellschaftsstruktur, die in der klassischen Marxischen Theorie gelegen waren, abbiegt, andererseits aber doch die Bedrohung der Verarmung, jedenfalls in der Konsequenz, für die Schichten, von denen ich gesprochen habe, verstärkt. Ich erinnere an die einfache Tatsache der schleichenden, aber doch sehr bemerkbaren Inflation, die ja eine Konsequenz eben des Keynesschen Expansionismus ist, und ich erinnere weiter an eine These, die ich eben auch in jener Arbeit vor acht Jahren entwickelt habe und die unterdessen sich doch sehr zu aktualisieren beginnt, nämlich daß trotz Vollbeschäftigung und trotz all dieser Prosperitätssymptome das Gespenst der technologischen Arbeitslo12sigkeit nach wie vor umgeht in einem solchen Maß, daß im Zeitalter der Automatisierung, die ja in Zentraleuropa noch zurück ist, aber ohne Frage nachgeholt werden wird, auch die Menschen, die im Produktionsprozeß drinstehen, sich bereits als potentiell überflüssig – ich habe das sehr extrem ausgedrückt –, sich als potentielle Arbeitslose eigentlich fühlen. Hinzu kommt natürlich noch die Angst vor dem Osten, ebenso wegen des niedrigeren Lebensstandards dort wie wegen der Unfreiheit, die ja doch unmittelbar und sehr real von den Menschen, auch von den Massen, erfahren wird, und dazu, jedenfalls bis vor kurzer Zeit, das Gefühl der außenpolitischen Bedrohung.
Es ist nun an die eigentümliche Situation zu erinnern, die herrscht mit Rücksicht auf das Problem des Nationalismus im Zeitalter der großen Machtblöcke. Innerhalb dieser Blöcke lebt nämlich der Nationalismus doch fort als Organ der kollektiven Interessenvertretung innerhalb der in Rede stehenden Großgruppen. Es ist gar kein Zweifel daran, daß sozialpsychologisch und auch real es eine sehr verbreitete Angst davor gibt, in diesen Blöcken aufzugehen und dabei auch in der materiellen Existenz schwer beeinträchtigt zu werden. Also, soweit 13es sich etwa um das agrarische Potential des Rechtsradikalismus handelt, ist die Angst vor der EWG und den Konsequenzen der EWG für den Agrarmarkt hier sicher außerordentlich stark.
Zugleich aber – und damit berühre ich den antagonistischen Charakter, den der neue Nationalismus oder Rechtsradikalismus hat – hat er angesichts der Gruppierung der Welt heute in diese paar übergroßen Blöcke, in denen die einzelnen Nationen und Staaten eigentlich nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, etwas Fiktives. Es glaubt eigentlich niemand mehr so ganz daran. Die einzelne Nation ist in ihrer Bewegungsfreiheit durch die Integration in die großen Machtblöcke außerordentlich beschränkt. Man sollte nun daraus aber nicht etwa die primitive Folgerung ziehen, daß deswegen der Nationalismus, wegen dieser Überholtheit, keine entscheidende Rolle mehr spielt, sondern im Gegenteil, es ist ja sehr oft so, daß Überzeugungen und Ideologien gerade dann, wenn sie eigentlich durch die objektive Situation nicht mehr recht substantiell sind, ihr Dämonisches, ihr wahrhaft Zerstörerisches annehmen. Die Hexenprozesse haben schließlich nicht stattgefunden in der Zeit des Hochthomismus, sondern in der Zeit der Ge14genreformation, und etwas Ähnliches dürfte es mit dem, wenn ich es so nennen darf, »pathischen« Nationalismus heute auch auf sich haben. Dieses Moment des Angedrehten, sich selbst nicht ganz Glaubenden, hat er übrigens schon in der Hitlerzeit gehabt. Und dieses Schwanken, diese Ambivalenz, zwischen dem überdrehten Nationalismus und dem Zweifel daran, der dann wieder es notwendig macht, ihn zu überspielen, damit man ihn sich selbst und anderen gleichsam einredet, das war damals auch schon zu beobachten.
Nun, aus diesen recht simplen Thesen möchte ich ein paar Konsequenzen zunächst einmal ziehen. Ich glaube, es erklärt sich nämlich aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, nämlich daß es sich im Grunde um eine Angst vor den Konsequenzen gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen handelt, das, was von Meinungsforschungsinstituten allseitig beobachtet worden ist und was auch aus unsrer eigenen Arbeit sich bestätigt hat, daß nämlich die Anhänger des Alt- und Neufaschismus heute quer durch die Gesamtbevölkerung verteilt sind. Ich glaube, daß die sehr verbreitete Annahme, es handele sich bei alldem um spezifisch kleinbürgerliche Bewegungen, wie uns zuletzt noch im französi15schen Poujadismus vor Augen gestanden hat, zwar in bezug auf, wenn ich so sagen darf, den Sozialcharakter dieser Bewegungen zutrifft, daß diese These sicherlich aber nicht zutrifft mit Rücksicht auf die Verteilung, obwohl sicherlich gewisse kleinbürgerliche Gruppen auch unter den Anfälligen sind, vor allem also kleine Einzelhändler, die durch die Konzentration des Einzelhandels in Warenhäusern und ähnlichen Institutionen unmittelbar bedroht sind. Außer den Kleinbürgern spielen sicher eine hervorragende Rolle die Bauern, die sich ja in einer permanenten Krise befinden, und ich würde denken, daß solange, wie es nicht wirklich gelingt, das Agrarproblem auf eine radikale, nämlich nicht subventionistische und künstliche und in sich wieder problematische Weise zu lösen, solange man nicht wirklich zu einer vernünftigen und rationalen Kollektivierung der Landwirtschaft gelangt, daß dieser schwelende Herd dauernd bestehen bleibt.