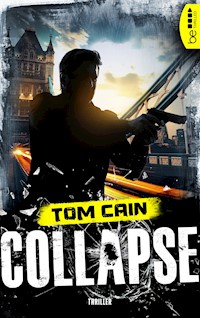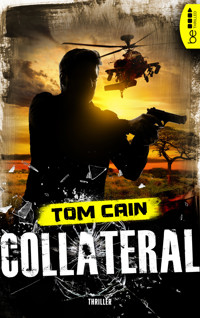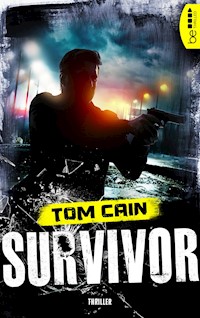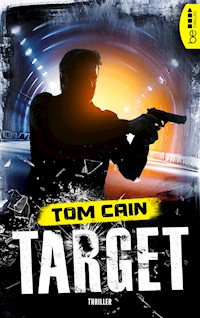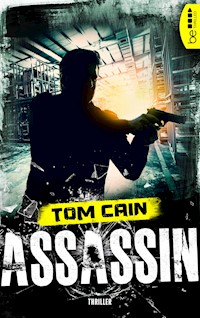
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Samuel-Carver-Reihe
- Sprache: Deutsch
Er ist unsichtbar. Er ist lautlos. Er ist tödlich. Niemand sieht ihn kommen.
In achttausend Metern Höhe fliegt Samuel Carver durch den Nachthimmel wie ein menschlicher Pfeil. Er rast nach Westen auf die amerikanische Ostküste zu. Nur wenige Gegenden auf dem Planeten beherbergen mehr militärische Feuerkraft als dieses Gebiet an der Küste. Die Küstenwache, die Navy und die Air Force besitzen hier Hunderte Kampfflugzeuge, Flugzeugträger und Atom-U-Boote. Aber Carver ist ganz allein am Himmel und konzentriert sich auf seine Mission. Er wird den Mann töten, der all diese Streitkräfte bezahlt: den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ...
Ein neuer Auftrag für Samuel Carver: Collateral.
beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Tom Cain bei beTHRILLED
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Nachbemerkung des Autors
Tom Cain bei beTHRILLED
Die Samuel-Carver-Reihe:
Band 1: Target
Band 2: Survivor
Band 3: Assassin
Band 4: Collateral
Band 5: Collapse
Über dieses Buch
Er ist unsichtbar. Er ist lautlos. Er ist tödlich. Niemand sieht ihn kommen.
In achttausend Metern Höhe fliegt Samuel Carver durch den Nachthimmel wie ein menschlicher Pfeil. Er rast nach Westen auf die amerikanische Ostküste zu. Nur wenige Gegenden auf dem Planeten beherbergen mehr militärische Feuerkraft als dieses Gebiet an der Küste. Die Küstenwache, die Navy und die Air Force besitzen hier Hunderte Kampfflugzeuge, Flugzeugträger und Atom-U-Boote. Aber Carver ist ganz allein am Himmel und konzentriert sich auf seine Mission. Er wird den Mann töten, der all diese Streitkräfte bezahlt: den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ...
beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung!
Über den Autor
Tom Cain ist Journalist und wurde für seine Arbeit mit vielen Preisen ausgezeichnet. Er hat jahrzehntelang für bekannte Zeitungen und Zeitschriften in den USA und Großbritannien geschrieben und als investigativer Journalist über Finanzskandale an der Wall Street berichtet. In seinen Action-Thrillern um den fiktiven ehemaligen Geheimagenten Samuel Carver kombiniert er packende Spannung mit realen Ereignissen wie den Tod von Prinzessin Diana oder die Finanzkrise um die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers.
Tom Cain
Assassin
Thriller
Aus dem Englischen von Angela Koonen
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2009 by Tom Cain
Titel der englischen Originalausgabe: »Assassin«
Originalverlag: Bantam Press
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2010/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt GmbH Co. KG
unter Verwendung von Motiven © OSTILL/iStock/Getty Images Plus; aga7ta/iStock/Getty Images Plus; alptraum/iStock/Getty Images Plus;
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-1750-2
www.be-thrilled.de
www.lesejury.de
Für meine Kinder
1
Lara Dashian war so niedlich wie eine Fee und so frisch und so lebendig wie eine blühende Wiese an einem sonnigen Frühlingstag. Liebevoll, gehorsam und mit achtzehn Jahren noch unbefleckt, war sie der Stolz und die Freude ihrer Eltern. Dann verließ sie ihre Heimatstadt im Westen Armeniens und bestieg den Bus in die Hauptstadt Eriwan, um dort einen Mann zu treffen, der ihr laut ihrer Tante eine gute Arbeitsstelle im Ausland besorgen wollte. Als der angebliche Gönner ihr den Ausweis und das wenige Geld abnahm und sie in den Kellerraum einer Vorstadtkneipe einschloss, erfuhr Lara auf gnadenlose Weise, dass manche Leute ein Familienmitglied verkaufen, um an einen neuen Fernseher zu kommen.
Das naive, unschuldige Mädchen, das Lara bis dahin gewesen war, gab es nun nicht mehr. Die Vergewaltigungen, die Schläge und die Drohungen, von den Menschenhändlern »eingewöhnen« genannt, hatten es zerstört. Der Zweck dieses »Eingewöhnens« ist ganz einfach: Die jungen Frauen sollen sich mit der Unvermeidlichkeit der Vergewaltigungen abfinden und begreifen, dass es überlebenswichtig ist, so zu tun, als würden sie es genießen. Lara hatte entsetzt mitansehen müssen, wie ein Mädchen, das sich mutig wehrte, totgeschlagen wurde – als Warnung an die anderen ahnungslosen Sklavinnen, mit denen sie eingesperrt gewesen war. Die alte Lara hatte sie nun für immer hinter sich gelassen, und die neue gehorchte ihrem Peiniger und ging an Bord des Flugzeugs, das sie über München nach Dubai bringen würde.
Sie hatte keine Ahnung, wo Dubai lag; das Reiseziel war ihr genauso wenig bekannt wie einem Schaf der Schlachthof. Und genau wie ein Schlachttier wechselte sie unterwegs mehrmals den Besitzer. Das Geschäft wurde in einem Café im Münchener Flughafen von dem Schwarzhändler abgeschlossen, der mit ihr von Eriwan abgeflogen war, und er verkaufte sie an einen Mann von schwerer Statur mit aufgedunsenem, unrasiertem Gesicht, der eine schwarze Lederjacke und eine dicke Goldkette um den Hals und an den Handgelenken trug.
»Das ist Khat«, sagte der Schwarzhändler.
Lara saß still dabei, als die zwei Männer um den Verkaufspreis feilschten. Während sie sich Zahlen an den Kopf waren, lachend von Kaffee zu Bier übergingen und sich amüsierten, versuchte Lara, sich mit ihrer unwirklichen Lage abzufinden. Ein Mann hatte sie in das Café gebracht, ein anderer würde sie wieder mitnehmen: ihr neuer Besitzer. In Gedanken drehte und wendete sie das Wort – »mein Besitzer« – und konnte es doch nicht begreifen. Es war doch ganz unmöglich, dass so etwas passieren konnte, wo ringsherum im Flughafen das Leben einfach weiterging, umso mehr, als sie einfach dasaß und sich verkaufen ließ. Und dennoch passierte es.
Inzwischen wurde sie jeden Tag gekauft und verkauft.
Allein in der vorigen Woche war sie mit über dreißig Männern zusammengewesen, wenn nicht sogar über vierzig. Sie zählte sie nicht mehr, sie zählte nur das Geld, das sie ihr gaben. Sie musste fünfzehnhundert Dirham pro Nacht machen, also ungefähr vierhundert US-Dollar oder zweihundertsiebzig Euro – Lara war schon ziemlich schnell beim Umrechnen von Währungen. Wenn sie diese Summe schaffte, schob Khat ihr ein billiges Fertiggericht in die Mikrowelle, bevor er sie in den kahlen Raum sperrte, wo sie und seine drei anderen Prostituierten die Tage verbrachten. Wenn nicht, dann gab es gemeine Schläge in den Magen, bei denen sie sich weinend und würgend auf dem Nylonteppich wand.
Jetzt stand ihr ein neuer Verkauf bevor. Am Abend war Khat ins Zimmer gekommen, aufgekratzt, aber auch nervös. Er hatte sich die Mädchen der Reihe nach angesehen, kurz überlegt und dann auf Lara gezeigt. »Du«, sagte er. »Zieh dich an, deine besten Sachen, und gib dir besondere Mühe beim Schminken. Du kommst mit mir.«
Auf dem Weg nach draußen erzählte er ihr dann, dass ein reicher Engländer in Dubai sei, der ausgezeichnete Beziehungen zu den Mächtigen der Stadt habe. Der wolle ein Mädchen für den eigenen Gebrauch kaufen und sei bereit, bis zu dreißigtausend Euro auszugeben, sofern es genau die Richtige war.
Bei der Summe hatte Lara staunend Luft geholt. Die Prostituierten brachten zwar allerhand ein, aber weil so viele Frauen auf dem Markt waren, konnte man sie schon für den Preis eines rostigen Gebrauchtwagens kaufen. In München hatte sie nur 2800 Euro erzielt, einschließlich der Flugkosten. Kein Wunder, dass Khat angespannt war. Wenn Lara dem Käufer gefiel, würde Khat zehnmal so viel bekommen, wie er für sie bezahlt hatte.
»Aber wenn ich dich wieder mitnehmen muss«, er lächelte sie kalt und höhnisch an wie ein Wolf seine Beute, »kriegst du solche Prügel, dass du denkst, ich habe dich vorher nur gekitzelt.«
2
Vor fünfzig Jahren war Dubai ein staubiger, unbedeutender Fleck auf der Landkarte vom Persischen Golf gewesen. Als das einundzwanzigste Jahrhundert anbrach, war es die am schnellsten wachsende Stadt der Welt. Es verging keine Woche, in der nicht ein neues Fünf-, Sechs- oder Sieben-Sterne-Hotel eröffnet wurde, und jedes wurde als noch luxuriöser angepriesen als das vorige. Zwischen so viel aufdringlicher Extravaganz war das Karama Pearl ein schlichter Bau mit nur zwölf Stockwerken und nicht gerade das Haus, in dem man einen reichen Besucher zu Geschäftsverhandlungen erwarten würde. Es hatte jedoch eine Besonderheit, die es in Dubai heraushob: einen Nachtklub, der, wenn man Prostituierte abschleppen wollte, die erste Adresse der Stadt war.
Auch heute Abend schlenderten die Nutten dort von Tisch zu Tisch auf der Suche nach einem guten Geschäft. Die Stars warteten oben an der Theke, die sich an einer Seite des Klubs entlangzog. Da standen auch sechs Zuhälter, alle mit ihrem kostbarsten Besitz: sechs Schacherer, die um die Kundschaft eines Ausländers auf dem Frauenmarkt buhlten.
Die jungen Frauen, die zum Verkauf standen, musterten einander mit prüfendem Blick, und jede hatte die gleiche Angst zu versagen, wie Lara, denn sie wussten, dass nur eine es schaffen würde. Sie schüttelten ihre Haare oder spielten mit einer Strähne. Wenn sie unruhig die Haltung wechselten, klapperten ihre Absätze auf dem Boden wie die Hufe nervöser Rennpferde, die an den Start geführt werden.
Drüben auf der anderen Seite der Tanzfläche saß der Mann, für den die ganze Vorstellung veranstaltet wurde. Lara schätzte ihn auf Ende dreißig. Er trug ein weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, eine verwaschene Jeans und Mokassins. Sie sah keinen Schmuck an ihm außer einer Uhr. Er hatte kurze dunkle Haare und scharfkantige Gesichtszüge, die vermuten ließen, dass der Körper unter der Kleidung gut trainiert war. Nur sein Mund, der mürrische Ausdruck seiner vollen Lippen, vertrug sich nicht mit dem übrigen Eindruck. Lara konnte die Gesichter von Männern mittlerweile sehr gut deuten. Dieser hier hatte vielleicht einen Hang zur Grausamkeit, dachte sie. Doch er sah gut aus, das ließ sich nicht bestreiten, und er wirkte wohlhabend.
Sie wunderte sich, wieso er sich ein Mädchen kaufen wollte, wenn sich ihm doch sicher viele Frauen mit Vergnügen umsonst hingeben würden. Vielleicht war er verheiratet, oder er zog es vor, zu bezahlen, was er brauchte. Manche ihrer Stammkunden fanden, dass Sex dadurch einfacher wurde. Alle Frauen kosten Geld, meinten sie, aber bei einer Hure weiß man im Voraus, wie hoch die Rechnung ist.
Lara fand es selbst jetzt noch befremdlich, dass sie gemeint war, wenn die Männer von einer Hure redeten.
Neben dem Käufer lümmelte sich ein Inder, dessen dickliche lächelnde Wangen das raubtierhafte Funkeln der Augen nicht überspielen konnten. Khat hatte sie auf ihn aufmerksam gemacht, gleich als sie in den Klub gekommen waren.
»Das ist Tiger Dey. Er hat fast sämtliche ausländischen Arbeitskräfte in Dubai unter sich: die Bauarbeiter, die Zimmermädchen in den Hotels ...« Khat hatte ihr einen bedauernden, fast resignierten Blick zugeworfen, den sie noch nie bei ihm gesehen hatte. »Auch dich und mich. Du gibst zwar mir jede Nacht das Geld, aber eigentlich arbeitest du für ihn.«
Jetzt schauten Dey und der Engländer zur Theke und musterten die Kandidatinnen, wobei sie sich ab und zu beredeten. Sie konnte sehen, dass Dey versuchte, auf ihn einzuwirken, und seine Argumente mit knappen Bewegungen der rechten Faust unterstrich. An der anderen Hand baumelte die Kirsche aus seinem Cocktail zwischen Daumen und Zeigefinger. Das sah albern aus, und vielleicht musste der Engländer deshalb so schmunzeln, als er sich mit einer ironischen Geste Deys Argumenten fügte.
Der Inder lehnte sich auf der samtgepolsterten Sitzbank zurück, schob sich die Kirsche in den Mund und warf den Stiel weg. Dann hob er den Finger, um einen der Leibwächter heranzuwinken, die um seinen Tisch postiert waren, zeigte zur Theke und schickte ihn dorthin.
Lara fand bald heraus, warum Dey so eindringlich gewesen war. Eine der Prostituierten war Inderin. Sie war ein hübsches Ding mit üppigen Kurven, sinnlichen Gesichtszügen und türkisgrünen Augen, die ihre makellose braune Haut überstrahlten. Der Leibwächter blieb bei ihr stehen und zeigte mit dem Daumen auf den Tisch, an dem sein Boss saß. Als die Inderin hinüberschlenderte, ballte ihr Besitzer triumphierend die Faust.
Khat schnaubte verächtlich. »Die wird es nicht.« Er blickte zu dem Käufer, bei dem die Kleine soeben ankam. »Der will weißes Fleisch. Ich kenne den Typ.«
Kurz darauf bestätigte sich, dass er recht hatte. Die Inderin ging zurück zur Theke. Ihre Überheblichkeit war bereits in verzweifelte Anbiederung umgeschlagen. Ihr Zuhälter beschimpfte sie und schlug ihr hart ins Gesicht. Als sie anfing zu weinen, packte er sie am Oberarm und zog sie zum Ausgang. Dabei flehte sie ihn, von Schluchzern unterbrochen, inständig an. Niemand rührte einen Finger, um ihm Einhalt zu gebieten. Was ein Mann mit seinem Besitz anstellte, war allein seine Sache.
Doch Lara hatte keine Zeit, über das Schicksal der Inderin nachzudenken. Drüben an dem Tisch zeigte der Engländer mit dem Finger auf Dey, als ob er sagen wollte: »Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt«, und diesmal war es sein Gastgeber, der sich achselzuckend fügen musste. Der Leibwächter wurde erneut zur Bar geschickt.
Diesmal zeigte er auf Lara.
Einen Moment lang war sie wie gelähmt. Dann versetzte Khat ihr einen harten Stoß, sodass sie über den glatten Tanzboden schlitterte. Aber sie fing sich noch, zog ihren winzigen hautengen Rock zurecht und ging auf die zwei Männer zu, die jetzt ihr Leben in der Hand hatten. Die grinsten breit über Laras Versuche, ihr bisschen Würde wiederherzustellen.
Lara hoffte, dass das ein gutes Zeichen war. Sie gab sich Mühe und lächelte zurück.
Der Engländer klopfte neben sich auf das Samtpolster und bedeutete ihr, sich zu setzen. Lara drehte ihm den Oberkörper zu, wie man es ihr beigebracht hatte, legte die Hand auf die Innenseite seines Oberschenkels und beugte sich so vor, dass sie mit der Brust seinen Arm streifte, wobei sie ein lustvolles Keuchen vorspielte.
Sie wartete einen Augenblick auf die Reaktion, die dieses aufdringliche Zeichen der Verfügbarkeit gewöhnlich auslöste. Doch als der Mann ihre Hand nahm, tat er es nicht, um sie in Richtung Schritt zu ziehen, sondern er schob Lara sanft zurück, bis sie in aufrechter Haltung dasaß. Lara konnte nicht verhindern, dass die Angst vor Zurückweisung über ihr Gesicht huschte, aber der Engländer lächelte, und diesmal viel sanfter. »Schon gut, keine Sorge«, sagte er und sah sie dann fragend an. »Du sprichst doch Englisch, oder?«
»Ein bisschen«, sagte Lara, die ihr Schulenglisch schon um einen ganz neuen Wortschatz erweitert hatte.
»Gut. Wie heißt du?«
»Lara.«
»Tag, Lara«, sagte er. »Mein Name ist Carver.«
3
Der Engländer namens Carver betrachtete Lara von oben bis unten. Sein Gesicht verriet nichts davon, was er dachte.
»Ich sehr gut mit Sex«, platzte sie heraus, da sie nicht wusste, was sie sonst sagen sollte. »Sie mich nehmen bitte, wir haben viel Spaß.«
Carver musste lachen. Er sah an ihr vorbei zu Tiger Dey und sagte: »Eins muss ich ihr lassen: Sie ist enthusiastisch.«
Als der Inder grinsend zustimmte, wandte Carver sich wieder ihr zu, beugte sich zu ihr hin und murmelte wie zu sich selbst: »Aber nicht wirklich, stimmt's, Lara? Das sehe ich dir an.«
Lara war verwirrt und wusste nicht mehr, ob sie ihre Sache gut machte oder schlecht. Das Gesicht dieses Mannes war unergründlich. Zuerst hatte sie gedacht, seine Augen seien blau, aber aus der Nähe konnte man sie auch für grün halten. In dem schummrigen Licht des Klubs war das schwer zu unterscheiden. Auf jeden Fall stimmte etwas nicht so ganz damit. Sie wirkten fast ein bisschen unnatürlich.
Ehe sie der Sache auf den Grund kam, wurde sie von einer flüchtigen Bewegung abgelenkt, die sie nur aus den Augenwinkeln wahrnahm. Während Carver ihr ins Gesicht sah, schien er etwas mit dem Glas neben sich anzustellen. Dann war der Moment vorbei.
»Sie gefällt mir«, sagte Carver zu Tiger Dey und lehnte sich wieder zurück. »Ich nehme sie ... meine kleine Lara«, fügte er hinzu und gab ihr einen freundlichen Klaps auf den nackten Oberschenkel.
Lara lächelte ihn nervös an. Sie wagte kaum zu glauben, dass er sie ausgesucht hatte, zumal sie nicht sicher wusste, ob die Sache schon abgemacht war.
»Was meinen Sie, was ihr Gorilla für sie haben will?«, fragte Carver.
Tiger Dey lächelte. »Er will haben, was ich ihm sage. Sie geben mir dreißigtausend, und ich gebe ihm die Hälfte. Der traut sich nicht, sich zu beschweren.«
»Ausgezeichnet«, sagte Carver, und Lara, die ihn beobachtete, bekam erneut den Eindruck, dass etwas an ihm nicht stimmte. Sie begriff, dass er sich verhielt, wie sie es oft tat: Er schauspielerte. Aber warum? Und was bedeutete das für sie?
Ihr war sofort klar, dass solche Fragen sinnlos waren. Ihre Hoffnung lag darin, dass sie ihm gefiel. Darum setzte sie ein glückliches Gesicht auf und kicherte verführerisch, als er sie fragte, ob sie das mit einem Gläschen feiern wollten, und ebenso, als Carver den Kellner bat, eine Kirsche hineinzutun.
»Nein, nein, Engelchen, die ist nicht für dich«, erklärte er. »Die ist für Tiger. Er kann Kirschen nicht widerstehen, was, Partner?«
»In der Tat, eine fatale Schwäche«, pflichtete der Inder bei.
»Mal sehen, was haben wir denn da?«, sagte Carver, griff in sein ausgetrunkenes Glas und fischte so eine wächserne rote Frucht am Stiel heraus. »Hier, die geht auf meine Rechnung!«
Er warf sie über den Tisch. Tiger Dey fing sie auf und steckte sie unter einem Beifallsruf von Carver in den Mund, während Lara aufgeregt quietschte und klatschte.
Als sich die Heiterkeit gelegt hatte, griff Carver in die Innentasche seines Jacketts, holte einen prall gefüllten Umschlag heraus und schob ihn über den Tisch. »Dreißig Riesen in Fünfhundert-Euro-Scheinen«, sagte er, als Tiger Dey den Umschlag nahm. »Ich versuche gar nicht erst, den Preis zu drücken.«
»Sie würden am Ende nur noch mehr bezahlen. Die ist ihr Geld auf jeden Fall wert.«
Kurz darauf wurde Khat an den Tisch geholt und bekam seinen Anteil. Lara sah genau, wie er seinen Drang, sich zu beschweren, unterdrückte.
Also hat auch er Angst, dachte sie und schwelgte in dieser Vorstellung. Dann hörte sie Dey sagen: »Sie gehört Ihnen, mein Freund. Machen Sie mit ihr, was Sie wollen.«
»Wenn das so ist, will ich gleich mal ausprobieren, was ich da gekauft habe.« Carver sah Lara an und äffte den gönnerhaften Tonfall eines Ehemanns nach, der mit seiner Frau redet: »Trink aus, Schatz, ich glaube, wir müssen gehen.«
Er nahm sie bei der Hand, um ihr vom Tisch aufzuhelfen, und legte den Arm um ihre Taille. So verließen sie den Nachtklub, gingen durch die Hotelhalle und stiegen in den Lift zu seiner Suite im obersten Stock.
Als Carver ihr die Tür aufhielt und sie ins Zimmer führte, wurde ihr erst richtig klar, dass sie nie wieder in Khats Wohnung zurückmusste und dass es vorbei war mit dem Eingesperrtsein und mit den Schlägen. Heute Nacht brauchte sie keine fünfzehnhundert Dirham zu machen. Sie brauchte bloß in diesem fremden, beunruhigenden, gut aussehenden Mann den Wunsch zu wecken, sie zu behalten. Wenn sie sehr gut war, würde er sie vielleicht zu seiner richtigen Freundin machen oder sogar zu seiner Ehefrau. Ihre Augen flossen über, sie wusste nur nicht, ob vor lauter Erleichterung oder aus Hoffnung oder einfach nur, weil sie weit weg war von zu Hause und zu Tode erschöpft.
Carver fuhr mit dem Finger unter ihren Augen entlang und wischte die Tränen weg. »Nicht weinen«, sagte er. Dann nahm er sie in die Arme.
Es begann als tröstliche Umarmung, aber bald drückte er sie fester an sich, und Lara stellte überrascht fest, dass sie den Druck erwiderte. All die Male, wo sie mit Männern zusammengewesen war, hatte sie immer getan, was sie wollten, egal, wie sehr es sie angewidert oder wie sehr es wehgetan hatte. Denn die Folgen einer Weigerung wären noch schlimmer gewesen.
Wollte sie diesem Mann, der sie jetzt nahm, also auch aus Angst gefallen? Als er sie hochhob und durchs Zimmer trug, schlang sie die Arme um seinen Hals und zog sich an seinen Mund heran, sodass er lachend ausweichen musste, um sehen zu können, wohin er ging. Und dann ließ er sie ganz sacht auf das Bett hinunter.
4
Lara lag mit geschlossenen Augen da und erwartete, ihn jeden Moment auf sich zu spüren. Sie fragte sich, ob es anders sein würde als sonst. Sie brauchte eine Weile, um zu begreifen, dass er sich nicht zu ihr ins Bett legen wollte. Sie machte die Augen auf. Er stand vollständig bekleidet da und zog ein paar Geldscheine aus seiner Brieftasche.
»Das ist für dich«, sagte er und legte das Geld auf den Nachttisch. »Zwanzigtausend Dirham. Ich muss jetzt gehen.«
Es dauerte ein oder zwei Sekunden, bis Lara verstand, was das bedeutete. Er wollte sie verlassen. Sie hatte irgendwie versagt. Er würde sie Khat wiedergeben und sein Geld zurückverlangen. Erschrocken setzte sie sich auf und zog die Bettdecke über ihre Brust.
»Ich nicht gut?«, fragte sie. »Ich nicht gefallen?«
»Du warst sogar sehr gut«, sagte Carver. »Darum lasse ich dich frei.«
»Aber Khat, Mr Dey, wenn sie herausfinden –«
Carver legte zwei Finger auf ihre Lippen. »Schsch, keine Angst, sie werden dir keine Schwierigkeiten machen. Verstehst du?«
Lara verstand kein Wort. Sie wusste nur, welche Strafe auf Versagen stand, und die Tränen strömten schon wieder. Carver nahm einen Hotelkugelschreiber vom Tisch und schrieb etwas auf einen Bogen Papier.
»Hör zu«, sagte er. »Das ist wichtig. Hörst du zu?«
Sie nickte unglücklich.
»Gut. Das ist die Adresse eines Hauses, es heißt Haus der Freiheit. Das ist eine Zuflucht für Frauen, die verkauft worden sind, also die jemand gezwungen hat, hierherzukommen und sich mit Männern einzulassen. Es ist in Jumeirah, nicht weit von hier. Ich will, dass du dorthin gehst. In ein paar Tagen wird die Polizei kommen und mit dir sprechen. Du hast nichts zu befürchten. Sie wollen nur hören, ob du wirklich verkauft worden bist. Aber sag ihnen nichts von mir, klar? Das ist wichtig. Sag, dass du deinem Besitzer weggelaufen bist. Sag, dass du nach Hause willst. Sie werden dir helfen.«
Lara sah ihn zutiefst verzweifelt an. »Ich kann nicht nach Hause. Meine Familie wird sagen, dass ich ein schlimmes Mädchen bin, eine Hure.«
»Hier«, sagte Carver und zog noch mehr Geld aus der Brieftasche. »Das sollte ihre Meinung ändern.«
Lara wischte sich die Tränen aus den Augen und den Rotz von der Nase. Dann stellte sie die Frage, die sie beschäftigte, seit sie ihn im Nachtklub zum ersten Mal gesehen hatte. »Wer sind Sie? Warum ... Sie tun das alles?«
»Das wird nicht verraten«, antwortete er lächelnd. »Aber du kannst mich Pablo nennen, wie alle meine Freunde.«
»Geh nicht weg, Pablo«, bat sie. »Bitte ...«
»Es tut mir leid, ich muss arbeiten. Aber du kannst noch eine Weile hierbleiben, wenn du magst. Geh duschen. Lass dir etwas zu essen kommen. Mach dir keine Sorgen wegen der Rechnung. Aber bleib nicht länger als eine Stunde. In einer Stunde gehst du, einverstanden?«
Lara nickte. »Eine Stunde höchstens.«
»Braves Mädchen.«
Er ging zur Tür, zog sie halb auf und hielt inne. »Auf Wiedersehen, Lara. Und viel Glück.«
Ehe sie »Auf Wiedersehen, Pablo« sagen konnte, war er fort.
Im Lauf der nächsten Stunden bekam Tiger Dey heftige Bauchschmerzen. Sie waren das erste Symptom einer Rizinvergiftung. Die Dosis von einem Milligramm – ein Mehrfaches der tödlichen Menge – war in einem knapp zwei Millimeter großen Dragee enthalten gewesen, das bei Körpertemperatur zerging, und das hatte in der Maraschinokirsche gesteckt, die ihm ein Auftragsmörder gegeben hatte, den er als Carver kannte.
Rizin bewirkt, dass sich Proteine aus den Zellen abspalten, sodass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Es gibt kein Gegengift. Das Rizin wandelt sich im Körper rasch um, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Vergiftung ist an den Symptomen erkennbar, die im Falle von Tiger Dey mit Erbrechen und blutigem Durchfall begannen. Innerhalb von zwei Tagen versagten bei ihm Nieren, Leber und Milz.
Sein halb legendärer Ruf, die Auseinandersetzungen in seinem Dunstkreis und die grausige Unausweichlichkeit seines Ablebens zogen jene breite Medienaufmerksamkeit nach sich, die Dubais Machthaber nicht sonderlich schätzten. Vor dem Krankenhaus drängten sich Kameraleute und Reporter. Drinnen taten die Ärzte ihr Bestes, um Deys Schmerzen zu lindern. Davon abgesehen konnten sie nichts für ihn tun. Es gibt wenige angenehme Arten zu sterben, diese jedoch ist eine der schlimmsten.
Khat, der eigentlich Kajoshaj Bajrami hieß, fand ein gnädigeres Ende. Er bekam aus nächster Nähe einen Schuss in den Hinterkopf, als er auf dem Parkplatz hinter dem Karama Pearl zu seinem Wagen ging. Niemand hörte den schallgedämpften Schuss oder sah seinen Mörder. Aber seine Brieftasche fehlte, und mehrere Zeugen bestätigten, dass Khat den Abend in der Kellerbar des Hotels verbracht und sich vor jedem, der es hören wollte, gebrüstet hatte, er habe gerade von Tiger Dey fünfzehntausend Cash für eine Nutte bekommen, für die er nicht mal dreitausend bezahlt habe und deren beste Tage schon vorüber seien. Den Täter hatte man zwar noch nicht, aber das Mordmotiv war klar.
Um 1.55 Uhr hielt der Mann, der sich Samuel Carver oder Pablo nannte, bei einem Müllcontainer hinter einem Fast-Food-Restaurant im Deira-Viertel nördlich des Flughafens. Er warf eine braune Perücke hinein und sorgte dafür, dass sie unter einem Haufen stinkender Abfälle verschwand. Die grünen Kontaktlinsen hatte er schon ins Klo gespült und das weiße Hemd gegen ein schwarzes getauscht. In seiner natürlichen Haar- und Augenfarbe fuhr er zum Flughafen. Da er online eingecheckt hatte und nur Handgepäck bei sich trug, hatte er genügend Zeit, die Sicherheitskontrollen hinter sich zu bringen und den 2.45-Uhr-Flug nach London zu erreichen. Sein Ticket war auf den Namen Damon Tyzack ausgestellt.
Müde von der Arbeit, aber zufrieden mit dem Ergebnis, ließ sich Tyzack in der First-Class-Privatkabine nieder, lehnte sich in den Sitz und fiel kurz darauf in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
5
Mehrere Tausend Meilen weiter in westlicher Richtung schoss Samuel Carver durch den Nachthimmel wie ein menschlicher Pfeil. In jeder Sekunde legte er 53 Meter zurück und kam der Erdoberfläche 15 Meter näher.
Sechs Wochen lang hatte er geplant und geübt, war nach und nach untergetaucht und hatte sich von der Außenwelt abgekoppelt. Keiner, der ihn kannte, wusste, wo Carver sich aufhielt. Wer ihn zuletzt gesehen hatte, ahnte nichts von seiner wahren Identität. Die gemietete De Havilland Twin Otter, aus der er in achttausend Meter Höhe abgesprungen war, flog von Richmond in Virginia zu den Bermudas, die mehrere Hundert Kilometer weit draußen auf dem Meer lagen. Die Besatzung bestand aus Männern, die nach denselben Grundsätzen arbeiteten wie Carver. Sie erledigten ihren Auftrag, nahmen das Geld und hielten den Mund. Sie wussten nicht, was er tun würde, nachdem er das Flugzeug verlassen hatte, und sie wollten es auch nicht wissen. Sie brachten ihn zur vereinbarten Zeit an eine bestimmte Stelle und flogen weiter.
Jetzt lag er bäuchlings mit gestrecktem Rücken, den Kopf leicht nach unten geneigt, in der Luft, um eine möglichst stromlinienförmige Gestalt einzunehmen und um die maximale Geschwindigkeit zu erzielen. Die Arme hatte er in einem Winkel von 45 Grad nach hinten gestreckt, die Beine weit gespreizt. Eine dünne Haut aus Ripstop-Nylon bildete eine Art Flügel zwischen Armen und Oberkörper und vom Schritt bis zu den Fußgelenken. Er hatte noch vier Minuten Zeit, bis er sein Landegebiet erreichte. Bis dahin konnte er noch auf etliche Arten sterben.
Je höher man kommt, desto kälter wird es: ungefähr zwei Grad pro dreihundert Meter Höhe. Durch die Geschwindigkeit wird das Problem der kalten Luftströmung noch schlimmer. Carver war der gleichen Erfrierungsgefahr ausgesetzt, als würde er am Südpol die Forschungsstation verlassen und in einen arktischen Schneesturm geraten. Sein einziger Schutz vor der durchdringenden Kälte bestand in den zwei Lagen Thermounterwäsche unter dem Nylon seines Flügelanzugs.
Zudem wird die Atmosphäre mit der Höhe dünner. Das kann zu Sauerstoffmangel und schließlich zu Bewusstlosigkeit führen. Ein bewusstloser Fallschirmspringer im Wingsuit stürzt genauso hilflos zur Erde wie ein angeschlagenes Flugzeug. Carvers Fallschirm sollte sich in sechshundert Metern Höhe automatisch öffnen, doch wenn seine Körperhaltung unstabil war, würden sich die Leinen und der Schirm um ihn wickeln wie Spinnfäden um eine Fliege. Dann wären sie nur noch eine Verpackungsfolie für seine zerschmetterte Leiche.
Um Sauerstoffmangel zu verhindern, hatte Carver einen Vorrat dabei. Doch die Sauerstoffmaske konnte bei der extremen Kälte vereisen und ihren Benutzer blind und orientierungslos machen. Auch das konnte zu einem tödlichen Kontrollverlust führen.
Durchgeschüttelt und wie taub von der vorbeiströmenden Luft und kältestarr wie ein tiefgefrorenes T-Bone-Steak, fragte er sich, was es überhaupt noch für einen Unterschied machen würde, wenn er blind wäre. Wenn er nach unten schaute, war da nichts als die unendliche Schwärze des Atlantischen Ozeans. Doch dann tauchte rechts von ihm ein Funken Licht auf, das mit jeder Sekunde größer und heller wurde, und damit war er imstande, sich zu orientieren.
Er flog nach Westen auf die amerikanische Ostküste zu, aber noch immer so hoch, dass er die Erdkrümmung ausmachen konnte. Links von ihm markierten die verstreuten Lichter von Straßen und Häusern und ein schwacher grauer Streifen eine sandige Uferlinie. Das waren die Outer Banks, eine Kette vorgelagerter Inseln, die sich um die Küste North Carolinas wand und einen breiten Streifen Wasser zwischen sich und dem Festland einschloss. Die Lichter, die er rechter Hand nach Norden zu hinter der Grenze von Virginia glitzern sah, waren die Städte Virginia Beach, Norfolk, Hampton und Newport News.
Nur in wenigen Gegenden auf dem Planeten gab es eine solche Konzentration von militärischer Feuerkraft wie in diesem städtischen Ballungsgebiet an der Küste, wo die Chesapeake Bay sich zum Atlantik hin öffnete. Die Küstenwache, die Navy und die Air Force unterhielten hier Tausende Quadratkilometer an Basen mit Hunderten Kampfflugzeugen und Flottenverbänden, Flugzeugträgern, Kreuzern, Zerstörern und Atom-U-Booten. Aber Carver flog ganz allein am Himmel, und sein Ziel war der Mann, den zu schützen diese Streitkräfte bezahlt wurden.
6
»Sehen Sie das Bild da drüben?« Präsident Lincoln Roberts zeigte auf eine alte Fotografie in einem dunkel gebeizten Holzrahmen, die in einer Sammlung persönlicher Erinnerungsstücke an der Wand des privaten Arbeitszimmers in Lusterleaf hing, seinem Familiensitz bei Knotts Island in North Carolina. Auf dem schwarz-weißen Abzug standen an die zwanzig Afroamerikaner vor einem Haus versammelt, das aus grob zusammengenagelten Brettern bestand. Zwei erwachsene Männer, der Rest Frauen und Kinder jeden Alters, von der Großmutter bis zum Säugling.
»Sicher«, sagte Harrison James. »Es hängt da, solange ich Sie kenne.«
»Das stimmt, aber ich habe Ihnen noch nie etwas darüber erzählt, wenn ich mich recht entsinne.« Der Präsident grinste unerwartet. Ein jungenhafter Übermut erhellte sein Gesicht: ein Sechsundfünfzigjähriger mit der Miene eines Teenagers. »Sehen Sie, alle diese Leute sind Sklaven. Das Foto wurde auf der Gloucester-Hall-Plantage in Bertie County aufgenommen, hinter dem Sund, 1860 oder 61, auf jeden Fall zurzeit der Sezession. Sehen Sie sich die Frau in der Mitte an, die auf der Bank sitzt und das Baby hält. Sie hieß Hattie MacInstry. Das Land gehörte einer schottischen Familie. Von der hat sie den Namen übernommen. Das Kind auf ihrem Schoß ist Adelaide MacInstry. Ihr späterer Familienname war Roberts. Ich bin ihr Ururenkel. Ihr Vater war der Plantagenaufseher, ein Mann namens Obadiah Jakes. Ein Weißer.«
Sein Stabschef stieß einen leisen Pfiff aus und schüttelte den Kopf. »Mein Gott, Linc, das ist eine fantastische Geschichte! Von der Plantage ins Weiße Haus. Ich meine, das ist ... das ist Amerika, Linc, da sieht man es wieder. Tolles Foto! Wenn wir das im Wahlkampf gehabt hätten.«
»Genau darum habe ich Ihnen nicht eher davon erzählt. Ich wusste, was Sie tun würden. Aber wir hätten keinen Wahlkampf führen können, bei dem es darum ging, Rassenunterschiede zu überwinden, wenn wir gleichzeitig ein Foto meiner Ururoma auf einer Sklavenplantage an die Öffentlichkeit bringen.«
»Warum sprechen wir dann jetzt darüber?«
Der Präsident sah ihm direkt in die Augen. »Weil ich vorhabe, den Kampf gegen Sklaverei zu einer der zentralen Säulen meiner Außenpolitik zu machen. Ich will einen weltweiten Kreuzzug für die Freiheit führen und die Macht unserer großartigen Nation zum Guten nutzen.«
Was Harrison James auch erwartet haben mochte, damit hatte er jedenfalls nicht gerechnet. »Wissen Sie, das hätten Sie mir früher sagen können. Ich meine, eben haben Sie noch gesagt, wir machen keinen Wahlkampf mit dem Rassenthema. Und wir wollen unsere erste Amtszeit ganz bestimmt nicht darauf gründen.«
»Das werden wir auch nicht, denn es geht nicht um Rassen«, erwiderte Roberts jetzt vollkommen ernst. »Es geht um Humanität. Afrikaner, Europäer, Inder, Chinesen sind alle Kinder dieser Erde und werden in sämtlichen Staaten auf der Welt, einschließlich unseres eigenen, gekauft und verkauft. Damit werden jährlich mindestens dreißig Milliarden Dollar gemacht. Wissen Sie, wie viele Sklaven in den vier Jahrhunderten, bis der Handel verboten wurde, von Westafrika in dieses Land gebracht wurden? Ungefähr sechshundertfünfzigtausend. Und wissen Sie, wie viele Menschen im 21. Jahrhundert in einem einzigen Jahr über Staatsgrenzen hinweg verkauft werden? Achthunderttausend. Aktuell schätzen die Vereinten Nationen, dass heutzutage weltweit fast dreizehn Millionen Männer, Frauen und Kinder in Sklaverei leben. Manche glauben, dass es in Wirklichkeit sogar doppelt so viele sind. Das ist eine Schande, Hal, ein Makel auf unser aller Gewissen, und ich habe vor, ihn zu tilgen.«
Der Ton in der Stimme des Präsidenten war immer eindringlicher geworden. Er war groß und kräftig gebaut und gesegnet mit der Ausstrahlung eines Oberbefehlshabers und der Rhetorik eines mitreißenden Predigers. Wenn er einmal Vollgas gab, war er nicht mehr aufzuhalten. Harrison James versuchte, die Bremse zu ziehen, solange es noch ging.
»Aber, Linc, das ist doch nichts Neues. Das State Department gibt schon seit Jahren Berichte über den Menschenhandel heraus. Wir haben auf andere Staaten Druck ausgeübt, haben Hunderte Millionen Dollar ausgegeben, um diese Kriminellen zu bekämpfen –«
»Ja, ganz recht, wir haben mehrere Jahre lang insgesamt Hunderte Millionen Dollar ausgegeben«, unterbrach Roberts. »Aber wir geben jedes Jahr Hunderte Milliarden für Verteidigung aus und für den Krieg gegen den Terrorismus, das ist tausendmal so viel. Es ist höchste Zeit, dass wir die Welt anders betrachten. Wir müssen etwas Gutes tun, damit wir stolz darauf sein können, wer wir sind und wofür wir stehen. Jeden Tag leiden und sterben Tausende in der Sklaverei. Was ist amerikanischer und patriotischer, als aufzustehen und zu sagen: Das passiert nicht während meiner Wache!?«
Jetzt war zum ersten Mal ein schiefes Lächeln in James' Gesicht zu sehen. »Das hört sich an, als hätten Sie eine Weile an dieser Rede gearbeitet. Dann sollten wir lieber einen Weg suchen, wie wir das dem Capitol, dem amerikanischen Volk und der restlichen Welt verkaufen wollen.«
»Das habe ich schon getan«, sagte Roberts. »Nächsten Monat findet im englischen Bristol eine Konferenz zum Thema Menschenhandel statt.«
»Sicher, wir schicken eine Delegation hin.«
»Ich will dort eine Rede halten.«
»Nächsten Monat? Aber, Linc – Mr President, Ihr Terminplan steht schon fest. Ich meine –«
»Dann ändern Sie ihn eben. Sorgen Sie dafür.«
Der Stabschef vergaß alle freundschaftlichen Gefühle und wurde zum Untergebenen, der eine unbequeme Anweisung von seinem Vorgesetzten entgegennimmt. »Ja, Mr President.«
Es wurde still im Zimmer, die Meinungsverschiedenheit lud die Atmosphäre auf. Die Spannung löste sich, als es an die Tür klopfte. Sie öffnete sich, während Robert noch »Herein!«, rief, und ein Mann mit ruhigen, klaren Gesichtszügen, mausgrauen Haaren, die, wie in der Geschäftswelt üblich, kurz geschnitten waren, trat ein. Er trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine unauffällige blaue Krawatte. Ein Draht am Hals verriet den Ohrhörer.
»Irgendetwas Neues?«, fragte der Präsident.
Special Agent Tord Bahr vom Secret Service nickte. »Ja, Sir. Und ich muss Ihnen sagen, Mr President, dass ich dringend rate, Sie sofort von hier wegzubringen. Unsere neusten Informationen deuten mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Anschlag heute Abend hin. Es ist noch Zeit, Sie in Sicherheit zu bringen.«
»Sind Sie sicher, dass Gefahr besteht?«
»Ja, Sir.«
»Und Sie sind voll und ganz darauf vorbereitet?«
»Absolut. So wie man es nur sein kann.«
»Und meine Familie ist sicher im Weißen Haus untergebracht?«
»Ja, Sir.«
»Dann werde ich nicht Reißaus nehmen. Es macht keinen guten Eindruck, wenn sich der Führer der freien Welt versteckt, sobald es kritisch wird. Haben wir uns verstanden?«
Bahr biss kurz die Zähne aufeinander, bevor er antwortete. »Vollkommen, Mr President.«
»Danke, Tord. Ich habe vollstes Vertrauen zu Ihnen und zu Ihrem Team.«
Roberts schaute durch das kugelsichere Glas, das in alle Fenster des Hauses eingesetzt worden war. »Das wird wohl eine lange Nacht«, sagte er. Doch sein Stabschef war schon mit Bahr hinausgegangen, um seine Aufgabe in Angriff zu nehmen.
7
Carver flog in einer Höhe von 4500 Metern über die Küste North Carolinas. Unter sich sah er einen unbewohnten Streifen Buschland, der anderthalb Kilometer breit war. Innerhalb von fünfundzwanzig Sekunden war er darüber hinweggeflogen und sank dabei um weitere 350 Meter. Jetzt befand er sich über der Black Bay. Das war der längste Abschnitt seines Fluges: sechseinhalb Kilometer über Wasser, während er tiefer sank, bis er spürte, dass die Luft wärmer und dichter wurde, sodass er die Sauerstoffmaske nicht mehr brauchte. Er wusste genau, wo er war, und der Flug verlief glatt und ohne Probleme. Ihm blieben ein paar Minuten, um das zu genießen. Danach würde es wieder gefährlich werden.
Links von ihm lag Knotts Island. Die Insel war acht Kilometer lang und an der breitesten Stelle, am südlichen Ende, sechseinhalb Kilometer breit. Ein schmaler Streifen Land verband sie mit dem Festland von Virginia und trennte einen eingeschlossenen Meeresarm in zwei Teile: in die Back Bay und in den Currituck Sound. Das Anwesen der Roberts' lag auf diesem Stück Land, das Haupthaus direkt am Strand des Currituck.
Carver flog noch ein paar Hundert Meter bis zur nördlichen Hälfte des Anwesens. Mittlerweile wurde er nervös. Der starke Rückenwind, der ihn bis ans Ziel hätte tragen sollen, hatte nachgelassen, sodass Carver langsamer wurde und im Verhältnis zu der zurückgelegten Strecke zu tief sank. Sein Höhenmesser piepte im Ohr und sagte ihm, dass er auf unter tausend Meter gesunken war. In knapp zwanzig Sekunden würde er den Fallschirm öffnen müssen. Es war eine Illusion, klar, doch die größer werdenden Dächer und Bäume schienen zum Greifen nah. Sicher würde jemand ihn sehen. Er spürte den Blick unsichtbarer Augen und wartete angespannt auf das Geräusch von Schüssen. Doch alles blieb still.
Und dann flog er wieder über Wasser. Er hatte es nicht mehr weit.
Er legte sich scharf in die Kurve und schwenkte um neunzig Grad nach links auf einen südlichen Kurs, der ihn über den Currituck Sound und zurück zum Anwesen bringen würde. Er sank auf sechshundert Meter. Der Fallschirm öffnete sich, und Carver bekam seine ungeheure Bremskraft zu spüren. Nach all den Gefahren, die er bis hierher schon überstanden hatte, musste Carver sich nun auf den gefährlichsten Teil des Anflugs einstellen.
Während der nächsten anderthalb Minuten würde er durch feindlichen Luftraum schweben. Seine Kleidung und der Fallschirm bestanden aus einem schwarzen, nicht reflektierenden Stoff, durch den er sehr schwer auszumachen war. Trotzdem wusste er aus eigener Erfahrung, wie verwundbar man sich fühlte, wenn man an den Gurten hängend über bewaffneten Feinden niederging. Das war eine ungesunde Mischung aus Angst, die einem durch Mark und Bein ging, und dem Gefühl vollkommener Schutzlosigkeit wie in den Träumen, wo man von der Taille abwärts nackt durch die Öffentlichkeit spaziert. Als er auf den Sund zusteuerte, war ihm auch nicht wohler als bei den früheren Malen. Klar, er hatte eine Hose an, doch trotzdem schaukelten seine Eier im Wind.
Ein Stück weiter vorn, einen Kilometer vom Festland entfernt, lag eine winzige Insel, die nur ein paar Meter breit aus dem Wasser schaute. Carver hatte jedoch nicht vor, dort zu landen. Selbst wenn er sie treffen und bremsen könnte, bevor ihn der Schwung auf der anderen Seite ins Wasser trug, wäre er viel zu leicht zu entdecken. Sein Plan war, noch vor der Insel zu landen, wo er vor den Blicken der Secret-Service-Leute, die das Roberts-Anwesen bewachten, geschützt war. Und das hieß, auf dem Wasser.
Selbst für einen geübten Fallschirmspringer ist das eine knifflige Sache. Das Entscheidende ist, dass man genau wissen muss, wann man den Fallschirm löst. Tut man es zu früh und ist noch zu hoch über dem Wasser, trifft man zu schnell auf und schießt unaufhaltsam in die Tiefe. Viele Männer von Spezialeinheiten sind auf diese Weise verschwunden, durch die Geschwindigkeit des Aufschlags und durch das Gewicht ihrer Ausrüstung in den Tod gerissen.
Wer zu lange wartet, läuft Gefahr, sich in den Leinen und im Stoff des Schirms zu verheddern, sodass er nicht mehr in der Lage ist zu schwimmen, und ertrinkt wie ein Delphin im Thunfischnetz. Der Trick besteht also darin, den Schirm nicht zu früh und nicht zu spät zu lösen. »Wenn du das Wasser an den Schuhspitzen spürst«, hatte Carvers Ausbilder gesagt.
Und wenn er gewusst hätte, was sein Schüler eines Tages tun würde, hätte er hinzugefügt: »Und zieh um Gottes willen keinen Wingsuit an.«
Es ist schon ziemlich schwer zu schwimmen, wenn man die Arme nur bis zu fünfundvierzig Grad vom Körper wegstrecken kann, weil man in einem Fledermausanzug steckt. Wenn dann auch noch die Beine durch ein Dreieck aus unelastischem Stoff in der Bewegung eingeschränkt sind, ist es völlig unmöglich. Also musste Carver sich mit seinen Flügeln beschäftigen, lange bevor er seinen Fallschirm loswurde.
Dreihundert Meter über dem Wasser zog er an den Cutaway-Griffen, die die Flügel an den Armen lösten. Er spürte, wie die Klettverschlüsse abrissen, schwenkte die Arme zur Seite und seufzte erleichtert, als die zwei schwarzen Dreiecke flatternd in der Dunkelheit verschwanden.
Der Beinflügel hatte keine Vorrichtung zum Abreißen. Er musste mittels Reißverschlüssen gelöst werden. Carver zog die Knie an die Brust, tastete nach dem Verschluss und zog daran. Nichts passierte. Er zog noch einmal. Keine Reaktion. Der Verschluss klemmte.
Carver hatte höchstens noch zwanzig Sekunden bis zum Aufprall. Er zwang sich, nicht in Panik zu verfallen, sondern klar zu denken und ruhig zu handeln. Noch war nichts verloren. An seinem Anzug war ein leichtes Kampfmesser befestigt, mit einem Griff aus Titan und einer Klinge aus Wolframstahl, die mit DLC beschichtet war. Sie drang selbst durch den festesten Stoff so leicht wie durch menschliche Haut. Carver würde das Messer für beides brauchen.
Er zog es heraus und begann mit aller Kraft an dem Flügelstoff zu schneiden. Der hatte unten am Saum eine zusätzliche Versteifung, die die Stabilität und Reißfestigkeit während des Fluges erhöhen sollte.
Das Wasser rauschte ihm entgegen. Das Messer sägte durch die Versteifung. Gerade noch rechtzeitig trennte Carver die letzten Fäden durch. Seine Beine kamen frei, nur zwei breite Stoffstreifen flatterten noch an den Nähten, als hätte er eine Schlaghose aus den Siebzigern an. Dann traf ihn eine Erkenntnis. Er würde den Fallschirm nicht lösen können, solange er das Messer in der Hand hatte, und er durfte auch nicht mit der ungeschützten Klinge auf dem Wasser aufschlagen.
»Scheiße!«, murmelte er und warf das Messer so weit wie möglich weg. Damit hatte er eine seiner wertvollsten Waffen verloren. Doch er hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Er zog die Reißleine.
Gleich darauf schlug er auf dem Wasser auf und sank in die Tiefe.
Ein, zwei Sekunden lang schien sein Schwung nicht abzunehmen, doch dann wurde Carver langsamer, er trat mit den Beinen, machte einen Zug mit den Armen im Wasser nach oben und fühlte, wie er langsam, qualvoll langsam an die Oberfläche stieg.
Endlich kam er an die Luft und erlebte die wunderbare Wiedergeburt durch den ersten verzweifelten Atemzug. Er war gelandet. Und er lebte. Nachdem er zu der Insel geschwommen war, kroch er auf einen der Felsen zu, die sie umgaben, peinlich darauf bedacht, von den Männern am fernen Ufer, die Lincoln Roberts bewachten, nicht gesehen zu werden.
Um den Bauch hatte er eine Ausrüstungstasche geschnallt, in der eine gekürzte Heckler & Koch MP7 steckte, eine verbesserte Version der MP5, die er zuletzt benutzt hatte. Sie war gebaut worden, um kugelsichere Kleidung zu durchdringen. Vorsichtshalber schützte er sie nach alter Sitte des Special Boat Service vor Wasser: mit einem Kondom über dem Lauf. In der Tasche befanden sich auch verschiedene kleine Sprengsätze, ein Schnorchel, eine Tauchermaske und ein Paar Flossen. Er setzte die Sauerstoffmaske ab und warf sie ins Wasser, ebenso das Gurtzeug des Fallschirms. Dann legte er die Unterwasserausrüstung an, glitt in den Currituck Sound und schwamm um die Insel herum aufs Festland zu.
8
Zeit seines beruflichen Lebens hatte Carver sich antrainiert, nicht über richtig und falsch nachzudenken bei dem, was er tat. Nicht dass ihm der moralische Kompass fehlte. Es war nur so, dass es keinen Zweck hatte, Zeit mit Dingen zu vergeuden, an denen er nichts ändern konnte. Das hatte er bei den Royal Marines gelernt. Politiker erklärten den Krieg. Die Generäle hatten ihn zu führen. Sie gaben Befehle, und Männer wie Carver gehorchten. Entlang der gesamten Befehlskette hatten die Leute Gründe für das, was sie taten, und jeder Einzelne fand, dass er das Richtige tat. Für die, die am Ende dieser Kette standen und die Waffe in der Hand hielten, ging es nicht um richtig oder falsch, es ging einzig und allein darum, den anderen zu töten, damit man selbst davonkam.
Dasselbe Prinzip galt auch außerhalb der Streitkräfte. Carver hatte noch nie einen Auftrag gehabt, bei dem nicht irgendjemand irgendwo überzeugt war, damit das Richtige zu tun, nicht einmal bei den Jobs, die jenseits aller Rechtfertigung lagen. Er hatte einen Mann töten müssen, der den Zorn Gottes über die Welt bringen und das Ende aller Tage herbeiführen wollte, weil er fest überzeugt war, dies sei der Weg zur Erlösung. Zugegeben, der war verrückt gewesen, aber trotzdem nicht weniger überzeugt von dem, was er tat, als jemand, der sich für geistig gesund hielt.
Darum dachte Carver, während er dicht unter der Wasseroberfläche des Currituck schwamm, an gar nichts außer an die unmittelbaren praktischen Erfordernisse seiner Situation. Er hatte noch mehrere Hundert Meter vor sich. Hier gab es praktisch keine Gezeiten und keine Strömungen. Aber der Wind, der jetzt wieder auffrischte, war gegen ihn und machte das Wasser kabbelig. Carver kam dadurch langsamer voran, aber wenigstens war er bei den unruhigen Wellen unter Wasser noch weniger zu erkennen. Nachdem er die Gefahr der Unterkühlung erfolgreich überstanden hatte, war sein größtes Problem jetzt die eigene Körperwärme. Sein Fluganzug hielt ihn trocken, aber durch die verschiedenen Lagen Unterzeug, die ihn in großer Höhe am Leben erhalten hatten, drohte nun die Überhitzung. Die ersten Symptome wären ein Anschwellen der Hände und Füße, danach kämen Krämpfe und ein Hitzschlag, worauf man die Orientierung verlor, halluzinierte und schließlich bewusstlos wurde.
Für Einsatzkräfte des SBS, die zum Beispiel unter Wasser aus einem U-Boot aussteigen, um anschließend die Strapazen langen Schwimmens und den schweißtreibenden Aufstieg an einem Schiffsrumpf oder an einer Ölplattform hinter sich zu bringen, sind extreme Kälte und Hitze ein vertrauter Gegensatz. Carver schwamm darum langsam und legte regelmäßig Pausen ein, bei denen er sich zu orientieren versuchte und nach feindlichen Booten Ausschau hielt. Er nahm an, dass die Küstenwache im Sund patrouillierte, da al-Qaida per Schnellboot schon Überfälle auf amerikanische Streitkräfte verübt hatte und das vielleicht wiederholte.
Zweimal hörte er das Dröhnen einer Schiffsschraube im Wasser. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als innezuhalten und sich möglichst ruhig zu verhalten, Wasser zu treten, um nicht unterzugehen, und mit dem Schnorchel knapp über der Oberfläche zu bleiben. Beim ersten Mal fuhr der Kutter gute hundert Meter an ihm vorbei. Beim zweiten Mal wurde das Dröhnen lauter, bis Carver wusste, der Kutter fuhr direkt auf ihn zu.
Er riss die Augen auf, um irgendeinen Lichtschein wahrzunehmen, und spähte durch das schwarze, trübe Wasser. Plötzlich sah er massenhaft Luftblasen, die von dem näher kommenden grauen Schiffsbug wegströmten. Carver holte tief Luft und tauchte, wobei er hektisch mit den Schwimmflossen trat, um dem stählernden Koloss zu entkommen.
Doch es nützte nichts. Er kam nicht vom Fleck. Der Bug würde ihn treffen. Und dann, gerade als er sich auf den Stoß gefasst machte, riss ihn eine unsichtbare Kraft nach oben und schleuderte ihn zur Seite, verdrängte ihn zusammen mit dem Wasser, er wurde von der Heckwelle erfasst und schließlich vom Schiffsrumpf weggetrieben, doch kurz darauf erneut angezogen wie Eisenspäne von einem Magneten.
Carver wurde auf die Seite des Rumpfes zugewirbelt. Er sah die aufgemalten diagonalen roten, weißen und blauen Streifen und dahinter in weißen Lettern die Beschriftung »US COAST GUARD«. Unter dem Schluss-D stieß er mit Schulter, Arm und Hüfte so heftig gegen den Rumpf, dass es ihm die Luft aus der Lunge trieb, dann drängte ihn die Strömung wieder nach oben und ließ ihn schaukelnd an der Wasseroberfläche zurück, während das Heck des Kutters in der Nacht verschwand.
Carver tastete sich ab, ob er sich etwas gebrochen hatte. Der Schreck saß ihm in den Gliedern, und er hatte das Gefühl, als wäre er grün und blau geschlagen worden, aber der Arm ließ sich bewegen, und der Brustkorb tat nur weh, wenn er atmete, doch ohne den scharfen, stechenden Schmerz, den gebrochene Rippen verursachten. Er konnte weitermachen.
Fünfzehn Minuten später trat er im Wasser unterhalb der L-förmigen Mauern des Kais. Die ganze Anlage war etwa achtzehn Meter breit und doppelt so lang. Gleich neben Carver, dem Meer zugewandt, war eine Lücke in der Mauer, um Boote durchzulassen. Ein Mann im schwarzen Kampfanzug mit kugelsicherer Weste und in Stiefeln patrouillierte an der Mauer auf der anderen Seite der Lücke und blieb ab und zu stehen, um mit dem Nachtsichtgerät über das Wasser zu spähen.
Durch die Öffnung im Kai war eine Jacht zu sehen, die an einem Ponton festgemacht war. Sie lag mit dem Bug in Carvers Richtung. Das musste die Lady Rosalie sein, eine zwölf Meter lange Schaluppe, die der Präsident fast so sehr liebte wie die Frau, nach der sie benannt war. Carver holte tief Luft, tauchte unter und schwamm darauf zu.
Hinter dem Bug, in der Lücke zwischen dem Rumpf und den Holzplanken des Anlegepontons, kam er an die Oberfläche. Vom Ponton aus führte eine Steintreppe an der Kaimauer hinauf.
Carver bewegte sich vorsichtig am Rumpf entlang. Hinter dem Heck ließ er sich noch einmal unter Wasser gleiten. Gut sechzig Sekunden vergingen, bis er wieder auftauchte. Er schaute am Rumpf vorbei zu dem Posten. Der war ein Stück den Kai hinuntergegangen, kehrte ihm den Rücken zu und blickte aufs Meer. Noch im Wasser zog Carver Tauchermaske, Schnorchel und Flossen aus, zog sich an der Mauer hoch auf den Kai und flitzte zu den Stufen.
Als er dort im Dunkeln hockte, griff er in die umgeschnallte Tasche und nahm die Heckler & Koch heraus. Sie war kompakt und stumpfnasig, kaum mehr als dreißig Zentimeter lang, aber groß genug für die Aufgabe, die sie erledigen sollte.
Carver schloss die Augen, konzentrierte sich darauf, langsam und leicht zu atmen. Im Geiste ging er die Anlage des Grundstücks und den Grundriss des Haupthauses durch, das keine dreißig Meter entfernt stand. Die Rasenfläche davor erstreckte sich bis an den Kai. Ungefähr sechs Meter vom Haus entfernt verlief eine niedrige Mauer an einem Blumenbeet entlang, dahinter war eine Terrasse mit Tischen und Stühlen, die von der Rückseite des Hauses abging.
Carver ging davon aus, dass Sicherheitsleute auf dem Dach und im Haus waren und dass auf der ganzen Rasenfläche Bewegungsmelder, Drucksensoren und Wärmebildkameras angebracht waren. Es gab keine Möglichkeit, dass er unentdeckt über den Rasen kam. Es musste nur schnell gehen.
Wie er die Sache sah, standen die Chancen gar nicht so schlecht. Es dauerte höchstens vier Sekunden, um hinüberzurennen, über das Mäuerchen zu springen und zum Haus zu gelangen. Der Wächter am Kai würde ihn wahrscheinlich nicht gleich sehen, und selbst wenn, müsste er ziemlich gut sein, um von dort aus einen rennenden Mann zu treffen. Die Leute auf dem Dach wären im Nachteil durch den ungünstigen Winkel. Sie müssten nach unten schießen, und je näher er selbst dem Haus kam, desto schwieriger würde es, zu treffen. Außerdem müssten auch sie überaus schnell reagieren.
Von Carvers Position aus gab es zwei mögliche Wege ins Haus: durch die Terrassentür ins Wohnzimmer oder durch eine Hintertür in die Küche. Wenn er eine von beiden erreichte, sie aufsprengte und anfinge zu schießen, könnte er jeden niederstrecken, der ihm drinnen über den Weg lief, einschließlich Lincoln Roberts.
Also kauerte er unten an der Treppe so angespannt wie ein Sprinter beim Start, machte drei tiefe Atemzüge, sprang dann auf, über das Steinpflaster auf den Rasen und rannte wie der Teufel.
Carver brauchte keinen Einstein, der ihm sagte, dass Zeit relativ war. Vier Sekunden fühlen sich an wie eine Ewigkeit, wenn es nur den Bruchteil von einer Sekunde dauert, den Alarm auszulösen, bei dem Glocken schrillen und blendende Scheinwerfer angehen ... und plötzlich ist es, als würde man durch Sirup laufen. Von allen Seiten kommen Warnrufe, Waffenläufe werden gehoben, man rennt im Zickzack, um die Schützen zu irritieren, während jeder Schritt zur Seite den Weg länger macht. Dann hört man das Knallkörpergeknatter kleiner Schusswaffen durch den schrillenden Alarm und wartet darauf, dass einem die erste Kugel das Fleisch aufreißt. Aber es kommt keine, und dann wirft man sich die letzten sechs Meter nach vorn ...
Carver kam auf dem Boden auf, machte eine Rolle vorwärts und schaffte es lebend bis zur Hauswand. Die Französischen Fenster waren direkt vor ihm. In der Hand hielt er eine Handgranate, um sie aufzusprengen, und plötzlich verstummten die Schüsse und der Alarm, und seine klingelnden Ohren hörten jemanden schreien: »Waffen fallen lassen, sofort!«
Carver gehorchte. Langsam und ohne jemandem einen Grund zum Schießen zu geben, legte er die Pistole und die Handgranate auf die Steinplatten.
»Jetzt die Hände hinter den Kopf.«
Wieder folgte Carver der Anweisung.
»Umdrehen, schön langsam.«
Carver drehte sich um und blickte in das Gesicht von Special Agent Tord Bahr. Um dessen Mund spielte ein höhnisches Lächeln, und in den Augen blitzte echtes Vergnügen, als er die Pistole hob, direkt auf Carvers ungeschützte Brust richtete und abdrückte.
9
Carver verbrachte die grauen Morgenstunden auf einer Liege im Angestelltentrakt des Hauses, unverletzt von den Schüssen, die auf ihn abgefeuert worden waren. Es waren Platzpatronen gewesen. Um halb sieben, nach drei Stunden Schlaf, saß er im Essensraum, in einer Hand einen Becher mit starkem Kaffee, in der anderen ein Steaksandwich, bei dem das Brot von Blut und Fett getränkt war.
Der Secret Service hatte Carver mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer grauen Trainingshose versorgt. Er hatte auch eine Zahnbürste bekommen, aber keinen Rasierer und keine Haarbürste. Er sah ziemlich genauso aus wie irgendein x-beliebiger Mann am Samstagmorgen nach einer harten Freitagnacht. So gefiel es ihm: möglichst normal und unauffällig aussehen.