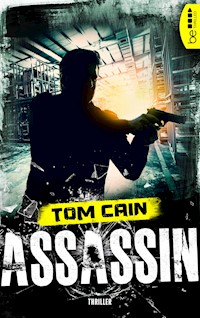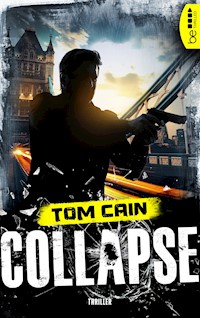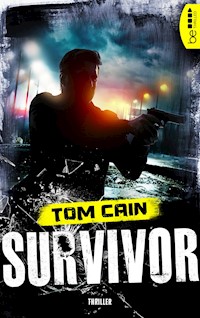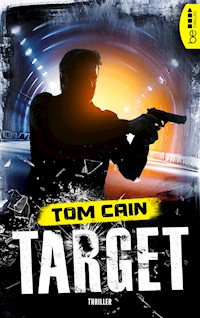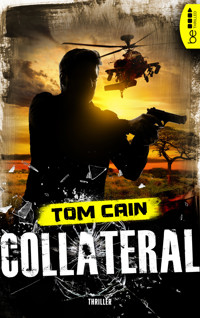
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Samuel-Carver-Reihe
- Sprache: Deutsch
Samuel Carver hat einen besonderen Job: "Er heilt die Welt von üblen Krankheiten. Diktatoren, Massenmörder, Mafiabosse - keiner ist vor ihm sicher." Seine Methode: diskrete Liquidation. Als er den Auftrag erhält, ein entführtes Mädchen im afrikanischen Malemba wiederzufinden, stört er mit seinen Nachforschungen unversehens die Kreise eines übermächtigen Gegners. Denn das Mädchen befindet sich in der Gewalt des skrupellosen Diktators Gushungo.
Dieser verfolgt einen perfiden Plan und wird sich von niemandem davon abbringen lassen. Gushungo beschließt daher, seiner Sammlung eine neue Trophäe hinzuzufügen: Samuel Carvers Kopf ...
Ein neuer Auftrag für Samuel Carver: Collapse.
beTHRILLED — mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Tom Cain bei beTHRILLED
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
1. TEIL - VOR ZEHN JAHREN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2. TEIL - GEGENWART
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
SECHS MONATE SPÄTER
100
DANKSAGUNG
Tom Cain bei beTHRILLED
Die Samuel-Carver-Reihe:
Band 1: Target
Band 2: Survivor
Band 3: Assassin
Band 4: Collateral
Band 5: Collapse
Über dieses Buch
Samuel Carver hat einen besonderen Job: Er heilt die Welt von üblen Krankheiten. Diktatoren, Massenmörder, Mafiabosse – keiner ist vor ihm sicher. Seine Methode: diskrete Liquidation. Als er den Auftrag erhält, ein entführtes Mädchen im afrikanischen Malemba wiederzufinden, stört er mit seinen Nachforschungen unversehens die Kreise eines übermächtigen Gegners. Denn das Mädchen befindet sich in der Gewalt des skrupellosen Diktators Gushungo.
Dieser verfolgt einen perfiden Plan und wird sich von niemandem davon abbringen lassen. Gushungo beschließt daher, seiner Sammlung eine neue Trophäe hinzuzufügen: Samuel Carvers Kopf …
beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung!
Über den Autor
Tom Cain ist Journalist und wurde für seine Arbeit mit vielen Preisen ausgezeichnet. Er hat jahrzehntelang für bekannte Zeitungen und Zeitschriften in den USA und Großbritannien geschrieben und als investigativer Journalist über Finanzskandale an der Wall Street berichtet. In seinen Action-Thrillern um den fiktiven ehemaligen Geheimagenten Samuel Carver kombiniert er packende Spannung mit realen Ereignissen wie den Tod von Prinzessin Diana oder die Finanzkrise um die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers.
TOM CAIN
COLLATERAL
THRILLER
Aus dem Englischen vonAngela Koonen
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2010 by Tom Cain
Titel der englischen Originalausgabe: »Dictator«
Originalverlag: Bantam Press
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2011/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gerhard Arth
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © OSTILL/iStock/Getty Images Plus; aga7ta/iStock/Getty Images Plus; alptraum/iStock/Getty Images Plus; Vladimir18/iStock/Getty Images Plus; Zenobillis/iStock/Getty Images Plus; HPS-Digitalstudio/iStock/Getty Images Plus; LRPhotographies/iStock/Getty Images Plus; Andy_Oxley/iStock/Getty Images Plus
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1751-9
be-thrilled.de
lesejury.de
1. TEIL
VOR ZEHN JAHREN
1
Carver saß rittlings auf den breiten Hüften der Frau und betrachtete mit seinen kühlen grünen Augen ihren nackten Oberkörper. Ihr Bauch war bestimmt nicht dick, aber fraulich gewölbt, die Brüste rund und schwer. Ihre Gesichtszüge waren alles andere als fein: die Nase ein bisschen zu groß, die Kinnpartie zu kräftig. Dafür hatte sie blutrote Lippen, weiße Zähne, und ihre Augen sprühten vor Leben.
Er beugte sich nach vorn, streckte den rechten Arm aus und strich versuchsweise ganz sacht, mit minimalem Hautkontakt, über ihre linke Brustwarze. Die Frau erschauderte leise stöhnend, während sich die Brustwarze unter seinem Handteller aufrichtete. Sie warf die Arme über sich auf das Kopfkissen, die Handgelenke über Kreuz, als wäre sie mit unsichtbaren Fesseln an das Bett gebunden. Bei Carvers erster Berührung hatte sie die Fäuste geschlossen. Er lächelte und verabreichte der anderen Brust dieselbe Behandlung.
Dann legte er die Hände an ihre Brüste, ein bisschen fester nun. Mit angespanntem Rücken und Bauch, damit die Hände sein Gewicht nicht stützen mussten, beugte er sich herab und spielte mit Lippen und Zunge, wo gerade seine Hände gewesen waren. Er fühlte den Impuls ihrer Hüften und nahm sie fester zwischen die Oberschenkel, um die Bewegung zu unterbinden und ihr Verlangen zu steigern. Sie stöhnte, als er eine Brustwarze zwischen die Zähne nahm und damit spielte, gerade so dosiert zubiss, dass es nur sehr wenig wehtat.
Nun strich er mit beiden Händen an ihren Seiten entlang, bis zur Einbuchtung der Taille. Er überzog die Unterseite ihrer Brüste mit schwerelosen Küssen, die er über die flaumige Pfirsichhaut um den Bauchnabel herum fortsetzte. Kurz untersuchte er ihn mit der Zunge, kitzelte sie, dann stützte er die Arme auf die Matratze und schob die Beine zwischen ihre. Langsam und unausweichlich zwang er sie auseinander. Sie sträubte sich spielerisch. Sie war stark, doch er war stärker. Diesen Kampf würde er immer gewinnen, das wussten sie beide.
Ein paarmal strich er mit den Lippen über den schmalen Streifen Schamhaare, worauf sie ihm das Becken entgegenreckte, um seinem Mund näher zu kommen. Ein neuerliches Stöhnen, ein bisschen lauter diesmal in Erwartung seiner Zunge. Sie schob die Hände hinab zu seinem Kopf, griff in seine Haare und versuchte ihn hinzulenken, doch Carver hatte keine Eile. Anstatt wie erwartet weiterzumachen, quälte er sie ein bisschen, indem er die Innenseiten ihrer Oberschenkel küsste bis hinauf zur Leiste, sodass er ihren Geruch einatmete, ihre Hitze wahrnahm.
Er bewegte die Hüften und spürte, dass er hart war. Er frustrierte sich selbst ebenso wie sie, doch das war Teil des Vergnügens. Mal sehen, wer es länger aushielt. Ihre Fingernägel bohrten sich in seine Kopfhaut, kratzten und drängten ihn. Der Moment kam näher. Er setzte die Lippen an, schmeckte sie zum ersten Mal, und dann …
Dann kam ihm ungebeten und unerwartet ein Gedanke in den Sinn: Er hatte keine Ahnung, wie diese Frau eigentlich hieß.
Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schwall eisiges Wasser und machte den Augenblick zunichte. Hatte er wirklich diese Situation herbeigeführt? Betrunken in einem überfüllten Club eine aufreißen, um die zynischen Etappen eines anonymen Ficks zu durchlaufen – war das seine Vorstellung von einer schönen Tour durch die Nacht? Bislang hatte er mehr von sich gehalten.
Vor lauter Widerwillen und Selbstverachtung schrumpfte er zusammen und zog sich von der Frau zurück.
Zuerst dachte sie wohl, das sei eine seiner Neckereien, denn sie blieb abwartend liegen. Dann stützte sie sich auf den Ellbogen.
»Was ist los, Süßer?«
Sie hatte einen italienischen Akzent. An ihren Namen konnte er sich trotzdem nicht erinnern.
Sie lachte verführerisch. »Komm wieder her. Was du mit mir machst, fühlt sich toll an. Sei nicht gemein, Junge, hör jetzt nicht auf.«
Carver beachtete sie nicht. Er saß auf der Bettkante und rieb sich die Augen. Seit ihm die Lust vergangen war, war er bloß noch ein übermüdeter Mann morgens um halb fünf auf der Kippe zwischen Trunkenheit und Kater.
Er stand auf, schwankte kurz und tappte dann zur Küche.
»He! Wo willst du hin? Lässt du mich einfach so liegen?«, rief sie ihm hinterher und murmelte etwas auf Italienisch. Wie ein Kompliment klang es nicht.
Im Flur hielt er inne, drehte den Kopf zur Schlafzimmertür. »Möchtest du eine Tasse Kaffee?«
Sie zeigte ihm den Stinkefinger.
Carver ging achselzuckend weiter. Als er Wasser in die Kaffeemaschine goss, stampfte sie fluchend in dem Zimmer umher. Er sollte hören, wie es ihr ging, während sie ihre verstreuten Kleider zusammensuchte.
Er schaute über die Dächer der Altstadt, die im ersten wässrigen Licht des Morgens von Schwarz zu Schlachtschiffgrau übergingen. Plötzlich verspürte er einen Bärenhunger. Er hatte am Abend nichts gegessen, und er würde auch jetzt nichts essen. Im Kühlschrank gab es nur eine halb leere Flasche Sancerre und ein altes Stück Gruyère, das wahrscheinlich die Konsistenz von Hartplastik hatte und dick mit grün-weißem Schimmel überzogen war.
Die Kaffeemaschine blubberte und verriet, dass das Wasser gekocht hatte. Carver schob eine Tasse unter die Tülle. In der Tasse war der braune eingetrocknete Rest mehrerer Espressos von gestern. Aber egal: Der kochend heiße Kaffee würde etwaige Bazillen umbringen. Auswaschen konnte er sich sparen.
Bis er sich den Kaffee eingeschenkt hatte und die Küche verließ, war sie auf dem Weg zur Wohnungstür.
»Was für ein Problem hast du?«, höhnte sie, als sie bemerkte, dass er sie betrachtete. »Klappt’s nicht? Kriegst du keinen hoch? Pah!«
Er trank seinen Kaffee und machte ihr die Tür auf. »Bitte sehr.«
»Oh, vielen Dank, du feiner Engländer.« Der Sarkasmus war dick aufgetragen.
»Bevor du gehst«, er versperrte ihr den Weg mit dem Arm, »wie heiße ich?«
Sie warf ihm einen vernichtenden Blick zu. »Keine Ahnung. Ist mir egal. Will dich sowieso nicht wiedersehen.«
»Dann sind wir uns ja einig.«
Er ließ den Arm sinken, und sie ging, ohne ihn noch eines Blickes zu würdigen. Er schloss die Tür und schlenderte zurück zur Kaffeemaschine, während er überlegte, seit wann er die Dinge so schleifen ließ. Nicht nur bei dieser Italienerin, sondern insgesamt.
Blöde Frage. Er wusste es ganz genau. Auf die Sekunde genau konnte er die Entwicklung zurückverfolgen. Es war der Moment gewesen, in dem eine andere Frau durch diese Tür hinausgegangen war und die Endgültigkeit ihm das Herz gebrochen hatte.
Auch jetzt noch, Monate später, gab es Augenblicke, wo er sich einbildete, Alix Petrowa irgendwo zu sehen. Es brauchte nur ein goldblonder Kopf in der Menge aufzutauchen, ein Hauch von ihrem Parfüm an ihm vorbeizuziehen, eine ähnliche Stimme in der Nähe zu hören sein.
Egal wie oft das vorkam, er war hilflos gegen die aufwallende Hoffnung und gegen den vernichtenden Schmerz, wenn die Hoffnung zerstob.
Er zog sich etwas an und verließ das Haus auf der Suche nach einer Bäckerei, die ihm ein paar Stücke Pizza oder einen Croque Monsieur verkaufte. Vielleicht auch beides. Die Kalorien würde er brauchen, denn sobald er gefrühstückt und geduscht hatte, wollte er in die Berge hinauffahren. Er wollte durch den Wald und über Wiesen joggen, laufen, bis er den Restalkohol im Körper und das Gift in seiner Seele verbrannt hatte. Und morgen würde er es genauso machen.
Es war höchste Zeit, wieder Biss zu bekommen, Zeit, ein konzentriertes Leben zu führen. Doch auch die beste körperliche Verfassung brachte einen nur bis an einen gewissen Punkt.
Was Samuel Carver wirklich brauchte, war ein Job, ein Auftrag, bei dem er seine speziellen, todbringenden Fähigkeiten ausüben konnte. Aber einige tausend Kilometer weit entfernt, in dem afrikanischen Staat Malemba, sollte diesem Bedürfnis entsprochen werden.
2
Im Stratten-Reservat im Süden Malembas, an der Grenze zu Südafrika, stand eine schwarze Nashornkuh friedlich in einem Akaziengehölz bei dem Teich am Flussufer, wo sie zu trinken pflegte. Die Wildhüter, die wie vernarrte Pateneltern ihre Entwicklung seit fünfzehn Jahren verfolgt hatten, nannten sie Sinikwe. Allen wichtigen Tieren – den Nashörnern, Elefanten und Großkatzen – gaben sie Namen.
Sinikwe schaute auf, als sie ihr Kalb Fairchild schreien hörte. Es machte gerade die leidvolle Erfahrung, dass die Akazienblätter zwar zart und köstlich waren, aber von bösartigen Dornen geschützt wurden. Das Kalb erlitt keine ernsthaften Verletzungen, und so war der Hunger bald größer als der Schmerz. Es wandte sich wieder der Akazie zu, ein bisschen vorsichtiger nun. Es hatte dazugelernt. In der Nähe fraßen zwei weitere Kälber, Sinikwes zweijährige Tochter Lisa-Marie und deren Cousine Kanja. Kanjas Mutter Petal war an den Teich gegangen, um ihren Durst zu stillen.
An dem Akaziengehölz führte eine unbefestigte Straße vorbei, wo Touristen in halb offenen Geländewagen entlangfuhren, um die Tiere, die sich an dem Teich zum Trinken einfanden, zu fotografieren. Die Nashörner waren inzwischen an Menschen gewöhnt und flüchteten nicht mehr beim ersten Geräusch eines Motors, es sei denn, sie standen auf der Straße, wenn sich ein Fahrzeug näherte. In dem Fall erfreuten sich die Safariteilnehmer an dem massigen Hinterteil eines ausgewachsenen Nashorns, das mit 45 km/h und dem watschelnden, schlingernden Lauf eines fetten Menschen das Weite suchte – ein rennendes Nashorn: von hinten ungeheuer komisch, von vorne ungeheuer Furcht einflößend.
Die acht Männer, die in dem alten verbeulten Toyota Hilux hockten – zwei in der Fahrerkabine, sechs auf der Ladefläche – waren keine Touristen. Bekleidet waren sie mit einer individuellen Mischung aus Jeans, Militärjacken, Fußballtrikots und Trägerhemden, und ihr Alter rangierte von achtzehn bis vierzig. Worin sie sich nicht unterschieden, war das AK-47, das jeder bei sich trug.
Sinikwe hob den Kopf, als sich der Geländewagen dem Gehölz näherte. Ihre Ohren zuckten nervös. Doch das Fahrzeug fuhr vorbei, und der Motorlärm verklang, sodass sie sich den Akazienzweigen wieder zuwenden konnte.
Auf der windabgewandten Seite des Gehölzes hielt der Wagen an. Daher witterte sie die Männer nicht, als sie ausstiegen und den Weg zurückgingen. Aufgrund des schwachen Augenlichts, mit dem Nashörner ausgestattet sind, konnte sie sie auch nicht sehen. Die Männer schlichen sich an und hoben ihre Waffen.
Nashörner haben keine natürlichen Feinde. Die größte Gefahr droht ihnen von ihren Artgenossen. Zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Nashörner sterben an Verletzungen, die sie sich im Kampf mit Rivalen zuziehen. Ihre dicke Haut und das scharfe Horn schützen sie vor Angriffen anderer Tiere. Doch dem Feuerstoß aus einer automatischen Schusswaffe sind sie hilflos ausgeliefert. So auch Sinikwe in dem Akaziengehölz, als die Kugeln durch die grünen Zweige peitschten und ihr Fleisch aufrissen und Knochen zersplitterten.
Sie war das erste Opfer. Sie verendete mit einem schrillen Schrei, den auch das brutale Geknatter der Sturmgewehre nicht übertönen konnte. Mit roten Rosetten übersät lag ihr durchsiebter Körper auf der blutbespritzten Erde.
Die übrigen Nashörner flüchteten und kamen mit geringen Verletzungen davon, bis auf eines: Fairchild blieb bei dem Busch stehen, an dem es gefressen hatte, überwältigt von dem Lärm und dem Geruch der Waffen, verwirrt durch die plötzliche Reglosigkeit der Mutter. Dann näherte es sich langsam und versuchte unter jämmerlichem Gequieke, seine Mutter zum Aufstehen zu bewegen.
Einer der Männer schnauzte einen knappen Befehl. Zwei andere stießen ein frisches Magazin in ihr AK-47. Es folgte ein kurzer Feuerstoß, und Fairchild lag ebenfalls tot da.
Die Männer machten sich mit Buschmessern ans Werk. Einige hackten das ausgewachsene Horn Sinikwes und das viel kleinere von Fairchild ab, die anderen schlugen mit Äxten auf die Füße der Nashörner ein, bis ihre Arbeit von einem weiteren Befehl unterbrochen wurde.
Die Männer traten von den verstümmelten Kadavern weg und nahmen nur das lange vordere Horn der Nashornmutter mit, ihre kostbarste Beute. Alles andere überließen sie den Aasfressern, die das Blutbad in Kürze anlocken würde. Sie kehrten zum Hilux zurück, und in dem Gehölz wurde es still.
3
Zalika Stratten hoffte weiter auf Rettung vonseiten ihres Vaters. Später würde er ihr wie immer mit seinen kräftigen braunen Fingern, die rau wie Baumrinde waren, durch die Haare wuscheln und sagen: »Nimm dir nicht so sehr zu Herzen, was Mummy sagt. Sie meint es gut. Sie macht sich nur Sorgen um dich, mehr nicht.« Aber Zalika wollte kein »Später«. Er sollte jetzt eingreifen und sagen: »Hör auf, Jacqui, es reicht.«
Dick Stratten herrschte über ein großes Reich – er besaß nicht nur das Reservat, sondern auch Farmen und Viehzuchtbetriebe im ganzen Land, und viele Menschen waren, was ihre Arbeit, ihre Familien, sogar was das unmittelbare Sattwerden betraf, von ihm abhängig. Wieso konnte er seine eigene Frau nicht im Zaum halten? Wieso musste er dasitzen, an seinem Lammkotelett kauen und absichtlich aus dem Fenster schauen, um den Streit, der neben ihm vonstattenging, zu ignorieren?
Und warum wollte ihre Mutter sie nicht einfach in Ruhe lassen?
»Im Ernst, Liebling«, sagte Jacqui Stratten, »es tut dir doch nicht weh, wenn du ab und zu mal ein hübsches Kleid anziehst. Wenn du ein Mal diese garstigen Turnschuhe nicht anziehst und stattdessen Absätze trägst oder eine Winzigkeit Make-up auflegst, das würde schon so viel ausmachen. Du hast so schöne blaue Augen. Sie sind das Hübscheste an deinem Gesicht, doch niemand wird sie bemerken, wenn du sie nicht ein bisschen betonst. Und was deine Haare angeht: René fragt mich immer wieder, wann ich dich in den Salon mitbringe. Er würde dir gern ein paar Strähnchen machen. Er sagt, das würde dich geradezu verwandeln.«
»Ich will keine Strähnchen«, fauchte Zalika. »Stundenlang dasitzen, mit Alufolie in den Haaren, und sich zu Tode langweilen, während dieser schreckliche Kerl mit seinem unechten französischen Akzent um einen herumzappelt – das ist doch die Hölle.«
»Wenn du so weitermachst, wirst du nie einen Freund abkriegen, das steht fest«, erwiderte ihre Mutter.
»Ich will auch gar keinen.«
»Ach, sei nicht albern. Du bist ein siebzehn Jahre altes Mädchen; natürlich willst du einen Freund. Als dein Bruder so alt war, war er von Mädchen umringt. Allerdings ist es Andrew nie schwergefallen, sich von seiner besten Seite zu zeigen.«
Zalika verdrehte die Augen. »Fängst du schon wieder von meinem ach so perfekten Bruder an …«
»Nun, du hast ja gesehen, wie viele Briefe er bekommen hat, seit er von New York zurückgekehrt ist, alle von Mädchen. Meine Freunde reden nur noch davon, welchen Eindruck er gemacht hat. Jedes hübsche Ding in Manhattan wollte ihm vorgestellt werden.«
»Du lieber Himmel, Mummy, weißt du überhaupt nicht, wie Andy eigentlich ist? Er wird diesen blöden Amerikanerinnen Geschichten erzählen, dass er auf Safaris geht, wo er angeblich auf Elefanten reitet und mit bloßen Händen Löwen erlegt, und dann träumen sie alle nur davon, dass er sie nach Afrika mitnimmt, und überlegen sich, was sie dazu einpacken werden. Und sobald er einer an die Wäsche durfte, erzählt er einer anderen die gleiche Geschichte. Das macht er immer. Tu nicht so, als hättest du das noch nicht mitbekommen.«
»Ehrlich, Zalika, du redest manchmal kompletten Unsinn. Und du solltest zu deinem Bruder nicht so gemein sein. Schließlich ist er es, der hart gearbeitet hat, um an der Columbia Business School einen Platz zu erhalten. Angesichts deiner letzten Zeugnisse kannst du von Glück reden, wenn du deinen Abschluss schaffst. Dabei bist du wirklich nicht dumm. Wenn du nur wolltest, könntest du glatt –«
»Das Flugzeug!«, schrie Zalika ihre Mutter ignorierend und schaltete so schnell, wie es nur ein Teenager kann, von wütender Empörung auf höchstes Entzücken. Sie sprang auf, rannte nach draußen die Stufen der schattigen, schilfgedeckten Veranda hinab und sauste auf langen, schlanken, karamellbraunen Beinen über den sattgrünen Rasen, während Jacqui Stratten hinter ihr herrief: »Zalika, Zalika! Komm sofort an den Tisch zurück!«
Frustriert durch das plötzliche Verschwinden der Tochter wandte Jacqui sich ihrem Gatten zu. »Dieses Kind bringt mich noch ins Grab. Und du hättest mir beipflichten können, Liebling, anstatt nur dazusitzen und dich vollzustopfen, während deine Tochter so ungezogen war.«
Dick Stratten erwiderte nichts. Er hatte längst gelernt, dass es Situationen gab, wo ein Ehemann schweigen sollte, weil er sowieso nicht das Richtige von sich geben würde. Es war das Beste, seiner Frau nicht zu widersprechen, damit sie sich die Dinge von der Seele reden konnte.
Draußen auf dem Rasen blieb Zalika abrupt stehen und drehte sich zu ihren Eltern um, die weiter bei ihrem Mittagessen saßen. »Da!«, rief sie und zeigte zum Himmel. »Könnt ihr es sehen? Da kommt Andy! Er ist aus Buweku zurück! Er hat Moses abgeholt!«
Stratten runzelte die Stirn, während er dem ausgestreckten Arm seiner Tochter folgend zum Horizont spähte.
»Meine Güte, das Mädchen hat recht«, sagte er. »Ich werde noch blind auf meine alten Tage.«
Nun stand auch er auf und trat an das Geländer der Veranda. Seinen Bewegungen sah man sofort an, dass von Altersschwäche keine Rede sein konnte.
»Ach, so schlecht siehst du doch gar nicht … wenn man dein hohes Alter bedenkt«, neckte Jacqui.
Sie hatten sich kennengelernt, als Dick dreißig und sie ein junges Mädchen von achtzehn Jahren gewesen war, nur ein Jahr älter als Zalika jetzt. Seine Familie und Freunde, lauter Stützen der malembischen weißen Oberschicht, waren entsetzt gewesen: Sie war viel zu jung und vor allem viel zu gewöhnlich für den Erben der Strattens. Dick kümmerte es nicht, was die anderen dachten. Seine Weltsicht war mehr vom Gesetz des Dschungels geprägt als von gesellschaftlichen Konventionen. Was ihn betraf, so war Jacqui Klerk das begehrenswerteste Mädchen, das er je erblickt hatte, und er würde sie zur Frau nehmen. Sechsundzwanzig Jahre später waren sie noch immer zusammen, und die jugendliche Leidenschaft war zu einer lebenslangen Partnerschaft geworden.
»Sei nicht so hart zu ihr«, sagte Stratten.
»Ja, ich weiß«, seufzte seine Frau. »Es ist nur, nun, ich mache mir Sorgen, dass sie sich in ein Mauerblümchen verwandelt. Wenn man sie so anschaut, sieht man nur diesen tristen Haarwust und die große Strattennase.«
»Eine prachtvolle Nase«, betonte Stratten überaus stolz.
»An einem Mann vielleicht, Liebling, aber nicht an einem jungen Mädchen. Zalika heißt zwar auf Arabisch ›wunderschön‹, aber wir müssen einsehen, dass unsere Tochter dem Namen nicht entspricht. Sie könnte aber weit weniger unscheinbar erscheinen, wenn sie wenigstens einen meiner Ratschläge befolgen würde.«
»Ich finde sie überhaupt nicht unscheinbar.«
»Natürlich nicht; du bist ihr Vater.«
»Trotzdem, ich bin sicher, das ist nur eine Phase. Sie versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. Es ist nur natürlich, dass sie ein bisschen rebelliert. Alle Kinder tun das.«
»Andrew nicht.«
Stratten warf ihr einen fragenden, um nicht zu sagen skeptischen Blick zu. »Vielleicht ist es dir bloß nicht aufgefallen. Jedenfalls bist du die schönste und bestgekleidete Frau im ganzen Süden« – Jacqui Stratten sonnte sich in dem liebevollen Kompliment ihres Gatten – »also rebelliert sie gegen dich, indem sie so tut, als würde es sie nicht interessieren, wie sie aussieht. In dem Moment, wo sie einem Jungen begegnet, den sie wirklich mag, wird sich das ändern. Warte nur ab.«
Jacqui dachte darüber nach, während sie zusah, wie Zalika ein paar weitere Schritte über den Rasen ging. Als das Flugzeug näher kam, schwenkte ihre Tochter die Arme über dem Kopf. Kurz darauf waren die Schwankungen der Tragflächen zu erkennen. Zalika jubelte vor Freude, dann rannte sie los und rief über die Schulter: »Ich hole sie an der Landebahn ab!«
Sie verschwand aus dem Blickfeld vor der Veranda. Kurz danach hörte man einen Wagen starten und die Räder auf dem staubigen Schotter knirschen.
Jacquis Gedanken wandten sich den Jungen zu, denen ihre Tochter entgegenlief, ihrem Sohn Andy – wie stattlich er mittlerweile geworden war, dachte sie stolz – und Moses Mabeki, seinem Freund seit Kindertagen, der der Sohn des Gutsverwalters war. Moses sah genauso gut aus wie Andrew, hatte ein fein geschnittenes Gesicht, das durch den rasierten Kopf umso mehr hervorstach, und volle Lippen, die ein kurz geschnittener Bart einrahmte. Doch wie die Hornbrille rings um seine hellen braunen Augen nahelegte, betrieb er sein Studium mit größerem Ernst. Er hatte die Universität von Malemba besucht, bevor ihm eine Promotionsstelle an der London School of Economics’ Department of Government angeboten wurde. Nachdem ihm als Erstem in seiner Familie eine Collegeausbildung vergönnt gewesen war, hatte er nicht die Absicht, seine Zeit mit Mädchen und Partys zu vergeuden.
Dick Stratten hatte es sich nicht nehmen lassen, dem jungen Mann das Schulgeld und den Lebensunterhalt zu zahlen. »Moses ist für mich wie ein Sohn«, sagte er damals zu Isaak Mabeki, dem Vater des Jungen, während sie gemeinsam eine Flasche mit dreißig Jahre altem Glenfiddich leerten, was sie von Zeit zu Zeit taten. Er sprach nicht wie ein Arbeitgeber mit seinem bewährten Angestellten, sondern er redete von Mann zu Mann. »Ich weiß, er wird eines Tages für dieses Land große Dinge vollbringen. Mit deiner Erlaubnis würde ich ihm auf seinem Weg dahin gern unter die Arme greifen. Es wäre mir ein Vergnügen und eine Ehre.«
Moses hatte die vergangenen drei Jahre in London verbracht und war nur gelegentlich zu Besuch nach Malemba gekommen. Jetzt hatte er die Promotion in der Tasche und kam endgültig heim.
Das Dröhnen der Cessna, die niedrig über das Haus hinwegflog und die Landebahn ansteuerte, riss Jacqui Stratten aus ihren Überlegungen. Blinzelnd schüttelte sie den Kopf und dachte: Ja, es ist noch ein wenig Zeit. Dann lächelte sie einer Hausangestellten zu, die ein paar Schritte vom Tisch entfernt wartete. »Den Kaffee bitte, Mary«, sagte sie. »Mr. Stratten und ich werden eine Tasse trinken, bis die Jungs hier sind.«
4
Der vierundsiebzig Jahre alte Mann, der in dem großzügigen Arbeitszimmer in Sindele hinter dem Mahagonischreibtisch saß, hatte seine Laufbahn als Dorfschullehrer begonnen, in derselben bescheidenen Schule, wo er selbst bei anglikanischen Missionaren seine Ausbildung erhalten hatte. Wäre sein Leben dem vorgezeichneten Kurs gefolgt, wäre Henderson Gushungo nun pensioniert und würde als geachtetes Mitglied seiner kleinen Gemeinde seine Tage unter einem schattigen Baum zubringen, mit den anderen alten Männern plaudern, nörgeln, wie sehr sich die Welt verändert hatte, und sich über seine Enkel freuen.
Gushungo hatte jedoch andere, radikalere Vorstellungen gehabt. Er hatte sich der Widerstandsbewegung gegen die weiße Minderheit angeschlossen, die das Land beherrschte, als wäre es noch immer eine britische Kolonie. Wie Nelson Mandela in Südafrika hatte er seinen Ruf unter seinen Anhängern und Radikalen in der ganzen Welt gepflegt, indem er für seine Überzeugungen ins Gefängnis ging. Aber im Gegensatz zu Nelson Mandela hatte er bei seiner Entlassung aus dem Gefängnis nicht den Willen zur Versöhnung gehabt, sondern nur an Rache gedacht. Jahrelang hatte er an zwei Fronten gekämpft: in der Öffentlichkeit gegen die Weißen und verdeckt gegen seine Rivalen in der Befreiungsbewegung. Nun hielt er das Schicksal des ganzen Landes in seinen Händen. Als er Premierminister gewesen war, hatte er sich zum Präsidenten gemacht und sich nie einer Wahl gestellt, deren Resultat nicht schon festgestanden hatte, bevor eine einzige Stimme abgegeben war.
Gushungo bezeichnete sich als den Vater der Nation. Doch er war ein sehr strenger, grausamer Familienvorstand.
Seine Soldaten kämpften im kongolesischen Urwald. Seine Schergen zwangen weiße Farmer, ihren Besitz zu verlassen, und vertrieben Hunderttausende schwarzer Malember aus Gebieten, wo sie nach seiner zunehmend paranoiden Vorstellung eine ernsthafte Opposition bilden könnten. Seine entmutigten Gegner waren nicht imstande, ihn aus dem Amt zu werfen, und beteten daher zu Gott, er möge das für sie erledigen. Doch der alte Gushungo hatte nicht die Absicht, in nächster Zeit vor seinen Schöpfer zu treten. Sein Haar war noch dicht und schwarz, sein Gesicht bemerkenswert faltenlos, seine Haltung aufrecht. Seine Mutter war über hundert Jahre alt geworden. Er hatte noch viel vor sich.
Auf seinem Schreibtisch klingelte eines der Telefone.
»Die Sache ist angelaufen«, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung.
»Ausgezeichnet«, sagte Henderson Gushungo. »Geben Sie mir Bescheid, wenn die Operation beendet ist.«
5
Als Andy Stratten Moses Mabeki am Flugplatz von Buweku abholte, begrüßte er ihn mit: »Sawubona, mambo!« Auf Ndebele, dem im südlichen Malemba weit verbreiteten Zulu-Dialekt, hieß das: Sei gegrüßt, König!
Moses grinste, als sie die rechte Faust gegeneinanderstießen und dann ans Herz drückten. Hinter der fröhlichen Begrüßung steckte jedoch eine ernste Wahrheit. Für die große Mehrheit der Malember, die auf dem Stratten’schen Land lebten und arbeiteten, war nicht Andy, sondern Moses der wahre Aristokrat. Er konnte seine Abstammung bis zu Mzilikazi zurückverfolgen, dem Gründer des Ndebele-Stammes, der staatsmännische Führungsqualitäten und das Bestreben zum Völkermord in sich vereinigt hatte. Das Land, über das sie auf dem Weg zu den Strattens geflogen waren, war das Territorium, das Mzilikazi vor hundertsechzig Jahren erobert hatte. So hatte es niemanden überrascht, dass Moses in London die Kunst des Regierens studierte. Andy hatte oft zu seinen Freunden gesagt: »Eines Tages werde ich den Besitz der Strattens führen. Aber er wird das ganze Land führen.«
Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis die Cessna ihr Ziel erreichte.
»Jetzt guck dir die an«, sagte Andy, als er das wild winkende Mädchen auf dem Rasen entdeckte. »Ich sag’s dir, Mann, meine Schwester ist das verrückteste Huhn in ganz Malemba.«
Moses lachte. »Sei nicht grausam. Zalika hat ein gutes Herz.«
Stratten landete das Flugzeug mit geübter Leichtigkeit. Bis die Maschine langsam rollend zum Stillstand kam, war Zalika, die eine Staubwolke hinter sich herzog, nur noch ein paar Meter entfernt. Der offene, olivgrüne Landrover stand noch nicht ganz, da warf sie das Mobiltelefon auf den Beifahrersitz und sauste schon auf die zwei jungen Männer zu, die soeben aus dem Flugzeug stiegen.
»Moses!«, schrie sie entzückt und schloss ihn stürmisch in die Arme. »Es ist so toll, dass du wieder da bist!«
»Finde ich auch.« Er klopfte ihr auf die Schulter und belächelte ihren welpenhaften Übermut.
»Bekomme ich keine Umarmung?«, fragte Andy.
»Natürlich nicht«, antwortete seine Schwester. »Dich habe ich noch beim Frühstück gesehen. Du müsstest schon mehr als ein paar Stunden weg sein, wenn du von mir gedrückt werden willst.«
Andy sah seinen Freund an. »Wie gesagt: ein verrücktes Huhn.«
»Und mein Bruder ist ein arroganter, rechthaberischer Mistkerl!«
Die Beleidigung hätte größere Wirkung erzielt, wenn das Mädchen nicht diesen glücklichen Stolz verströmt hätte wie ein Lagerfeuer seine Hitze.
Sie stiegen in den Landrover, Zalika legte den Gang ein, trat aufs Gas, dass sich die jungen Männer krampfhaft festhalten mussten, und fuhr zum Haus zurück.
6
Das südöstliche Viertel Afrikas, das vom Äquator bis zum Kap der Guten Hoffnung reicht, hat spektakuläre Landschaften zu bieten. Zwischen diesen Sehenswürdigkeiten liegen jedoch zahllose Quadratkilometer offener Savanne: jede Menge trockenes Gras mit dem einen oder anderen Busch und Baum. Das ist eine schroffe, aber gerechtfertigte Beschreibung für das Stratten-Reservat. Seine Hauptattraktion waren die dort lebenden Tiere. Und an Tagen, wo die fünf großen unter ihnen – Löwe, Leopard, Nashorn, Elefant und Kaffernbüffel – sich nicht blicken ließen, litten die reichen Touristen schnell unter der Hitze und bekamen schlechte Laune.
Das war die Lage, der sich ein Touristenführer namens Jannie Smuts gegenübersah, nachdem er seinen voll besetzten Geländewagen schon eine Weile erfolglos durch die Gegend gefahren hatte. Seine Kunden hatten bislang nur Warzenschweine, eine paar uninteressante Hirscharten und eine lustlose Giraffe gesehen. Das aber war kaum die große Summe wert, die die Kunden für ihren Afrikaurlaub gezahlt hatten. Smuts selbst konnte sich mehr für den afrikanischen Himmel begeistern: nachts voller Sterne, so gespenstisch bei Sonnenauf- und -untergang und immer unberechenbar, weil sich im Nu aus grenzenlosem Blau eine Masse von Sturmwolken auftürmen konnte. Smuts war jedoch klar, dass die Aufforderung »Sehen Sie sich doch mal diesen wunderschönen Himmel an!« nicht gut ankäme, besonders da das Segeltuchverdeck den Blick nach oben gar nicht zuließ.
Er spürte, wie sich die Enttäuschung hinter ihm auf den Beifahrerbänken aufstaute. Fünfhundert Meter vor dem Akaziengehölz hielt er an. Als er aufstand, um sich seinen Kunden zuzuwenden, war er sich ziemlich sicher, das Blatt noch wenden zu können.
»Hier habe ich jetzt etwas ganz Besonderes für Sie«, kündigte er der Spannung halber mit gesenkter Stimme an. »Gleich um die Ecke gibt es eine Stelle, wo sich Nashörner zum Trinken und Fressen einfinden. Mit ein bisschen Glück sind gerade welche da, und ich kann Ihnen sagen, das ist ein sehenswerter Anblick. Der außerdem überfällig ist, oder nicht?«
Ein erleichtertes Gelächter ging durch den Wagen. Smuts grinste die Leute an, dann setzte er sich wieder hinters Steuer und fuhr weiter.
Sie waren noch zweihundert Meter von dem Gehölz entfernt, als Smuts Schakale sah, die an einem großen grauen Kadaver fraßen. Er fluchte leise und hoffte, dass seine Kunden noch nicht entdeckt hatten, was dort vor sich ging. Er bremste, sprang aus dem Wagen und griff nach seinem Gewehr.
»Bin gleich wieder da, Leute. Will nur rasch nachsehen, ob unsere Nashörner gerade da sind. Bleiben Sie auf jeden Fall im Wagen, ja? Schließlich soll ja keiner verloren gehen.«
Diesmal klang das Lachen ein bisschen nervös, denn die Touristen spürten, dass etwas nicht in Ordnung war.
Smuts blieb kaum eine Minute weg. Als er zurückkam, war ihm die gute Laune vergangen. Er sagte kein Wort, sondern nahm sein Funkgerät und meldete die Tat der Wilderer auf Afrikaans, da er von den Touristen nicht verstanden werden wollte.
Dann ließ er den Motor wieder an, wendete und fuhr auf dem Weg zurück, den sie gekommen waren.
»Tut mir leid, Leute!«, rief Smuts über die Schulter. »Scheint, dass unsere Nashornkumpel gerade woanders sind. Aber keine Sorge, das ist ein großes Reservat. Und früher oder später werden wir die Tiere in ihrem Versteck schon aufspüren!«
7
Als die Meldung durchkam, dass Sinikwe und Fairchild das Opfer von Wilderern geworden waren, war Dick Strattens erster Impuls, selbst hinzufahren und den Vorfall zu untersuchen. Die jungen Männer aber wollten nichts davon hören.
»Komm, Dad, lass mich das tun«, bat Andy. »Ich könnte ein bisschen Aufregung gebrauchen.«
»Das ist es ja gerade«, brummte sein Vater. »Ich will keine Aufregung, sondern nur jemanden, der hinfährt und nachsieht, was passiert ist. Wenn Auseinandersetzungen anstehen, weil Wilderer festgenommen werden müssen, will ich die Polizei dort haben, damit alles offiziell abläuft.«
»Bitte, Mr. Stratten, machen Sie sich keine Sorgen«, sagte Moses. »Ich bin sicher, dass niemand zu Schaden kommt.«
»Aber Moses, mein Lieber«, schaltete sich Jacqui ein, »du musst doch müde sein nach diesem langen Flug von London. Möchtest du dich nicht lieber etwas ausruhen?«
»Bestimmt nicht, Mrs. Stratten, es geht mir gut. Ich habe im Flugzeug sehr gut geschlafen. Erst wenn wir uns um die Sache kümmern, werde ich mich wieder richtig zu Hause angekommen fühlen. Außerdem sind Sie sehr großzügig zu mir gewesen. Ich würde gern die Gelegenheit nutzen und mich nützlich machen, um Ihnen meine Dankbarkeit zu zeigen.«
»Das ist sehr anständig«, räumte Dick Stratten ein. »Also nehmt zwei von den Männern mit. Ich will, dass ihr alle vier bewaffnet seid. Und ihr schießt nur in Notwehr. Habt ihr mich verstanden? Ich will nicht, dass ihr euch da aufführt wie John Wayne.«
»John wer?«, fragte Andy grinsend.
»Du weißt genau, was ich meine, junger Mann. Seid da draußen vorsichtig.«
»Bitte, Liebling«, sagte Jacqui, »tu, was dein Vater sagt. Und komm wohlbehalten zurück.«
Andy Stratten küsste seine Mutter im Vorbeigehen auf den Scheitel. »Machen wir, Mum, keine Sorge«, versprach er, und dann zu Moses: »Los, Boet, lass uns verschwinden!«
Die zwei Freunde zogen sich gegenseitig auf, während sie zu der Stelle hinausfuhren, wo die Tiere geschossen worden waren. Doch das Geplänkel stoppte, sowie die Nashornkadaver in Sicht kamen.
»Scheißkerle!«, zischte Andy. Er wandte sich Moses zu. »Willkommen daheim. Viel hat sich nicht geändert.«
»Nein, noch nicht«, pflichtete Moses bei. »Komm, sehen wir nach, was passiert ist und in welche Richtung die Wilderer geflohen sind.«
Zu viert untersuchten sie den Tatort, gingen jeder Fußspur in dem Gehölz nach, stellten sorgfältig die Fundorte der Patronenhülsen fest, wie es die Polizei auch getan hätte. Fährtenlesen war eine Fähigkeit, die Andy von klein auf gelernt hatte. Für den Ndebele war das jedoch ein Erbe ungezählter Generationen, das bis zum Anbeginn der Menschheit zurückreichte.
Moses sprach mit den anderen beiden Schwarzafrikanern, dann sagte er zu Andy: »Wir sind uns also einig: acht Männer mit Kalaschnikows, aber nur sieben haben geschossen. Der achte Mann stand da drüben und hat zugesehen.«
»Der Anführer«, sagte Andy. »Er hat nur Befehle erteilt.«
»Das nehme ich auch an.«
»Gut, sehen wir mal, wohin sie gegangen sind. Ich weiß, wir haben dem alten Herrn versprochen, dass es zu keinem Zwischenfall kommt, aber wenn ich den Bastard finde, der das befohlen hat, ist er ein toter Mann.«
»Ja, und was passiert dann?«, fragte Moses. »Nichts Gutes für dich, das ist sicher. Also ruhig Blut, du Hitzkopf. Wir heften uns an ihre Fersen. Wir werden sie finden, beobachten, ihre Position melden und auf die Polizei warten. Dann kannst du vielleicht deine Rache bekommen. Aber vorerst folgen wir nur ihrer Spur.«
Die Wilderer hatten versucht, ihre Spuren zu verwischen und falsche Fährten zu legen, doch die Täuschung war ihnen so gründlich misslungen, dass es ihre Verfolger nur zuversichtlicher machte. Es dauerte nicht lange, bis sie die Stelle fanden, wo die Wilderer den Wagen verlassen hatten. Der Reifenspur nach waren sie von der Straße abgebogen, hatten das Fahrzeug in einem Mopane-Gehölz versteckt und waren nach der Tat nicht wieder auf die Straße zurückgekehrt, sondern tiefer ins Buschland gefahren.
»Sie sind zum Fluss«, stellte Andy fest. »Sie müssen verrückt sein.«
»Vielleicht dachten sie, sie können ihn durchqueren«, meinte Moses.
»Die Furten sind aber ganz woanders. Sie können doch nicht so dumm sein, oder?«
Moses zuckte die Achseln. »Nicht dumm, aber vielleicht verzweifelt. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht sollten wir hier Schluss machen. Denk dran, die sind zu acht.«
»Schluss machen? Auf keinen Fall. Ich will diese Scheißkerle auf jeden Fall erwischen.«
Moses erwiderte nichts. Aber seine Fingerknöchel am Gewehr wurden weiß, und sein Blick huschte nervös hin und her, während sie den Pfad entlangschlichen, den der schwer beladene Geländewagen durch das Unterholz gezogen hatte. Rechts und links standen die Mopanesträucher drei Meter hoch.
Jetzt sagte keiner mehr etwas. Die Luft stand still und war mit dem harzigen, terpentinartigen Geruch der Mopanesamen geschwängert. Den Männern klebten die schweißnassen Hemden am Körper. Die Sicht war nach allen Seiten durch Baumstämme, Zweige und Laub stark eingeschränkt. Die Männer liefen geduckt, um unter den tief hängenden Zweigen durchschauen zu können und vielleicht die Füße oder den Schatten eines Wilderers zu entdecken.
Auch bei Andy Stratten war von dickköpfigem Optimismus nichts mehr zu spüren. Sein Vater hatte in dem schlimmen Bürgerkrieg gekämpft, der zur Umwandlung der britischen Kolonie Mashonaland in die unabhängige Republik Malemba geführt hatte, doch an seinem Sohn war dieser gnadenlose Konflikt vorübergegangen. Bei all seinem Gerede von Rache, er hatte noch nie auf Menschen Jagd gemacht und war auch selbst nie das Ziel gewesen. Die Angst packte ihn an der Kehle und drehte ihm die Eingeweide um.
Dann stießen sie plötzlich ins Freie und standen am Flussufer. Dort stand der Hilux mit den Vorderrädern und der Motorhaube halb im Wasser, die Fahrerkabine schräg geneigt, nur die Hinterräder hatten noch Halt auf der nassen, roten Erde des Ufers.
»Scheiße!«, fluchte Andy Stratten. »Ich hoffe, diese dummen Munts können schwimmen.«
Vor lauter Erleichterung hatte er sich vergessen: Er hatte das Schimpfwort der weißen Malember für die Schwarzen gebraucht. Kaum war es ihm herausgerutscht, wurde er sich der Beleidigung bewusst.
Er begann gerade eine Entschuldigung zu stammeln, als er von zwei Schüssen übertönt wurde. Die beiden Farmarbeiter konnten nicht einmal aufschreien, geschweige denn selbst einen Schuss abgeben, als die Kugeln aus den Kalaschnikows sie umrissen.
Nur ein paar Schritte entfernt kamen die Wilderer hinter Bäumen hervor und befahlen Andy und Moses aufgeregt, die Waffen wegzuwerfen. Dann trat ihr Anführer auf den Uferstreifen. Seine Augen waren hinter einer gefälschten Designersonnenbrille verborgen. Er ging auf Andy Stratten zu und stieß ihm den Finger vor die Brust.
»Wer ist hier der dumme Munt, hm?«, sagte er.
Dann ging er aus der Schusslinie und erteilte einen Befehl, worauf das Rattern der Gewehre wieder einsetzte.
8
Sie betrachteten sich als Veteranen, denn sie hatten in ihrer Heimat und im Ausland in der endlosen Reihe kriegerischer Auseinandersetzungen gedient, unter denen Malemba wie viele afrikanische Staaten zu leiden gehabt hatte. Sie trugen die seelischen Narben ihrer Erfahrungen, waren voller Zorn und völlig überzeugt von ihrem Recht auf das Land und das Geld, um sich für ihre Dienste an dem Staat zu entschädigen.
Nachdem sie ihr tödliches Werk verrichtet hatten, zogen sie den Hilux aus dem Fluss, ließen den Motor an und fuhren zurück zu dem Akazien-Gehölz. Dort teilte sich die Gruppe auf. Vier Männer nahmen den Landrover der Strattens und machten sich damit auf den Weg zum Gutshaus. Unterwegs hielten sie einmal an, um auf weitere Bewaffnete zu warten, dann fuhren sie mit der eingetroffenen Verstärkung ihrem Ziel entgegen.
Zalika Stratten hatte aufbegehrt, als ihr Vater ihr befahl, in das unterirdische Versteck der Familie zu gehen, das ein Stück vom Haupthaus entfernt unter einer Werkstatt lag. Die Verbindung zu Andy und seinem Trupp war abgerissen. Von einem abgelegenen Dorf war die Nachricht gekommen, dass ein voll besetzter Kleinlaster mit Bewaffneten unterwegs sei. In einem Land, das an bewaffneten Aufruhr gewöhnt war, machte sich immer jeder auf das Schlimmste gefasst. Wie viele weiße Frauen im Süden Afrikas hatte Zalika jede mögliche Schulung an der Waffe und zur Selbstverteidigung genutzt. In ihren Kreisen war es eine selbstverständliche Erkenntnis, dass sie ebenfalls eine gefährdete Spezies waren.
»Ich weiß, wie man mit einem Gewehr umgeht«, beharrte sie. »Lass mich auch kämpfen!«
Ihr Vater wollte nichts davon hören. »Dieses eine Mal in deinem Leben, Zalika, tu, was man dir sagt!«, schrie er, packte sie beim Arm und schleppte sie zu dem Versteck, ihrer einzigen Hoffnung auf Sicherheit.
»Komm, mein Liebling, du weißt, dass es das Beste für dich ist«, sagte Jacqui. »Daddy möchte sich nicht um uns ängstigen müssen.«
Das Versteck war mit dem Notwendigsten zum Überleben ausgestattet: Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Verbandzeug und ein paar Gewehren. Die Frauen stiegen durch eine Bodenluke und eine Leiter hinunter in einen unterirdischen Raum, dann blickten sie zu Stratten hoch.
»Ihr wisst, worauf es ankommt«, sagte er. »Bleibt hier drinnen. Macht kein Geräusch. Macht kein Licht an. Wenn alles gut geht, komme ich euch wieder rausholen. Wenn nicht, dann wartet, bis es dunkel ist, und versucht im Schutz der Dunkelheit zu fliehen.«
»Oh Dick!«, weinte Jacqui, die nun doch noch die Fassung verlor.
»Schon gut, meine Liebe«, sagte Stratten, der selbst versuchte, sich seine Angst nicht anmerken zu lassen. »Mach dir keine Gedanken. Alles wird gut.« Einen Moment lang schwieg er und drängte seine Gefühle zurück. Dann sagte er: »Ich liebe euch so sehr«, und schloss die Luke.
»Daddy!«, rief Zalika in die Dunkelheit, doch ihr Vater war schon weg.
Unten im Versteck hörten die Frauen die fremden Fahrzeuge ankommen. Sie hörten die Schüsse, die Schreie der Ängstlichen und Verletzten, die verzweifelten Rufe der Verteidiger. Dann, so schnell wie ein durchziehender Sturm, flaute das Gewehrfeuer ab, und statt der Schreie hörten sie vereinzeltes qualvolles Stöhnen, das nach einzelnen Schüssen verstummte. Schließlich flog oben die Werkstatttür auf, und schnelle, zielstrebige Schritte näherten sich der Bodenluke.
Eine Sekunde lang flammte in den beiden Frauen Hoffnung auf, die jede mit einem Gewehr in der Hand im Dunkeln standen. Wer dort oben kam, kannte sich aus, wusste genau, wohin er wollte. Das konnte nur bedeuten, dass es Dick Stratten war oder einer der wenigen Angestellten, die so viel Vertrauen genossen, dass sie das Versteck kannten.
Dann wurde die Bodenklappe aufgerissen und eine Stimme – eine kultivierte Stimme – befahl ihnen: »Lasst die Waffen fallen. Sie nützen euch nichts mehr. Meine Männer haben Handgranaten. Wenn ihr den Schutzraum nicht innerhalb von zehn Sekunden verlasst, unbewaffnet, mit beiden Händen an der Leiter, dann reißen sie euch in Stücke. Zehn … neun …«
»Du heuchlerisches kleines Arschloch«, fauchte Jacqui Stratten. Dann griff sie an die Leiter und rief: »Wir kommen!« Sie stieg hinauf in den Lichtkegel und verschwand durch die Öffnung.
Zalika Stratten folgte ihrer Mutter. Noch ehe sie an die oberste Sprosse fasste, wurde sie von starken Händen gepackt, herausgezogen und auf den Boden geworfen. Sie landete vor den Füßen eines Mannes, die in teuren, kaum getragenen Safaristiefeln steckten.
Sie hörte ihn barsch befehlen: »Bringt die Mutter weg.«
Zalika hob den Kopf und schaute in die Augen von Moses Mabeki, der sagte: »Dein Bruder ist tot. Dein Vater ist tot. Deine Mutter wird auch bald tot sein. Aber du kommst mit mir.«
9
Zwei Wochen später rief ein Mann namens Wendell Klerk bei Carver an und bestellte ihn zu einem Treffen in ein Hotel am Nordufer des Genfer Sees. Klerk sagte nicht, worüber er sprechen wollte. Das war nicht nötig. Er befahl nur barsch: »Seien Sie in dreißig Minuten dort«, und legte, ohne auf Antwort zu warten, auf.
Carvers Neugier war geweckt. Klerk war nicht nur im Wirtschaftsteil der Presse, sondern auch in den Klatschspalten eine bekannte Größe, da er immer unausweichlich mit der neusten blonden Schönheitskönigin liiert war. Er war in eine weiße Arbeiterfamilie hineingeboren worden, eines von zwei Kindern eines Eisenbahnarbeiters und einer sozial ambitionierten Lehrerin. Im Bürgerkrieg hatte Klerk auf der Verliererseite gekämpft und das Land verlassen, nachdem das britische Mashonaland als Malemba wiedergeboren worden war. Er war nach Johannesburg gezogen, wo er eine internationale Firma gründete und zu einem Wirtschaftsimperium ausbaute, zu dessen Geschäftsbereichen Kasinos, Hotels, Baufirmen und Minen gehörten – »vom Kasino bis zum Kohlenbergwerk«, wie ein Journalist es ausdrückte. Klerk war bekannt als taffer Unternehmer. Im Laufe der Jahre hatten Journalisten und feindselige Politiker ihn der Korruption bezichtigt und ihm sogar Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt. Aber keine Anklage erwies sich als haltbar. Wenn, dann sorgten sie nur für Sympathie in der Bevölkerung, die Klerk als harten, aber bewundernswerten Sturkopf betrachtete.
In den vergangenen Wochen war Klerk aber in einem anderen Zusammenhang in den Nachrichten gewesen. Carver vermutete darin den Grund für den Anruf. Er war zumindest neugierig geworden und wollte sich anhören, was Klerk im Sinn hatte.
Siebenundzwanzig Minuten später betrat er die Rezeption eines modernen, niedrigen Klinkerbaus mit Zierelementen, die mehr nach Marokko als nach Schweiz aussahen. Von einem Angestellten wurde er durch die Eingangshalle nach draußen geführt, an einem Swimmingpool mit Liegen vorbei und durch eine Unterführung der Küstenstraße. Dahinter erstreckte sich ein Anleger weit hinaus aufs Wasser, und am Ende lag ein langes, schlankes Motorboot, das einem venezianischen Wassertaxi ähnelte.
Es gehörte zu dem Hotel, der Wimpel am Heck trug dessen Initialen. Der Mann, der am Steuerrad vor der Passagierkabine stand, war keiner der weiß befrackten Bootsführer des Hotels. Er trug die globale Uniform der exklusiven Schläger: schwarzer Anzug, Schlips, weißes Oberhemd, Sonnenbrille und Ohrhörer, eine unsichtbare, aber fraglos vorhandene Pistole.
Carver wurde abgetastet, dann in die Kabine gewinkt, wo Wendell Klerk wartete. Klerks gedrungener, kraftvoller Körper mit dem stupsnasigen Bauerngesicht und dem kurzen, schwarzen Kraushaar wirkte auf den eleganten Polstersitzen so unpassend wie eine Kanonenkugel. Die beiden Männer gaben sich die Hand, dann setzten sie sich und schwiegen, während das Boot ablegte und auf den See hinausfuhr.
Klerk schaute durch ein Bullauge. Offenbar zufrieden, weil sie endlich außer Reichweite landgestützter Abhörgeräte waren, richtete er seine schwarzbraunen Augen auf Carver und fragte: »Sie wissen, wer ich bin, ja?«
»Natürlich.«
»Dann kennen Sie sicher auch mein Interesse an dem Entführungsfall.«
»Sicher, ich verfolge die Nachrichten. Sie sind der Onkel der Stratten-Tochter – der Bruder ihrer Mutter.«
»Folglich können Sie sich denken, warum ich Sie hergebeten habe.« Klerk sprach mit tiefer Brummstimme.
Carver nickte. »Ihre Schwester wurde ermordet und Ihre Nichte entführt. Da auch der Vater und der Bruder tot sind, bleiben nur Sie, um das Mädchen zu befreien. Ich nehme an, Sie haben eine der Topsecurityfirmen angeheuert, damit sie die Verhandlung führt. Offensichtlich hatte sie keinen Erfolg, und nun denken Sie, es ist Zeit für Plan B. Geld ist für Sie kein Problem, und Sie haben sicherlich einige sehr mächtige Freunde mit guten Beziehungen. Mancher von denen könnte zu der Organisation gehören, für die ich mal gearbeitet habe. Vielleicht gehörten Sie sogar selbst dazu. Jedenfalls ist mein Name gefallen, richtig?«
Klerk nickte. »So ungefähr. Ich werde Ihnen die Situation darlegen, wenn Sie erlauben. Die Entführer ziehen alle paar Tage woandershin, aber meine Leute sind ihnen zu jedem Versteck gefolgt. Das war nicht weiter schwer. In Afrika bleibt nichts lange geheim, nicht wenn man bereit ist zu zahlen. Ich habe die Behörden nicht eingeschaltet, weil ich denen weder Geheimhaltung noch angemessenes Handeln zutraue. Stattdessen möchte ich, dass Sie meine Nichte Zalika Stratten befreien. Sie muss unverletzt zurückgeholt werden. Ihre Sicherheit ist der einzige Grund, weshalb ich meine Leute nicht längst hingeschickt habe. Sie sind gut, aber – wie soll ich sagen? – es mangelt ihnen an Raffinesse. Darum bin ich auf Sie gekommen.«
»Mag sein, dass ich raffinierter bin«, sagte Carver. »Aber die Kerle, die Ihre Nichte haben, werden sie kaum kampflos aufgeben. Selbst wenn Ihre Nichte unverletzt bleibt, die Entführer bleiben es keinesfalls. Und ich will nicht in einem afrikanischen Gefängnis verfaulen.«
»Das verstehe ich. Aber seien Sie unbesorgt: Weder mich noch die Polizei wird es kümmern, falls von den Entführern einige für ihre Tat bezahlen müssen. Das werde ich regeln.«
Klerk rieb Daumen und Zeigefinger aneinander, um anzudeuten, dass die Zahlbereitschaft auch hier der Schlüssel zum Erfolg war. Dann blickte er Carver abwägend an.
»Wie groß sind Sie?«, fragte er.
»Eins achtzig.«
»Gewicht?«
»Knapp achtzig Kilo.«
»Halbschwergewicht«, stellte Klerk fest. »Das wird gehen. Sie halten sich in Form?«
Carver dankte dem Himmel für die hundertfünfzig Kilometer Geländelauf, die er in den vergangenen vierzehn Tagen geleistet hatte. »Ja.«
»Komplett genesen?«
Klerk wusste also von der Folter, die Carver in dem Chalet bei Gstaad erlitten hatte, und welches Chaos sie in seiner Psyche angerichtet hatte.
»Ja, ich bin kampffähig.«
Klerk musterte ihn, wie ein Juwelier einen Stein unter der Lupe nach verborgenen Fehlern absucht. »Ja, das glaube ich auch«, bemerkte er schließlich. »Gut, ich bin sicher, wir können uns finanziell einigen, Sie und ich. Meine Leute versorgen Sie mit allen Details, die wir über den derzeitigen Aufenthaltsort der Entführer haben. Darüber hinaus müssen Sie noch zwei Dinge wissen. Erstens ist Zalika alles, was ich noch an Familie habe. Ich habe keine Kinder, Mr. Carver. Habe immer gehofft, es werde einmal jemanden geben, der meine Arbeit weiterführt, wenn ich nicht mehr bin, der mein Geschäft am Leben erhält. Zalika ist meine einzige Hoffnung, und ich werde vor nichts Halt machen, vor absolut gar nichts, wenn ich sie dadurch befreien kann. Was immer Sie brauchen, Sie werden es bekommen. Klar?«
»Vollkommen. Was ist das Zweite?«
»Unsere Geschäftsgrundlage«, antwortete Klerk. »Ich bin ein harter, rücksichtsloser Drecksack, Mr. Carver. In meiner Familie hat meine Schwester das gute Aussehen und die gesellschaftlichen Umgangsformen abbekommen, ich keins von beidem, dafür aber den Willen zu siegen. Und ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Handeln Sie in meinen Augen richtig, und Sie haben nichts zu befürchten. Wenn Sie dagegen je versuchen, mich zu hintergehen, werde ich das nicht vergessen, sondern mit Ihnen abrechnen, egal wie lange es dauert. Nachdem Sie nun wissen, mit was für einem Mann Sie sich einlassen, sind Sie noch interessiert?«
»Ja.«
»Gut. Wann können Sie aufbrechen?«
»Wann geht der nächste Flug?«
10
Die Ostgrenze Malembas ähnelt einem schlecht gezogenen Halbkreis, und der Nachbar Mosambik umklammert das Land wie ein Schraubenschlüssel eine Mutter. Etwa achtzig Kilometer landeinwärts in Mosambik liegt das Städtchen Tete zu beiden Seiten des Sambesi.
Nach einem Zwanzigstundenflug von Genf und zweimaligem Umsteigen kam Carver um neun Uhr morgens dort an. Er erwartete, dass ihm eine feuchte Hitze entgegenschlug, sobald er aus dem Flugzeug stieg. Denn Tete liegt nur sechzehn Grad südlich des Äquators im Wendekreis des Steinbocks. Er wusste auch, dass Mosambik eines der ärmsten Länder der Erde war, verwüstet von über zehn Jahren Aufstand gegen die portugiesischen Herren und einem fünfzehn Jahre währenden Bürgerkrieg, bei dem fast eine Million Menschen umgekommen waren. Doch die Luft war angenehm warm und trocken, und das kleine Abfertigungsgebäude, das in weiß getünchte Spitzdachquader unterteilt am Rand des Flugfelds stand, war überraschend sauber und gut instand gehalten.
Er brachte die Passkontrolle und den Zoll hinter sich und ging hinaus in die Ankunftshalle, wo ein kleiner, drahtiger weißer Mann mit Schnurrbart im ausgebleichten Safarihemd und Khakishorts auf ihn zukam. Er nahm die Zigarette aus dem Mundwinkel und fragte mit aggressiv-kolonialem Akzent: »Sie sind Carver?«
Carver antwortete nicht.
»Flattie Morrison«, stellte der Mann sich daraufhin vor, schnippte den glühenden Stummel auf den Boden und zertrat ihn mit dem Absatz seiner alten Wanderstiefel, bevor er die rechte Hand zur Begrüßung ausstreckte. »Hallo, wie geht’s? Wir haben Sie erwartet.«
»Samuel Carver.«
Morrison drehte sich um und ging voraus durch eine Schar von Leuten, mit denen er Grüße austauschte, im lokalen Dialekt, wie Carver annahm. Dabei winkte er jeden von sich weg, der Anstalten machte, ihn mit einem Schwätzchen aufzuhalten, und teilte im Vorbeigehen fluchend Klapse an die Kinder aus, die in einem fort um ihn herumsprangen.
»Die Munts hier sind in Ordnung, aber sie sind die übelsten Langfinger in ganz Afrika«, erzählte Morrison und schob einen zierlichen Jungen aus dem Weg. »Die klauen einem die Klamotten vom Rücken, und man merkt es erst, wenn einem der Hintern kalt wird. Aber was soll’s, he? Die haben keine Wirtschaft. Was sollen sie also machen, wenn sie Blech brauchen?«
»Blech?«
»Geld, Dollars!« Morrison rollte genüsslich die Zunge um das Wort, dann grinste er, dass sich unter dem grau melierten, rötlich braunen Schnurrbart die Oberlippe zu einem geraden Strich dehnte und eine Reihe strahlend weißer Zähne entblößte. Er tippte sich an die Wange. »Sehen Sie dieses Lächeln, he?«, fragte er und schlug wieder ein Kind mit dem Handrücken weg, ohne seinen Schritt zu bremsen oder mit Reden innezuhalten. »Darum nennen sie mich Flattie. In Malemba ist ein Flattie ein Krokodil. Und das grinst einen genauso an … kurz bevor es Sie verschlingt. Hahaha!«
Sie gingen zu Morrisons Wagen, einem alten Nissan Sunny, der früher einmal rot gewesen war und jetzt ein verwaschenes Rosa mit einem Muster aus Roststreifen, Beulen und Löchern hatte.