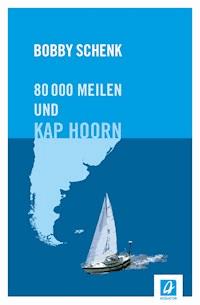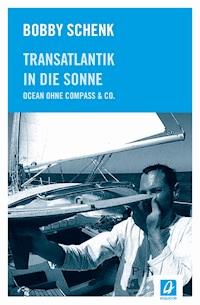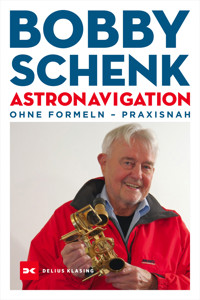
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der einfache Weg zur Astronavigation: Sicher ans Ziel mit Sonne, Mond und Sternen Die Navigation auf See nur mithilfe der Gestirne stellt für viele Segler eine Herausforderung dar. Komplizierte Formeln und komplexe Theorie lassen manchen Einsteiger schnell den Mut verlieren. Navigationsexperte Bobby Schenk zeigt in diesem Praxisband, dass wirklich jeder die Kunst der astronomischen Navigation lernen kann. Kurzweilig und leicht begreiflich vermittelt er die Grundlagen der punktgenauen Orientierung mithilfe von Sonne, Mond und Fixsternen. Der erfahrene Weltumsegler erklärt, wie Sie nur mit Sextant, Gestirnsdaten und der exakten Zeit sicher Ihren Standort ermitteln. • Das Standardwerk zur Astronavigation auf See in der 17. Auflage: kompakt, alltagstauglich und verständlich erklärt • Problemlos navigieren mit Sextant, Chronometer und nautischem Jahrbuch • Alle Grundlagen der astronomischen Navigation: Einführung für Anfänger ohne Vorkenntnisse in Mathematik und Astronomie • Praxisnahes Segelbuch mit zahlreichen Übungen und Aufgaben zum Selbstrechnen Bootsnavigation mit einfachen Bordmitteln: So gelingt die Navigation ohne GPS und Co. Die moderne Satellitennavigation und elektronische Hilfsmittel haben das Navigieren an Bord in den letzten Jahrzehnten wesentlich erleichtert. Trotzdem sollte sich kein verantwortungsvoller Segler allein auf GPS und Computer verlassen. Wenn in Notsituationen die Bordelektronik ausfällt oder nicht nutzbar ist, kann es lebensrettend sein, die klassischen Verfahren zur Standortbestimmung zu beherrschen. Ob Sie Längen- und Breitengrade ermitteln oder das Segeln nach Standlinien lernen wollen: Bobby Schenk hilft Ihnen dabei, vermeintlich komplizierte Vorgänge zu verstehen und im Ernstfall richtig anzuwenden. So verliert die Astronavigation auch für Einsteiger ihren Schrecken!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bobby Schenk
Astronavigation
ohne Formeln – praxisnah
Inhalt
Vorwort
Einführung
I.Grundkenntnisse werden nicht vorausgesetzt
II.An Bord gilt UT1
III.Eine Winkelmessung bringt die Standlinie
IV.Der Bildpunkt – der Schlüssel zum »Geheimnis«
V.Die genaue Zeit
VI.Die erste Standlinie – die Mittagsbreite
VII.Wann ist Mittag?
VIII.Die Mittagslänge aus zwei gleichen Höhen
IX.Das Höhenverfahren oder der Trick mit dem gegissten Schiffsort
X.Hilfsmittel zur Berechnung von Höhenwinkel und Azimut
XI.Die PUB.NO.249-Tafeln
XII.Jetzt geht’s in die Tafel
XIII.Ergebnis aus den Tafeln: Azimut und Höhenwinkel
XIV.Jetzt wird es ernst
XV.Das Zeichnen einer Standlinie
XVI.Die hausgemachte Seekarte
XVII.Die »Versegelung« astronomischer Standlinien
XVIII.Die Technik des Messens
XIX.Die Sonne ist das tägliche Brot des Navigators
XX.Die Sonne ist der beste Kompass
XXI.Der Mond
XXII.Planeten
XXIII.Ausgewählte Fixsterne (Selected Stars)
XXIV.Unterschiede gegenüber Sonnenstandlinien mit PUB.NO.249
XXV.Nachwort
XXVI.Schema Sonnenstandlinie mit PUB.NO.249 oder Mittagsbreite (Nordhälfte)
XXVII.Übungen
Computerprogramm Bobby Schenk’s ASTRO CLASSIC 2.0
Anlagenübersicht
Wo steht was?
Vorwort
Lange wurde die astronomische Navigation als »Geheimwissenschaft« angesehen – mit gutem Grund. Denn vor der Erfindung des Computers, mit dem Vorausberechnungen gemacht werden können, war es keine bequeme Sache, astronomisch zu navigieren, und auch nach Erfindung des Chronometers wäre die genaue Uhrzeit für den Yachtsegler ein Problem gewesen, bis das Zeitzeichen kam. Auch gab die Beschränkung des Wissens über die Navigation auf den langen Reisen früherer Zeiten eine gewisse Sicherheit gegen Meuterei, denn wie sollte Jan Maat das Schiff irgendwohin bringen?
Es ist merkwürdig, wie lange solche Vorstellungen sich halten, auch wenn sie gänzlich überholt sind. Denn die im Laufe der Entwicklung eingeführten Erleichterungen, zu denen zu seiner Zeit auch das Semiversusverfahren gehörte – man sollte es gerechterweise nicht »berüchtigt« nennen –, hätten astronomisches Navigieren schon viel früher zum Allgemeingut des Yachtseglers werden lassen können; einmal macht es irgendwie Spaß, und zum anderen ist es selbst in der Ostsee durchaus nützlich. Auch schont es im Gegensatz zu der geräuschvollen und oft etwas hektischen Funkpeilerei die Nerven und ist mindestens ebenso genau. Doch hier: Jedes zu seiner Zeit! Das Bedürfnis, der Astronavigation den Mythos zu nehmen, haben schon eine ganze Reihe von Autoren verspürt.
Keinem und keiner aber ist das – nach meiner Meinung – so gut gelungen wie »Bobby« Schenk, der seinen Weg mit bisher nicht gekannter Konsequenz gegangen ist. Ich führe das auch auf die schmerzhaften Gehirnsknoten zurück, die ihm das Erlernen der astronomischen Navigation zum leidvollen Erlebnis werden ließen, was ich ihm als mathematisch unterentwickelter Schüler einer humanistischen Lehranstalt lebhaft nachempfinden kann. Wir wollen Bobby Schenk dadurch für seine Mühe und Gedankenarbeit danken, dass wir öfter einmal zum Sextanten greifen und uns dabei freuen, dass einer uns die Arbeit so sehr erleichtert hat. Ihm aber wünschen wir immer die richtigen Sterne und ein zutreffendes Azimut.
Hans-Rudolf Rösing (1905–2004)
Einführung
Mein eigener Weg in die Astronavigation war dornenreich. Mit Semiversusformel, Logarithmentafeln und sphärischer Trigonometrie musste ich mich herumschlagen, um erst im Laufe einer fast vierjährigen Weltumsegelung zu merken, wie viel geistiger Ballast sich da angesammelt hatte. Letztlich kommt es doch nur darauf an, mithilfe der Gestirne den Schiffsort festzustellen. Hierzu bedarf es aber wenig geistigen Handwerkszeugs. »Wenn meine Frau mit ihrem Auto zum Einkaufen fährt, braucht sie nicht die Funktionsweise eines Viertakters zu kennen«, stimmte mir der befahrene Hochseesegler H. Rösing zu. Ein Urteil aus berufenem Munde, denn dieser Segelfreund war »im Hauptberuf« immerhin ein leibhaftiger Admiral der Bundesmarine.
Aus dieser Erkenntnis heraus veröffentlichte die YACHT eine Serie, die den Lesern zeigen sollte, wie einfach sich das »Rätsel« der Astronavigation lösen lässt. Das begeisterte Echo aus dem Leserkreis übertraf alle Erwartungen und gab letztlich den Anstoß zu diesem Buch.
Gleich geblieben gegenüber der Artikelserie ist die Grundidee: Beim Leser wird kein spezielles Wissen vorausgesetzt. Der Stoff beschränkt sich streng darauf, was für die Bordpraxis wichtig ist.
Zusätzlich ist es aber im Rahmen eines Buches möglich geworden, in gleich einfacher Weise nicht nur Mond, Planeten, Fixsterne und astronomische Kompasskontrolle zu behandeln, sondern auch großzügig den angebotenen Stoff mit Beispielen aus der Praxis zu würzen, die mithilfe der beigegebenen Navigationsunterlagen wie in der Navigationsecke an Bord gelöst werden können.
Nach gewissenhaftem Durcharbeiten des Buches wird der Leser in der Lage sein, auf hoher See seinen Standort mittels aller Gestirne festzustellen. Ja, er wird schon auf Seite 38 mit der Sonne seine Schiffsposition bestimmen können. Und zwar nicht nach einer ungenauen Primitivmethode, sondern so, wie viele Weltumsegler den Globus umrundeten, ohne GPS zur Verfügung zu haben.
Hoffentlich bleibt dann aber auch ein wenig Ehrfurcht für das »Wunder« dieser Kunst übrig. Das unbegreifliche Wunder; das darin besteht, dass ein winziger Lichtfleck in der unendlichen Weite des Weltalls dem Skipper auf seinem einsamen Weg über die Meere erzählen kann, wo er sich gerade befindet.
Bobby Schenk
Anmerkung zu dieser Auflage
Vor Ihnen liegt eines der meistgelesenen Segelbücher. Dass in unserer schnelllebigen Zeit ein Buch siebzehn Auflagen erlebt, fast ein Vierteljahrhundert lang unzähligen Fahrten- und Weltumseglern, aber auch Berufskapitänen erfolgreich die romantische „Kunst“ vermittelte, Gestirne als Wegweiser zu benutzen, fasziniert. Auch nach Verbreitung der Satellitennavigation (GPS, GLONASS, Galileo) ist das Interesse an der Navigation mit natürlichen Himmelskörpern ungebrochen und notwendig. Denn Sonne, Mond und Sterne können nicht abgeschaltet werden, nicht versagen, nicht durch Störsender – Jammer – lahmgelegt werden.
Gerade in letzter Zeit haben sich Meldungen gehäuft, nach denen die Satelliten-Systeme senderseitig ausgefallen sind, und zwar nicht nur kurzzeitig, sondern auch über einen längeren Zeitraum, sodass Segler mangels Positionsbestimmung in ernste Schwierigkeiten geraten sind.
Gar nicht so selten ist Yachten zugestoßen, dass auf hoher See die gesamte Elektronik, also auch GPS und Konsorten, Computer und AIS, wegen Blitzschlag ausgefallen ist. Es verwundert deshalb, dass viele Hochseesegler sich nicht mit der Astronavigation beschäftigen, wo sie sich ansonsten auf alle möglichen Störungen bei einem Hochseetörn einrichten, zum Beispiel auf die Möglichkeit eines Unfalls oder eines Überfalls, nicht aber auf die höhere Wahrscheinlichkeit, mithilfe der Gestirne seinen Standort bestimmen zu müssen.
Gewiss, es ist nicht wahrscheinlich, dass die Navigations-Elektronik senderseitig ausfällt oder gestört wird, und empfangsseitig sind ja ohnehin mehrere Satelliten-Geräte an Bord. Dennoch gilt der seemannschaftliche Grundsatz, nach dem für jedes Navigationssystem ein Reservesystem an Bord sein muss, wie eh und je. Und dieses Backupsystem kann auf hoher See nur die Navigation mit den natürlichen Gestirnen sein. Immer noch ist der Ausgangswert, nämlich der gemessene Winkel zwischen Horizont und Gestirn, der entscheidende Wert. Und dieser kann allen technischen Errungenschaften zum Trotz nur vom Menschen ermittelt werden – vom Skipper mithilfe des Sextanten. Genau wie schon vor Hunderten von Jahren. Ein faszinierender Gedanke! Hierzu der interessante Hinweis vom deutschen Raumfahrer Alexander Gerst, nach dem die Rückkehr der in Lebensgefahr schwebenden Astronauten beim Apollo-13-Flug zum Mond („Houston, we have a problem!“) mithilfe eines Sextanten ermöglicht wurde.
Dieses Buch ist also denen gewidmet, und dazu gehören Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, die sich gern auf hoher See unmittelbar mit der Natur und nicht nur mit der Technik auseinandersetzen wollen und demnächst auch können! Sie benötigen zur Bestimmung einer praxisgenauen Schiffsposition nur einen Sextanten, die genaue Zeit und die Gestirnsdaten, also die „Position“ zum Beispiel der Sonne. Diese finden Sie im Nautischen Jahrbuch, was nichts anderes ist als ein umfangreicher Kalender, der für ein Jahr gilt. Ob Sie nun das amerikanische oder englische Jahrbuch benutzen, ist gleichgültig. Das deutsche nautische Jahrbuch wird vorerst nicht mehr gedruckt. Nachdem aber dieses Jahrbuch besonders übersichtlich ist (für jeden Tag eine Seite) wird es hier zur Aufgabenlösung beibehalten.
Bobby Schenk
Merke: Astro-Navigation, also die Wegfindung mit Sonne, Mond und Sternen, ist die einzige absolut sichere und unstörbare Navigationsmethode auf hoher See.
I. Grundkenntnisse werden nicht vorausgesetzt
Astronavigation ist eine überaus einfache Sache, die keine besondere Intelligenz verlangt, sondern nur gesunden Menschenverstand. Um astronomisch navigieren zu können, ist praktisch nicht mehr Wissen nötig, als in der Grundschule vermittelt wird. Kenntnisse in Trigonometrie oder gar sphärischer Trigonometrie sind überflüssig. Der berühmte Bernard Moitessier zum Beispiel wusste nicht, was ein Sinus oder ein Tangens ist, und doch wird ihm wohl niemand die Qualifikation zu einem hervorragenden Navigator absprechen können. Eigentlich ist Astronavigation nicht schwieriger als Navigation in Küstennähe. Eher leichter – denn ohne weiteres ist es möglich, eine Huk mit der anderen zu verwechseln, was einem wohl mit Sonne und Mond nicht passieren kann.
Üblicherweise wird zunächst die Breitenkoordinate genannt, sodass Punkt a in der Zeichnung unten auf 42°N, 18°W liegt.
Aufgabe: Notieren Sie die ungefähren Koordinaten der Punkte b/c/d/e von links unten auf einem Blatt Papier.
Dieses Koordinatensystem muss man sich gut einprägen, denn damit müssen wir uns in der astronomischen Navigation immer herumschlagen. Wie wir später noch sehen werden, spielt sich die gesamte astronomische Navigation auf der Erdoberfläche ab. Es ist deshalb nicht nötig, in drei Dimensionen zu denken, eine Angst, die schon viele abgehalten hat, in diese Sache »einzusteigen«.
Jeder Längengrad besteht aus 60 Längenminuten. Jeder Breitengrad besteht aus 60 Breitenminuten. Das ist wichtig beim Addieren und Subtrahieren.
Da die 78' einen ganzen Grad von 60 Minuten enthalten, lautet das Ergebnis dieser Addition:
Ergibt sich bei einer Addition von Längenoder Breitengraden eine Summe von über 360°, so werden 360° abgezogen.
Ist das Ergebnis bei der Subtraktion ein Minuswert, so »leiht« man sich die 360° (einen ganzen Kreis).
Warnung: 99 % aller Fehler passieren beim Rechnen mit Zeit- oder Winkeleinheiten. Deshalb »so penibel wie ein Buchhalter« rechnen!
Auf der Zeichnung auf Seite 10 sieht man gut, dass die Längenminuten und -grade in Polnähe viel kleiner sind als beim Äquator. Die Breitenminuten und -grade dagegen sind auf der ganzen Welt gleich. Deshalb lassen sich auch die Breitenminuten und Breitengrade ganz gut als Maßsystem für die Seefahrt benutzen, was tatsächlich mit der Seemeile geschehen ist, die genau eine Breitenminute lang ist. Der Abstand von einem Breitengrad zum anderen ist deshalb überall auf der ganzen Welt 60 Seemeilen. Die Koordinaten von b, c, d, e in der Zeichnung links unten lauten:
b:
10°N, 47°W
c:
8°S, 10°E
d:
10°N, 60°E
e:
54°N, 145°W
Berechnen Sie:
Achtung: Zwar besteht 1 Winkelminute aus 60 Sekunden. In der Navigation ist es aber üblich, Bruchteile von Minuten in Zehntelminuten anzugeben (Beispiele 7 bis 9).
II. An Bord gilt UT1
Zwei »Erkenntnisse« erleichtern das Hineindenken in die astronomische Navigation:
Vergessen wir eine Zeit lang, was Schule und Kopernikus gelehrt haben. Für uns dreht sich die Sonne um die Erde. Im Osten taucht sie frühmorgens am Horizont auf, steigt langsam, steht in unseren Breiten mittags auf dem höchsten Punkt ihrer Bahn genau im Süden und geht abends hinter der westlichen Kimm unter.
In der astronomischen Navigation wird nur mit der Weltzeit eins (UT1) gearbeitet.
Die UT1 ist genau:
mitteleuropäische Zeit minus eine Stunde
oder
deutsche Sommerzeit minus zwei Stunden
Die Weltzeit eins (abgekürzt »UT1« von Universal Time One) ist praktisch identisch mit der früher gebräuchlichen mittleren Greenwichzeit. Sie entspricht der englischen Normalzeit, sodass wir die Zeitansage von BBC nicht mehr umzurechnen brauchen. Alle nautischen Unterlagen, die wir benötigen, beziehen sich auf UT1.
Vergessen wir also alles, was wir so an Halbwissen gespeichert haben über wahre Ortszeit, mittlere Ortszeit, Zonenzeit oder gar über den Datumssprung. Gerade Letzterer hat zum Beispiel meinen geistigen Weg in die astronomische Navigation blockiert, weil ich ihn einfach nicht begriffen habe. Dabei war die Aufregung ganz unnötig, denn: Am 28.8. – beim Zwölf-Uhr-Schlag vom Big Ben in London – ist es und bleibt es der 28.8., gleichgültig, ob die Skipperin beim Überfahren der Datumsgrenze vor Fidschi die 19. oder die 20. Pille nimmt. Den Big Ben lässt dies nämlich kalt.
In der Navigationsecke gibt es nur die Weltzeit eins.
Ergebnisse von Seite 11:
1)207°18'
2)121°26'
3)37°03'
4)297°57'
5)306°38'
6)200°25'
7)73°37,7'
8)353°43,6'
9)67°14,6'
III. Eine Winkelmessung bringt die Standlinie
So, jetzt gleich einen Blick in die Praxis! Halt, eines noch: Dieses kompliziert aussehende Statussymbol, das aus einem gewöhnlichen Segler einen »Skipper«, »Käpt’n« oder »Navigator« macht, nämlich der Sextant, ist nichts anderes als ein Instrument, mit dem man einen Winkel messen kann, je nach Qualität bis zu einer Winkelminute (60. Teil eines Grades) genau.
Zum Lernen reicht ein billiger Plastiksextant gerade noch, vielleicht auch einer aus Karton, für den Ernstfall taugen die auf Dauer nichts, zumal Messungen mit ihnen schwieriger sind. Steht man noch vor dem Kauf, so suche man nach einem Vollsicht-Trommelsextanten mit Beleuchtung und höchstens vierfachem Fernrohr. Sonst kein Sonderzubehör wie Libelle etc.!
Deutscher Spitzen-Trommelsextant von Cassens und Plath, der den Stand der Technik darstellt. Vollsichtspiegel, Beleuchtung und Indexverstellung nach Schenk. (Theoretische) Messgenauigkeit besser als 10 Bogensekunden (!).
Weißer Vollsichtsextant (unempfindlich gegen Sonneneinstrahlung) mit Vollsichtspiegel und Fernglas mit eingebautem Kompass – erleichtert das Peilen in der berechneten Sternrichtung.
Funktionsfähiger Nonius-Sextant Anfang 20. Jahrhundert.
Guter Aluminiumsextant aus russischen Flottenbeständen. Keine Beleuchtung.
Sonnenstrahlenweg im Spiegelsystem des Sextanten.
Je nach Stellung der Alhidade, die mit der Hand verschoben wird, wird ein größerer oder kleinerer Winkel gemessen.
Die Abstandsmessung in der Küstennavigation ist das Prinzip der Astronavigation
Das Prinzip der Astronavigation lässt sich recht einprägsam am bekannten Beispiel des Höhenwinkels aus der Küstennavigation erklären. Ständig diesen Vergleich vor Augen, löst sich das vermeintliche Rätsel der Astronavigation auf einfachste Art. Angenommen, wir segeln an einer Küste entlang und wollen die Entfernung zu einem Leuchtturm feststellen, um den Felsen, die unmittelbar vor dem Leuchtturm im Fahrwasser liegen, auszuweichen. Mit dem Sextanten wird dazu ganz einfach der Winkel »Spitze des Leuchtturms – Beobachter – Strandkimm« gemessen.
Es ist wichtig, nicht etwa den Winkel zwischen Spitze und Fuß des Leuchtturms, sondern tatsächlich die Strandkimm zu messen, da im Leuchtfeuerverzeichnis die Höhe immer auf die Grenze zwischen Wasser und Land bezogen ist. Es bedarf sicher keiner besonderen Intelligenz, um sich auszumalen, dass ein bestimmter Winkel im Sextanten nur bei einer ganz bestimmten Entfernung vom Leuchtturm gemessen werden kann. Ist die Yacht näher am Leuchtturm dran, müsste der Navigator mehr zur Leuchtturmspitze aufsehen, der Winkel wäre also größer. Wäre die Yacht etwas weiter entfernt, müsste der Navigator im Sextanten logischerweise einen kleineren Winkel gemessen haben.
Dass sich deshalb aus Winkel im Sextanten und Höhe des Leuchtturms über dem Strand (die im Leuchtfeuerverzeichnis steht) die Entfernung des Navigators zum Leuchtturm berechnen lässt, ist klar. Mit dem Wissen eines Oberschülers in Trigonometrie könnten wir die Formel hierfür leicht selbst ableiten. Aber wozu? Wir wollen ja nach Möglichkeit allen Formeln aus dem Weg gehen. Deshalb reicht es für uns zu wissen, dass die Entfernung berechnet werden kann. Wen diese bekannte Formel aber trotzdem interessiert, sehe in der Fußnote nach.*
Es leuchtet ein, dass wir aus der Entfernung eine sogenannte Standlinie, also ganz einfach eine Linie, auf der sich unser Schiff befindet, erhalten. Wir müssen hierzu nur die berechnete Entfernung, also beispielsweise 1,8 Seemeilen, in den Zirkel nehmen, diesen auf der Karte beim eingezeichneten Leuchtturm ansetzen und einen Kreis schlagen.
So primitiv und einfach sich dieser Vorgang für manchen darstellt, insbesondere für stolze SKS-Inhaber, so ist er doch für uns von ganz enormer Wichtigkeit. Denn genau nach diesem Prinzip funktioniert letztlich die gesamte astronomische Navigation.
Deshalb nochmals durchdenken: Aus Höhe des Feuers über der Strandkimm, Winkel im Sextanten und Position des Feuers bekommen wir die Entfernung vom Feuer und damit einen Kreis als Standlinie. Nun einen Schritt weiter:
Die Yacht ist nicht 1,8 Seemeilen, sondern zum Beispiel 18 Seemeilen vom Leuchtturm entfernt. Dann passiert etwas, was zahlreiche Lehrbücher schlechthin ignorieren: Von der Yacht aus kann der Strand gar nicht mehr gesehen werden, weil er von der Erdkrümmung selbst verdeckt wird. Der Winkel »Leuchtfeuer – Navigator – Strand« kann also gar nicht mehr gemessen werden, sondern nur noch der Winkel »Leuchtfeuer – Navigator – Kimm«. Wann der Strand nicht mehr gesehen werden kann, hängt von der Augeshöhe des Navigators ab. Bei einer für Yachten üblichen Höhe von zwei Metern ist das schon bei einer Entfernung von etwas mehr als zwei Seemeilen der Fall.*
Es lässt sich aber auch jetzt noch vorstellen, dass selbst unter diesen Umständen bei einem bestimmten Winkel im Sextanten nur eine ganz bestimmte Entfernung vom Leuchtturm gegeben ist. Ist die Yacht 18 Meilen entfernt, so ist der Winkel im Sextanten dabei kleiner, als wenn sie nur 5 Seemeilen entfernt wäre. Genauso wie im ersten Fall kann aus dem Winkel und der Höhe des Leuchtturms über der Strandkimm die Entfernung berechnet werden, allerdings nicht auf die einfache Art wie oben.*
Der weitere Arbeitsgang ist der Gleiche wie im ersten Beispiel. Die Entfernung wird berechnet und in den Zirkel genommen. Dieser wird genau in dem Punkt, wo in der Karte der Leuchtturm eingezeichnet ist, angesetzt und ein Kreis geschlagen. Ergebnis: die Standlinie.
*Es handelt sich um die bekannte Formel aus der terrestrischen Navigation:
Aufgrund der terrestrischen Lichtbrechung führt diese Formel zu Ergebnissen, die bis zu 10% von der tatsächlichen Entfernung abweichen können.
IV. Der Bildpunkt – der Schlüssel zum »Geheimnis«
Stellt man sich nunmehr die Spitze des Leuchtturms als Sonne, Mond oder ein sonstiges Gestirn vor, so ist man mitten in der astronomischen Navigation. Wiederum werden benötigt:
der gemessene Winkel,
eine Position in der Seekarte, um die der Kreis mit der Entfernung geschlagen werden kann.
Was aber ist mit der »Höhe« des Gestirns entsprechend der Leuchtturmhöhe?
Um diese Größe können wir die ganze Angelegenheit vereinfachen. Die Höhe, also die Entfernung Erdoberfläche – Gestirn, braucht nicht berücksichtigt zu werden, da ausreichend genau gesagt werden kann:
Die Gestirne befinden sich im Unendlichen.
Unklar ist aber nun, welcher Punkt in der Karte verwendet werden soll, um den Zirkel einzusetzen, also die Position des Gestirns. Bleiben wir noch einmal beim Leuchtfeuer. Würden wir oben von der Spitze des Leuchtturms zum Erdmittelpunkt eine senkrechte Linie ziehen (ein Lot fällen), so würde diese Linie, wenn wir nicht gerade den schiefen Turm von Pisa als Beispiel gewählt haben, genau an dem Punkt auf die Erdoberfläche treffen, wo sich das Fundament des Leuchtturms befindet und wo seine Position auch exakt in die Karte eingezeichnet ist. Das Gleiche macht man mit den Gestirnen in der Astronavigation.
Der Punkt, an dem eine gedachte Linie zum Erdmittelpunkt die Erdoberfläche durchsticht, ist analog zum Fußpunkt des Leuchtturms der »Bildpunkt«.
Diese gedankliche Einrichtung ist schlechthin der Schlüssel zum Geheimnis der Astronavigation. Mit seiner Hilfe wird erreicht, dass die Position eines Gestirns, das sich irgendwo im Unendlichen im Weltall befindet, mit ganz gewöhnlichen Erdoberflächen-Koordinaten angegeben werden kann: Angenommen, die Wolkendecke würde eine so kleine Öffnung freilassen, dass zufällig nur ein einziger Sonnenstrahl durchleuchtet, und dieser würde genau Richtung Erdmittelpunkt strahlen, dann würde er beim Auftreffen auf die Erdoberfläche genau den Bildpunkt der Sonne beleuchten. Oder: Ist die Sonne so genau über einer Yacht, dass ein senkrecht stehender Mast kein bisschen Schatten mehr wirft, ist die Schiffsposition genau auf dem Sonnenbildpunkt. Natürlich nur für einen ganz kurzen Moment, denn die Sonne steht ja nicht den ganzen Tag über ein und derselben Position auf der Erdoberfläche.
Wir wissen, dass sie sich genau einmal in 24 Stunden um die Erde dreht, ihr Bildpunkt deshalb mit ihr in Jetgeschwindigkeit um die Erde von Osten nach Westen rast. Nun beginnen wir auch zu ahnen, warum für die Astronavigation die genaue Uhrzeit von so enormer Wichtigkeit ist. Immerhin beträgt ja die Bildpunkt-Geschwindigkeit die ca. anderthalbfache Schallgeschwindigkeit. So rast der Bildpunkt beispielsweise am 23.8.2000 in wenigen Stunden über den Atlantik in Richtung Amerika hinweg.
Wollen wir später einen Kreis mit der Entfernung Bildpunkt – Beobachter um den Bildpunkt schlagen, so muss selbstverständlich die Position des Bildpunktes nach Breite und Länge im Zeitpunkt der Messung genau bekannt sein.