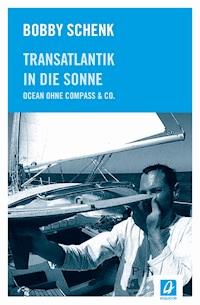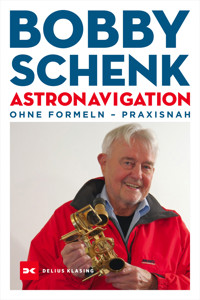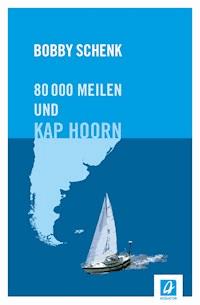
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aequator
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller von Bobby Schenk jetzt erstmals als E-Book: Der bekannte Fahrtensegler beschreibt seinen Weg vom Binnensegler zum Blauwassersegler. In eindrucksvollen Worten berichtet er von der fast vierjährigen Weltumseglung, die er mit seiner Frau Carla auf der Thalassa unternommen hat, und von seinem Leben in der Cook’s Bay in Moorea. Er erklärt, was ihn schließlich wieder nach Deutschland zog und warum der Weg dorthin um das berüchtigte Kap Hoorn führte – das Kap, das er nie hatte umsegeln wollen. Bobby Schenk ist der Spagat zwischen dem Blauwassersegeln und dem bürgerlichen Leben in Deutschland gelungen. Und erstaunlicherweise waren es eher die Zeiten an Land, die ihn zum Navigationsexperten haben werden lassen. „80.000 Meilen und Kap Hoorn“ ist ein Buch über die Abenteuer, Erfahrungen und Erlebnisse des Blauwassersegelns. Für diejenigen, die von einer solchen Reise träumen, ist dieses Buch ein Leitfaden, wie der Traum Wirklichkeit werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Bibbliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet unter https://dnb.de abrufbar.
Aequator Verlag GmbH, München © 2016 Aequator Verlag
ISBN 978-3-95737-016-7
Inhalt
Vorwort
Bayerische Seemannschaft
Mit Seesack Richtung Mittelmeer
Hafentage
Die ersten Seemeilen
THALASSA
entsteht
Lehrjahre
Das Wichtigste ist der Segelschein
Die Aussteiger
Wir sind frei
Trödeln durch das Mittelmeer
Atlantikbahnhof Kanaren
Törnziel: Horizont
Das Atlantiksyndrom
Westindien enttäuscht
In Lebensgefahr vor Panama
Der Kanal
Moderne Robinsons
Per Passat in die Südsee
Ruderärger und die Maharani
Tahiti – Treffpunkt der Hochseevögel
Inselsprünge
Der Sturm aller Stürme
Ein halbes Hafenjahr in Fidschi
Kolonialparadiese
Der Ruhm des Meeres
Berufssportler
Die Rettungsaktion
Über die Arafurasee
Buntes Bali
Ein Sandkorn im Indischen Ozean
Vor Madagaskar
Mozambique kocht
Am Kap der Stürme
Die Deutschen von der Skelettküste
Im freundlichen Südatlantik
Resozialisierung
Seglertragödie
Fernweh und kein Ende
Mister Modul
Ein gutes Omen
Wieder unterwegs
Regatta mit Karl, dem Segelmacho
Horrordrama auf See
Kurs Südsee
Gefangen auf einer Insel
Marquesas – auch Paradiese sterben
Wettkampf in den Tuamotus
Leben im Land der Träume
Heimatadresse: Cook’s Bay, Pao Pao
Der dritten Dimension entgegen
Gäste im Paradies
Eine polynesische Legende
Als Prediger in der Wüste
Die Wende
Abschied
Kurs liegt an: Kap Hoorn
Im Reich des Gottes der Westwinde
Im Griff des Riesen des Westens
Das Hoorn backbord voraus
Zum zweiten Mal Kap Hoorn
Willkommen in Argentinien
7.000 Meilen zum Ziel
Vorwort
Dies ist ein persönliches Buch. Es berichtet vom Leben auf dem Wasser und unseren Reisen rund um den Globus.
Darüber hinaus möchte ich dem Leser einen Einblick gewähren in die internationale Szene jener Yachtleute, die mit ihren winzigen, schwimmenden Untersätzen mit Windeskraft die Weltmeere bezwingen – wie einst die großen Entdecker.
Die Yachties haben eine besondere Art zu segeln und zu leben. Daran soll der Leser teilhaben.
Weiter will das Buch diejenigen ermutigen, die glauben, aus Geldmangel, anderweitigen Verpflichtungen oder gesundheitlichen Gründen auf bestimmte Dinge des Lebens verzichten zu müssen. Sie werden sehen, dass Menschen mit dem anderen Lebensstil, von denen in diesem Buch die Rede ist, keineswegs solche reichen, sorgenlosen und gesundheitsstrotzenden Typen sind, zu denen sie in den Medien häufig hochstilisiert werden. Trotzdem konnten sie den Traum von der großen Freiheit verwirklichen.
Schließlich möchte ich ungeschminkt die negativen Seiten des Blauwassersegelns aufzeigen – wo gibt es solche nicht? Dem einen oder dem anderen, der mit seinem Schicksal im engen Deutschland hadert, kann ich damit vielleicht etwas Zufriedenheit zurückgeben.
Alle geschilderten Begebenheiten sind wahr. Es kann aber nicht Sinn eines solchen Berichtes sein, Menschen zu kränken. Deshalb habe ich einige Personen durch Namensänderung unkenntlich gemacht.
Ich danke Maria-Theresa Hruschka-Jäger für ihre Mitarbeit und Karl Heinrich Markert, ohne dessen selbstlosen Einsatz mein Buch in dieser Form nicht entstanden wäre.
Bobby Schenk
Bayerische Seemannschaft
Um was ich die „Nordlichter“ wirklich beneide, ist ihr Zugang zum Meer. Wie schön es sein muss, quasi vor der Haustüre ein Segelschiff liegen zu haben und, wann immer man will, die Segel zu setzen, um hinaus auf die Weltmeere zu gleiten.
„Unser“ Meer hingegen ist das Mittelmeer, weit jenseits der Alpen. Wenn ich gefragt werde, wie wir zum Segeln gekommen sind, kann ich leider nicht sagen: „Ich bin am Wasser aufgewachsen und soweit ich zurückdenken kann, verbrachten meine Eltern und ich den Urlaub auf den hölzernen Planken eines Segelschiffs.“ Nein, meine erste Begegnung mit einem „Schiff“ (an das großartige Wort „Yacht“ konnte ich mich nie gewöhnen) fand auf einem bayerischen See statt, dem Chiemsee. Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt.
Mein Spezi Manni und ich mieteten uns bei einem Bootsverleih einen Chiemsee-Schratz’n und weil offensichtlich das Wetter gar so schön war, dachte sich der Bootsverleiher nichts dabei, uns Lausbuben ein Boot anzuvertrauen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass er uns vorsichtshalber das Vorsegel, die Fock, nicht mitgab, was unsere Begeisterung leicht dämpfte, weil wir meinten, ein richtiges Schiff müsse natürlich unbedingt zwei Segel haben. Manni und ich setzten uns unter das killende Großsegel, Herr Grünäugel gab uns einen leichten Schubs und los ging’s.
Bald hatten wir heraus, dass man mit einem Segelboot nicht einfach in eine beliebige Richtung fahren kann, sondern dass die Windrichtung bestimmt, welches Ziel leicht und welches nur mit Mühe zu erreichen ist. Aber es machte uns einen Riesenspaß quer zum Wind auf und ab zu fahren.
Ohne dass es uns jemand gezeigt hätte, fanden wir gleich heraus, wie man mit so einem Boot eine Wende fahrt, also durch den Wind dreht, und auf der anderen Seite in die entgegengesetzte Richtung weitersegelt. Wir hatten ja kein Vorsegel dabei und so musste an den Segeln nichts bedient werden.
Als die 60 Minuten abgelaufen waren und wir wegen unseres beschränkten Taschengeldes den Schratz’n zum Bootsverleih Grünäugl zurückbringen mussten, stellten wir fest, dass die Segelei doch nicht so ganz einfach und problemlos war, wie uns die abgelaufene Stunde vorgegaukelt hatte. Ich saß am Ruder, während Manni auf dem Vorschiff mit der Festmacheleine darauf wartete, dass der Schratz auch schön am Steg anhalten würde.
Als wir mit reichlich Raumschotsfahrt den Kopf des Steges erreicht hatten, wurde mir zum erstenmal im Leben klar, dass ein Segelschiff über keine Bremse verfügt und das Abstoppen eines Schiffes schon eine gewisse Segelfertigkeit verlangt. Als die ersten Pfähle an uns vorbeirauschten, das Ufer urplötzlich nahekam, merkte das auch Manni. Ich hatte gerade noch Zeit, ihm zuzurufen, dass er das „Seil“ einfach um einen Stempen wickeln solle, als auch schon der letzte Pfahl auf uns zukam. Eben noch rechtzeitig, bevor sich der Bug des schönen Chiemsee-Schratz’n in die Uferböschung gebohrt hätte, gelang es Manni, die Schlinge über den Pfahl zu werfen. Das hatten wir beim Cowboyspielen gelernt.
Unser schwimmender Untersatz wurde schlagartig abgestoppt und Manni verschwand kopfüber im frühjahrskalten Chiemsee. Ich war von meiner ersten Segelpartie sehr begeistert; im Gegensatz zu meinem Freund, der schlotternd vor Kälte mit mir die 60 Kilometer lange Heimfahrt auf dem Fahrrad antrat. Vielleicht ist aufgrund dieses Erlebnisses in Manni die Liebe zur See erloschen.
Keineswegs aber gab dieses Erlebnis den Anstoß, mich nunmehr ganz intensiv der Segelei zuzuwenden. Das war schon vom Taschengeld her nicht drin. Und wie sollte man in diesen Jahren privat an ein Segelschiff kommen, wenn die Eltern kaum in der Lage waren, das beruflich so dringend benötigte Auto zu bezahlen. So blieben diese 60 Segelminuten eine einzigartige Kindheitserinnerung.
Mehr als ein Jahrzehnt später kam ich wieder mit dem Wassersport in Berührung, freilich mit einem ganz anderen als dem lautlosen Dahingleiten mit Windeskraft. Zwischenzeitlich war ich ein leidenschaftlicher Wasserskifahrer geworden und meine gesamten Ersparnisse, die ich als Student beim Taxifahren verdiente, gingen für diesen – wie ich damals glaubte – sündhaft teuren Sport drauf. Fast die ganzen Semesterferien verbrachte ich in Kärnten am Wörthersee, wo ich wochenlang versuchte, mit 52 Stundenkilometern alle acht Bojen beim Slalom zu erwischen oder auf einem Ski einen Helikopter zu springen.
Obwohl mein Ehrgeiz deutlich größer war als mein Talent, denke ich auch heute noch als Segler gerne an diese Tage im sommerlichen Velden zurück. Zwar ist der Wasserskifahrer auf die mechanische Motorkraft angewiesen, doch hat auch er die Begegnung mit der Natur. Wenn sich im Herbst frühmorgens der Bodennebel verzogen hat, noch kein Hauch Wind sich regt und die Wasseroberfläche von keinem anderen Motorboot bewegt wird, dann glaubt man, hinter dem starken Riva-Motorboot durch Butter zu gleiten – die Karawanken spiegeln sich unverzerrt im Wasser. In diesen Momenten verschwimmt das Motorgeräusch und für Augenblicke entsteht die Illusion, man könnte aus eigener Kraft über das Wasser gleiten. Später, wenn gegen zehn Uhr der Ostwind aufkommt, dann hat dieses Vergnügen allerdings ein Ende, denn bei einer Geschwindigkeit von nur 50 Stundenkilometern wird die Wasseroberfläche schon bei zwei Windstärken unangenehm wie eine buckelige Skipiste. Dann macht das Wasserskifahren kein Vergnügen mehr.
Diese paar winzigen Wellen am Wörthersee – noch dazu ohne Schaumkronen – haben entscheidend dazu beigetragen, dass ich einen großen Teil meines späteren Lebens auf den Weltmeeren zubrachte. Denn der besagte Ostwind war pünktlich jeden Tag um zehn Uhr da und verurteilte uns den ganzen Vormittag und Nachmittag zum Faulenzen, bis er sich am späten Nachmittag wieder legte und der See so glatt wurde wie am frühen Morgen. Da das Wasserskilaufen während des Tages reine Geldverschwendung gewesen wäre, drängte es sich natürlich auf, mit einem der zahlreichen Segelschiffe rumzufahren, die dort den Touristen angeboten wurden.
Eines hatte es mir ganz besonders angetan. Es war ein Boot mit Kajüte, in meinen damaligen Augen schon ein richtiges Schiff. Dieses wurde nicht an Selbstfahrer und schon gar nicht an so einen Unerfahrenen wie mich vermietet; in dem horrenden Preis war der Schiffsführer inklusive.
Und so mieteten wir eines Vormittags dieses stolze Schiff mit seinem Kapitän namens Strolchi. Wir, das waren ich und Carla. Ich hatte Carla beim Tischtennisspielen kennengelernt, wo ich mit großem Fleiß und nicht sehr viel Talent über Jahre hinweg vergeblich danach trachtete, zumindest in die bayerische Spitzenklasse am grünen Tisch vorzudringen. Carla Schulz hatte das längst geschafft, sie hatte sage und schreibe über 40 bayerische und auch eine Deutsche Meisterschaft gewonnen. Klar, dass sie für mich ein richtiger Star war und ich träumte davon, mit ihr einmal ein gemischtes Doppel zu spielen. Dazu kam es allerdings nie, denn hierfür waren meine Künste mit dem weißen Zelluloidball an der Platte zu dürftig. Zu einem Doppel fürs Leben reichte es allerdings.
Aber mit all unserer Sportlichkeit konnten wir an Bord von Strolchis Boot zunächst mangels Wind nichts anfangen. Der Ostwind, der allemal ausreichte, uns das Wasserskifahren zu verleiden, schob das schwerfällige Kajütboot mit mäßiger Brise von Velden in Richtung Pörtschach. Die ganze Segelpartie wäre tödlich langweilig geworden, wenn Strolchi nicht einer von jenen Kärntner Burschen gewesen wäre, die es fertigbrachten mit ihrem originellen österreichischen „Schmäh“ die für so etwas stets empfänglichen Touristen, die wir ja waren, für den Segelsport zu begeistern. Den fehlenden Wind ersetzte er durch spannende Storys und er verstand es, glaubwürdig zu vermitteln, dass in seiner Person so ungefähr der Erfinder des Segelns schlechthin vor uns stünde.
Jetzt, einige Jahrzehnte danach, weiß ich, dass Strolchi in diesem Sport, bei dem es keine absoluten Messwerte wie beim Hundertmeterlauf gibt, nur den Durchschnittssegler verkörpert, der jeden davon überzeugt, nur er und kein anderer würde diesen Sport wirklich beherrschen. Das aber wusste ich damals noch nicht. Ich glaubte, dass ein Seemann schon wegen seiner Verbundenheit mit der Natur in aller Bescheidenheit immer die Wahrheit ausspricht. Seemannsgarn, dachte ich, sei allein eine Sache von Berufsskippern.
Und so hing ich dann gebannt an den Lippen von Strolchi, als er von den Stürmen erzählte, die von den Karawanken herunterpfiffen und denen er im Gegensatz zu anderen Wörthersee-Seglern immer aufgrund seiner unerhörten Geschicklichkeit heil entkam. Da merkte ich erst, was mir alles in den vergangenen Jahren entgangen war, als ich mich für diesen „Sport der Könige“ (wie Strolchi ihn nannte) noch nicht interessiert hatte.
Es gibt sicher im Leben eines jeden Menschen Worte oder Aussprüche eines Freundes, die für das Ohr eines dritten banal klingen, die aber ungeheuer beeindrucken und für immer im Gedächtnis haften bleiben. Für mich gehört hierzu auch die Antwort Strolchis, als ich ihn fragte: „Wenn das Segeln auf einem kleinen Binnensee schon so aufregend ist, wie ist das erst auf dem Meer?“
Strolchi zögerte nur ein paar Sekunden und sagte dann mit ehrfurchtgebietender Flüsterstimme: „Das ist das Größte!“
Dieses war zu einer Zeit, als es noch keinen Cassius Clay gab und man mit derartigen Superlativen knauserte. Carla und ich waren jedenfalls ungemein beeindruckt und starrten Strolchi wie jemanden an, der von einem anderen Stern kam. Erst viel später hat mir Strolchi gebeichtet, dass er niemals auf einem anderen Gewässer als dem lieblichen Wörthersee gesegelt war.
Für uns tat sich eine neue Welt auf. Hatten wir doch erfahren, dass man mit so einer kleinen Nussschale, die sich „Yacht“ oder „Kajütboot“ nannte, tatsächlich auf einem offenen Gewässer herumsegeln könne. Wie bequem uns das alles schien. Wenn es zu regnen begann, kroch man ganz einfach in die Kajüte, die zwar keine Stehhöhe hatte, wegen ihrer Kleinheit aber eine ungeheure Gemütlichkeit ausstrahlte. Sogar ein Ofen war da, mit dem man eine Konservendose aufwärmen konnte, so dass man selbst auf einer mehrtägigen Reise nicht verhungern musste.
Da sich unsere Segelerfahrungen zu diesem Zeitpunkt nur auf wenige hundert Meter Chiemsee und Wörthersee erstreckten, dachten wir natürlich nicht daran, dass sich so ein Schiff in den Seen eines Ozeans wesentlich heftiger bewegen würde und es dann keinesfalls sehr gemütlich in der Kajüte sein würde. Aber in Gedanken segelten wir schon auf dem Meer; tatsächlich waren wir vom Hochseesegeln noch Jahre entfernt. Ein Jahr später waren wir dann zwar am Meer, an der Adria, allerdings nicht mit dem Boot, sondern mit Auto und Zelt, das wir auf einem Campingplatz bei Rimini auftaten. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, so drängt sich mir der Eindruck auf, dass es uns vorherbestimmt war, einmal auf dem Wasser zu leben, denn gleichgültig, was wir anstellten, wir wurden immer wieder mit dem Wassersport konfrontiert.
Ein netter holländischer Zeltnachbar hatte ein kleines Motorboot mit einem kräftigen Außenborder hinter seinem Auto nach Italien geschleppt und lud uns zum Wasserskifahren ein. Ich begann zu rechnen. Zwar braucht so ein Motorboot 30, 40 Liter die Stunde, aber bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern kann man natürlich auf dem Wasser ungeheure Strecken zurücklegen. Ich dachte mir, dass so ein Motorboot doch wesentlich praktischer sei als ein Segelboot, wenn man nur schön brav an der Küste entlangfährt.
Um ein Haar hätte ich mir in der Folgezeit ein kleines Boot mit Außenborder gekauft, um in der Adria die Küste abzurasen. Statt der Kajüte hätten wir – so unser Plan – ein Zelt dabeigehabt, das wir jeden Abend „am Strand“ aufbauen wollten.
Heute kann ich über eine derartige Einfalt nur den Kopf schütteln, denn selbst an Küsten wie der italienischen Adria gibt es nicht allzu viele Stellen, wo man über Nacht so mir nichts, dir nichts ein kleines Schiffchen mit einem Außenborder dran liegen lassen könnte, um beruhigt die Nacht im Zelt auf einer Luftmatratze zu verbringen. Aber damals lernten wir eben nur die Badeadria im August kennen, wo sich über Wochen kein Hauch regte und die Strände von uns nur aus der Sicht eines Schwimmers oder allenfalls eines Wasserskifahrers begutachtet wurden.
Die entscheidende Wende in unserem Seglerleben kam, als meine Eltern überlegten, ob sie nicht ein kleines Segelschiff anschaffen sollten, das im Herzen von Oberbayern, am Waginger See, stationiert werden sollte. An sportlicher Betätigung hatten meine Eltern kein großes Interesse mehr. Sie suchten nur nach einer Möglichkeit, den einen oder anderen Nachmittag, nach der Arbeit irgendwie am Wasser auszuspannen. Und so überließ man mir großzügig die Auswahl des „Schiffes“. Zur Debatte stand eine Jolle vom Typ Zugvogel oder allenfalls ein Flying Dutchmann.
Besonders der FD ist, wie mir „Fachleute“ bestätigten, ein recht heißes Sportgerät. Das schmälerte mein Interesse an dieser Rennziege. Denn als Sportart habe ich die Segelei nie angesehen; für mich lag der Reiz beim Segeln immer darin, sich frei auf dem Wasser bewegen zu können und den Gesetzen des Windes unterworfen zu sein. Da gefiel mir ein Zugvogel schon besser, denn der führte auch die Bezeichnung Wanderjolle und dies war genau das, was ich suchte. Wir wollten den Urlaub nicht mit stotterndem Motor im Stau am Brenner rumstehen oder in Hotels und an Stränden verbringen, die von Reisegruppen überfüllt sind, sondern beschaulich auf dem Wasser von Bucht zu Bucht zu wandern, davon träumten wir.
Wahrscheinlich würde ich noch heute die acht Längen- und drei Breitenkilometer des Waginger Sees auf einem Zugvogel absegeln, wenn ich nicht an einem für mich sehr denkwürdigen kalten Märznachmittag fröstelnd vor einem Bahnhofskiosk herumgestanden und überlegt hätte, mit welcher Lektüre ich die zweistündige Wartezeit bis zum nächsten Zug nach München am besten überbrücken könnte. Schon wollte ich nach einem technischen Magazin greifen, als mein Blick auf das Titelbild einer Segelzeitschrift fiel, das mich sofort faszinierte. Da stand ein würdiger grauhaariger Engländer – wegen seines Habitus war das auf Anhieb zu erkennen – am Ruder einer riesigen Yacht. So jedenfalls wirkte das Schiff auf mich, hatte ich mich bis dahin doch höchstens für Jollen am Waginger See interessiert. Die Reling auf der Leeseite tauchte halb ins Wasser und die See überspülte das Mahagonideck bis zu den Wadeln von Sir Nicholson (den Namen fand ich später im Text). Die Hosenbeine (sicher war es Flanell) klebten an den Beinen des Steuermanns, dessen kühler Gesichtsausdruck diese Ungemach auch nicht andeutungsweise wiedergab. Im Gegenteil, der Blazer mit einem weißen Spitzentüchlein brachte deutlich zum Ausdruck, dass Sir Nicholson die Yacht – und die See natürlich – voll im Griff hatte. Im Hintergrund dann zur Abrundung jede Menge Schaumkronen. Ich habe seither kein Foto mehr gesehen, das auch nur annähernd so gut die gekonnte Lässigkeit wiedergegeben hätte, mit der man ein Meer befahren kann. „Sie werden ganz nass, Sir“, stand unter dem Foto.
Ich kaufte die „Yacht“. Es war die erste, die ich in die Finger bekam und ich bin überzeugt, dass der Kauf speziell dieser Nummer der Zeitschrift, von der ich noch Hunderte von Ausgaben lesen sollte, mein gesamtes Leben verändert hat. Schon beim ersten Durchblättern tat sich mir eine ganz neue Welt auf. Zwar hatte ich bei Ferienaufenthalten am Mittelmeer mit der Unwissenheit der Landratte auf die Segelyachten mit den kleinen Fenstern heruntergesehen und kaum glauben wollen, dass das Innere eines solchen Schiffes groß genug zum Übernachten sei. Auf den Fotos in der „Yacht“ blickte ich zum ersten Mal in die Kajüte. Da waren richtige Tische, an denen man sitzen und essen konnte. In den Werbeanzeigen waren die Tische meist mindestens so reichhaltig gedeckt wie in einem Schlemmerlokal. Die Abbildungen von den Kartenecken strahlten so viel Wärme aus, dass man zu spüren glaubte, wie wohlig sich der Navigator fühlen musste, wenn draußen der Sturm tobte.
Ich geb’s ganz ehrlich zu, dass diese Wohnwagenatmosphäre mich an der ganzen Segelei mehr beeindruckte als die Tatsache, dass die Riesenpötte in der „Yacht“ immerhin imstande waren, über die Ostsee ins Ausland, nach Schweden oder Dänemark, zu segeln. Spätestens eine Stunde nach Beginn der Lektüre stand für mich fest, dass unser Segelschiff nur eines mit einem Dach sein konnte. Ein Kajütboot also.
Die Eltern waren schnell überredet, die für damalige Zeit ungeheuerliche Summe von 13.000 Mark auszugeben. („Mein Gott, dafür bekommt man ja schon ein Auto!“). Ein Bootsbauer war uns auch gleich empfohlen worden, es sollte der Moser Fredl sein, der ohnehin seinen Betrieb am Waginger See hatte, wo wir in Zukunft segeln wollten.
An einem regnerischen, nasskalten Frühjahrssonntag war es dann soweit. Wir fuhren nach Waging um ein Boot in Auftrag zu geben. Zu dieser Zeit wussten Carla und ich noch nicht, mit welchen Aufregungen, Enttäuschungen, aber auch befriedigenden Stunden der Bau eines Schiffes verbunden ist. Damals dachten wir, dass ein Schiff so ähnlich wie ein Auto bestellt wird, ein Verkäufer Prospekte und Kataloge vorlegt, Proben der zur Auswahl stehenden Farben der Sitzgarnituren die Farbauswahl erleichtern und an den Sachverstand des Käufers nicht allzu große Anforderungen gestellt werden.
Mit derartigen Erwartungen fuhren wir also nach Waging zur Werft vom Moser Fredl. Obgleich Sonntag, war die Werkstatt geöffnet. Der Geruch nach Sägemehl und frischer Lackfarbe stieg uns in die Nase. An einer Hobelbank stand ein kleiner Mann und bearbeitete mit Hingabe eine Holzplanke. Als wir näher traten, sah er nur kurz auf, ließ sich aber ansonsten in seiner Arbeit nicht stören. Geduldig warteten wir ein paar Minuten, bis wir ihn dann – aufgrund der für uns ungewohnten Umgebung – recht schüchtern fragten, ob wir den Moser Fredl sprechen könnten. Ein kurzes Gebrummel war mit einigen Schwierigkeiten als „ja“ zu verstehen. Mehr sagte der Mann nicht und setzte er seine Arbeit fort. Nach weiteren fünf Minuten wagten wir die gleiche Frage, bekamen aber nur die gleiche Antwort „joooh“, was bayerisch ist und mit „ja“ übersetzt werden könnte.
Mit anbiedernden Fragen und Blicken auf die umherliegenden Jollen versuchten wir uns bei diesem mürrischen Mann einzuschmeicheln: „Schöne Schiffe haben sie hier!“
„Joooh“, war alles, was zu hören war.
Nach einer Viertelstunde beendete der Mann an der Hobelbank dieses „Verkaufsgespräch“ und ließ uns einfach stehen. Glücklicherweise lief uns kurz darauf ein anderer Mitarbeiter der Werft über den Weg, der etwas zugänglicher war und den wir deshalb nochmals nach dem Moser Fredl fragten. „Sie haben gerade mit ihm gesprochen“, meinte er.
Irgendwie ist es uns dann doch gelungen, mit dem Moser Fredl ins Gespräch zu kommen. „Ja, wenn ihr ein Boot mit Dach haben wollt, dann kommt für euch nur ein 16er Jollenkreuzer in Betracht. Aber könnt ihr überhaupt segeln?“
Übereinstimmend meinten Carla und ich, dass dies schon irgendwie zu erlernen sei. Der Fredl wiegte den Kopf und riet uns dann doch, zunächst mal einen Zugvogel zu kaufen, eine offene Jolle also. Wir bestanden aber auf unser Kajütboot und der Fredl gab es schließlich auf, uns den halb so teuren Zugvogel einzureden. Drei Monate später sollte das Boot geliefert werden.
In der Folgezeit fuhren wir fast jedes Wochenende in die Werft, um nach dem Fortschritt unseres Schiffes zu sehen, aber der Fredl vertröstete uns jedes Mal mit seiner Arbeitsüberlastung und meinte treuherzig, es würde schon rechtzeitig fertig werden.
Mein Nachbar, ein erfahrener Segler, der allerdings den Fredl nicht kannte, beriet mich inzwischen in Ausrüstungsfragen. Eine Toilette müsste das Schiff haben und eine Pantry mit Gaskocher, eine Küche also. Und ob das Schiff denn überhaupt schon auf Kiel gelegt sei, fragte er
„Auf Kiel gelegt“, der Ausdruck faszinierte mich, das klang so richtig nach Großschifffahrt und weitem Meer. Der Moser Fredl lächelte nun doch etwas in sich hinein, als ich ihn ebenfalls fragte, ob denn das Schiff nunmehr schon auf Kiel gelegt sei. Er belehrte mich zunächst einmal, dass ein Jollenkreuzer gar keinen Kiel habe, sondern nur ein Schwert und auf das könne man ein Schiff nicht legen, weil das Schwert üblicherweise in den Schwertkasten eingezogen wird. Auf mein Drängen, dass ich unser Schiff gerne im Bau besichtigen wolle, zeigte er auf einen großen Stapel von Brettern, die nach meiner laienhaften Ansicht gerade aus der Kreissäge gekommen waren, und meinte treuherzig: „Da, ich hab’ schon alles hergerichtet.“
Das war immerhin 14 Tage vor dem Ablieferungstermin. Meine Wünsche nach Toilette und Gaskocher kanzelte Moser Fredl ehrlich und rüde ab: „Eine Toilette braucht’s ihr nicht und Gas ist sowieso verboten. Wenn euch das nicht passt, lasst euch euer Schiff woanders bauen.“
Um es kurz zu machen: Zwei Wochen später standen wir einem glänzenden Mahagonikunstwerk gegenüber, das jeden beeindrucken musste, der auch nur ein wenig Sinn für den Werkstoff Holz hat. Sogar der Moser Fredl strahlte, als er sah, wie wir die Bootsplanken liebevoll mit den Händen abtasteten: „Gei, des gfoit eich!“ („Gell, das gefällt euch!“)
Unser Seglerleben hatte begonnen. Fredl Moser gab uns einen winzigen, malerischen Liegeplatz an seinem Waginger See, wo wir ab sofort jede freie Minute auf unserem Jollenkreuzer verbrachten. Natürlich hatten wir keine Ahnung vom Segeln, aber glücklicherweise schämten wir uns unserer Unkenntnis nicht. Zum Segelnlernen hatte ich mir ein dickes Buch, die „Seemannschaft“, gekauft und arbeitete dieses auch gleich Seite für Seite durch. Ich verstand kaum etwas, weil die Seemannssprache von Fachausdrücken nur so wimmelt, dass allein mit gesundem Menschenverstand kaum etwas anzufangen ist. „Backbord“ für links und „steuerbord“ für rechts, das geht noch. Warum man aber für die Küche „Pantry“ und für einen Strick je nach Verwendungszweck „Schot“, „Trosse“, „Fall“, „Bändsel“, „Leine“, „Tau“ oder „Tampen“ sagt, das habe ich damals noch nicht (und auch heute noch nicht ganz) begriffen. Eines wurde mir aber schon bald nach der Lektüre der schlauen „Seemannschaft“ klar: dass Segeln eine relativ harmlose Angelegenheit ist, wenn man ganz, ganz vorsichtig und mit viel Sicherheitsbewusstsein an die Sache herangeht.
Ich muss damals den Mitgliedern im Waginger Segelclub ziemlich auf die Nerven gegangen sein mit meiner Fragerei. Ich löcherte sie mit theoretischen Fragen und wen immer ich erwischen konnte, lud ich zu einer Segelpartie ein, damit ich möglichst von dem Können der heimischen Cracks profitieren konnte. Ich scheute mich auch nicht, gegenüber jedermann meine Unkenntnis einzugestehen, was mir natürlich viele wertvolle Tipps einbrachte. Auf dem See rief ich ungeniert andere Segler – heute würde ich natürlich „anpreien“ sagen –, um mir eine Halse erklären zu lassen. Glücklicherweise war die Jahreszeit so, dass wir bei unseren ersten Segelversuchen von schlechtem Wetter verschont blieben. Bis auf den Tag, als die Bootstaufe nachgeholt werden sollte.
Wir waren mit unseren Eltern bei wenig Wind in eine kleine Bucht gesegelt, hatten zum erstenmal den Anker aus der Backskiste herausgeholt, daran eine kleinfingerdünne „Schnur“ angebunden und ihn über Bord geworfen. Langsam ließen wir uns dann an der Ankerleine zurücktreiben, bis sie sich im leichten Gegenwind straffte und wir das Gefühl hatten, wir lägen hier so sicher wie in Abrahams Schoß. Wie tief es an dieser Stelle war und von welcher Beschaffenheit der Grund war, interessierte uns nicht.
Dann machten wir es uns im Cockpit gemütlich, deckten einen Tisch mit den mitgebrachten Brötchen und holten den Sekt aus der Kühltasche. Die Sonne brannte, der wenig kühlende Wind ließ nach und bald hielten wir in den Kojen ein Mittagsschläfchen.
Wenige Stunden später wachten wir auf, weil unser Jollenkreuzer, den wir dem Zeitgeist folgend GAMMLER getauft hatten, recht heftige Rollbewegungen machte. Ein Blick aus der Kajüte zeigte über uns ein unheildrohendes, dunkles Firmament, das sich immer mehr verdüsterte. Die ersten Regentropfen fielen vom Himmel und wir holten die Persenning aus der Backskiste, um sie über unseren GAMMLER zu decken. Wir waren kaum beunruhigt, denn schließlich lagen wir ja „sicher vor Anker“.
Die Spirituslampe wurde in der Kajüte angezündet und wir fanden es richtig gemütlich. Dann aber fiel der Föhnsturm über uns her. Schlagartig merkten wir, dass die Segelei selbst auf kleinen Binnenseen gar nicht so ungefährlich ist. GAMMLER rollte in den kurzen steilen Wellen. Er wurde von jeder See hochgehoben und ruckte jedesmal derart ächzend in die Ankerleine ein, dass es auch uns Laien klar wurde, dass der Beschlag, an dem die Ankertrosse befestigt war oder sie selbst durchaus brechen könnte. Jetzt traute ich auch meinem „Knopf“ am Anker nicht mehr.
Durch die Schaukelei und den stechenden Geruch der Spirituslampe wurde uns allen kotzübel. Seemännisch gesagt, wir wurden seekrank. Nur dachten wir damals nicht daran, denn „Seekrankheit“ war etwas, was es nur auf dem Meer gibt. Nein, für seekrank hielten wir uns nicht, denn das wäre uns doch zu blamabel gewesen.
Kurzum: Am frühen Abend ließ der Wind nach, der Himmel hellte sich nochmals auf und bald war die untergehende Sonne zu beobachten. Auf dem See herrschte totale Flaute, so, als ob nichts gewesen war. Unser Anker hatte uns sicher gehalten. Dort aber, wo die Trosse über den Bugrand zum Decksbeschlag verlief, war sie nur noch halb so dick wie vorher. Keine ganze Stunde mehr hätte sie den GAMMLER im Sturm gehalten. Sie war viel zu kurz gewesen, um das gefährliche Einrucken zu vermeiden. Entsprechend fest saß der Anker. Was wir auch versuchten, er war nicht aus dem Grund zu bringen. Schließlich blieb uns nichts anderes übrig, als an die Ankertrosse einen leeren Benzinkanister zu hängen und mit dem Außenborder nach Hause zu tuckern. Wir hatten unsere allererste eigene Erfahrung in Sachen „Seemannschaft“ gemacht.
Abschrecken ließen wir uns dadurch freilich nicht. Kaum 14 Tage im Besitz des GAMMLER, liehen wir uns vom Moser Fredl einen Bootsanhänger, von einem Freund einen kräftigen Pkw und verbrachten unseren ersten Schiffsurlaub am Plattensee in Ungarn. Damals hatte so ein Urlaub mit dem eigenen Schiff in fremden Binnengewässern etwas Pionierhaftes, ja Abenteuerliches an sich, zumal der ausländische Bootstourismus in Ungarn noch in den Kinderschuhen steckte.
In vier Wochen skipperten wir teils unter Segel, teils mit Außenborder gemächlich alle Häfen des 72 Kilometer langen Plattensees ab. Wir waren das einzige ausländische Schiff, noch dazu aus dem Westen, das sich in diesem Jahr auf dem Plattensee tummelte, und so lernten wir unsere ungarischen Segelkameraden von der herzlichsten Seite kennen. Auch dort luden wir, wann immer es ging, andere Segler ein und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann einmal jemand an Bord hatte, von dem ich nicht mindestens eine Kleinigkeit über das Segeln gelernt hätte.
Zur großen Verwunderung vom Fredl Moser brachten wir unseren GAMMLER zurück an den Waginger See, ohne dass dieser eine einzige Schramme bekommen hatte.
Mit Seesack Richtung Mittelmeer
Wahrscheinlich würden wir noch heute mit einem Mahagoni-Jollenkreuzer auf dem Waginger See herumsegeln, wenn Carla und ich nicht anlässlich meines bestandenen Staatsexamens auf die Idee gekommen wären, einmal einen ganz besonderen Urlaub zu verbringen. Ehrlich gesagt: Ich hatte dabei nicht an einen Urlaub auf dem Wasser gedacht, sondern eher an einen reinen Badeurlaub, in einem eleganten Hotel, in Tunesien oder Marokko, denn ein Segelboot hatte ich ja zu Hause auch. Als ich dann vom Reisebüro mit einem dicken Packen Prospekte zurückkam, zeigte mir Carla in der „Yacht“ ein kleines Inserat:
Von Nizza nach Sevilla zur Semana Santa auf der 19-Meter-Ketsch KALINA. Pro Person DM 250,-, Essen inklusive. Anfragen an Fa. Obercharter Tel.: 089/...
Mein Gott, das ist ja fast um ganz Spanien herum, stellten wir fest, als wir gleich in den Atlas sahen. Wir waren wie elektrisiert. Waren wir bisher am Waginger See nur mal in eine andere Bucht zum Kaffeetrinken gefahren oder am Plattensee von einem Hafen drei, vier, fünf Kilometer weiter zum anderen Hafen geskippert, musste man ja auf der Karte, um von Nizza nach Sevilla zu kommen, richtig von einem Land ins andere segeln. Ja, wenn wir durch die Straße von Gibraltar mussten, könnte man vielleicht sogar auf der afrikanischen Seite einen Stopp einlegen, man würde also nicht nur von Land zu Land, sondern sogar von einem Kontinent zu einem anderen segeln.
Robert Werner, der Boss der Firma, meldete sich am Telefon. Ja, es seien noch zwei Plätze frei und die Reise würde pünktlich beginnen und auch ebenso pünktlich wieder beendet sein.
Wir ließen uns die Unterlagen kommen. Die Firma Obercharter sandte uns einen schönen Katalog mit vielen Schiffen und noch mehr Symbolen darin. Danach hatte die KALINA tatsächlich alles, was man sich für einen Urlaub am Mittelmeer erträumen kann. Tauchsachen, Schlauchboot mit starkem Außenborder zum Wasserskifahren und Angelzeug schienen bei der KALINA zur Standardausrüstung zu gehören. „Captain Harrick kocht persönlich für Sie, seine Küche ist an der ganzen Côte d’Azur berühmt“, lockte der Prospekt.
Am meisten aber beeindruckte uns ein weitgehend unscharfes und fast schon verblichenes Polaroidbild. Das war offensichtlich auf der KALINA aufgenommen und zeigte ein älteres Segelschiff, inmitten eines Mastenwaldes, in einem überfüllten Mittelmeerhafen. Überall, wo man hinsah, Holz, Teakplanken und schwere Beschläge, mit einer dicken Farbschicht überzogen. Mit einem Wort, so richtig schiffig sah die KALINA auf diesem Foto aus. Ohne zu zögern rief ich die Firma Obercharter an und verabredete ein persönliches Treffen mit Robert Werner.
Gleich am nächsten Tag trafen wir uns in einer Kneipe und ließen uns über die Einzelheiten von der Reise von Nizza nach Sevilla aufklären. Robert Werner war ein beeindruckender Mann. Sportlich gekleidet, braungebrannt, schien er direkt von Bord einer seiner zahlreichen Charteryachten zu kommen. Er drückte sich verständlich aus, das heißt, er verwandte in seinen Erzählungen gerade so viel Seemannsausdrücke, dass man noch kapierte, über was er sprach. Er erzählte uns von seinen zahlreichen zufriedenen Kunden. (Wobei er verschwieg, dass wir die ersten Kunden seiner Firma überhaupt waren.) Er versprach, uns weitere Unterlagen über den Törn von seinen „Damen im Büro“ zuschicken zu lassen. (Später stellte sich heraus, dass er überhaupt keine „Damen“ hatte, sondern dass seine Frau die Post erledigte.) Auf unsere Frage, ob der Skipper Harrick zuverlässig sei, meinte Robert Werner selbstsicher: „Captain Harrick ist unser zuverlässigster Mann.“ Was auch zutraf, da er zu dieser Zeit nur eine einzige Yacht – und damit nur einen einzigen Kapitän – unter Vertrag hatte. Robert Werner gab uns eine Menge einleuchtender Tipps aus seiner eigenen Segelpraxis. (Dass er kurz zuvor in der R-Schein-Prüfung am Chiemsee durchgefallen war, erzählte er natürlich auch nicht.) Aber diese Schwachpunkte der Firma Obercharter (Werbeslogan: „Größte europäische Yachtagentur“) ahnten wir damals noch nicht und selbstverständlich wussten wir auch nicht, dass ein derartiges Gebaren nicht gerade die Ausnahme im Chartergeschäft ist. Wir buchten jedenfalls und sehnten den Tag des Törnbeginns herbei.
Die KALINA wartete in einem kleinen Yachthafen bei Nizza auf uns. Im März waren die meisten Yachten noch nicht bewohnt und so hatten wir einige Mühe, „unser“ Schiff zu finden. Aber die Atmosphäre im Yachthafen vermittelte mir ein kribbeliges Gefühl, wie ich es auch heute noch empfinde, wenn ich etwa in einer Marina über schwankende Schwimmstege gehe.
Ein Nichtsegler kann kaum dieses Gefühl und die Aufregung nachempfinden, den Duft von frischem Bootslack einzuatmen, Holz zu riechen, Fallen an den Masten schlagen zu hören, mit einem Wort: Yachtatmosphäre zu schnuppern. So erging es uns auch, als wir unsere Seesäcke keuchend in Richtung KALINA schleppten. Endlich, gleich beim Wellenbrecher, lag sie vor uns. Sie sah so aus, wie ich mir damals ein Segelschiff vorstellte. Etwa 20 Meter lang, zwei Masten, dicke weiße Ölfarbe am Rumpf, Teakplanken an Deck und die Decksaufbauten in Mahagoni. (Dieses Holz kannte ich natürlich vom GAMMLER und von „meinen“ Riva-Motorbooten vom Wörthersee.)
Freilich nahm ich auch eine verwirrende Unordnung an Deck wahr, aber in diesem Moment wusste ich nicht einzuordnen, ob dieses Durcheinander nun zu einer Segelyacht gehörte oder ob die KALINA ganz einfach noch nicht aufgeräumt war. Oder, wie ich später zu sagen pflegte, noch nicht „klar Deck“ war. Ein Gummischlauchboot lag halb aufgeblasen herum, ein Fahrrad lehnte am Mast, angerostete Taucherflaschen versperrten den Weg zum Niedergang, Fensterscheiben fehlten an dem einen oder anderen Bullauge, halb ausgepackte Segelsäcke lagen an der Reling und wenn man zum Bug vorgehen wollte, musste man zwischen unendlich vielen Farbtöpfen hindurch balancieren.
Heute könnte ich die Situation ganz gut einschätzen: Die KALINA war keineswegs seeklar und an ein Auslaufen am nächsten Morgen, wie zugesagt, war nicht im Traum zu denken. Wir waren zu sehr von der uns vollkommen neuen Umgebung in einem Yachthafen am Meer verzaubert, als dass wir uns um unsere Abreise oder ähnlich kleinliche Dinge gesorgt hätten. Roger, ein etwa 22-jähriger bärtiger, bulliger Mann mit einem gütigen Gesicht, der sich als Bootsmann vorgestellt hatte, schleifte unsere Seesäcke an Deck, wo uns aus dem Niedergang herauf der Skipper, der Captain, entgegenkam.
Hafentage
„Welcome on board“, begrüßte er uns mit einer tiefen Stimme. Seinen Mund sah man vor lauter Vollbart kaum. Genauso hatten wir uns einen Seebären vorgestellt. Zerschlissene Hosen, ein dunkelblauer, dicker Wollpullover waren seine Kleidung. Obwohl er also keine Uniform oder sonst etwas trug, was ihn als den Herren dieses Schiffes kenntlich gemacht hätte, erkannten wir ihn sofort als Mike Harrick.
Mike führte uns in den Salon, wo noch andere Mitsegler warteten, die ebenfalls gerade angekommen waren. Wir betrachteten uns gegenseitig und mutmaßten, dass auch die anderen mindestens genauso aufgeregt waren wie wir. Es stellte sich heraus, dass wir alle nur wenig Seeerfahrung hatten; nur Bill, ein Engländer, war mit Captain Harrick schon einmal gesegelt. Herbert und Erika, ein Ehepaar aus Berlin, hatten ebenfalls nur Binnenerfahrungen.
Der letzte im Bunde der Gäste war ein Herr in mittleren Jahren, an seinen Gesichtszügen und an seiner scharfgeschnittenen Nase sowie am akzentfreien Englisch unschwer als Brite zu erkennen. Sein Pullover war ebenso flauschig dick wie der von Mike; trotz der tiefschwarzen Ölflecken konnte man die einstmals weiße Wolle noch vermuten. Die Hose war von leuchtend orangeroter Farbe, lediglich seine Mütze passte nicht zur sonstigen Kleidung. Sie war tatsächlich schneeweiß mit viel Goldschnüren daran, so wie sie Offiziere auf einem Passagierdampfer tragen. Er stellte sich als Lord Guilsborough vor und fügte gleichzeitig seine Adresse hinzu: wohnhaft in Guilsborough, Guilsborough Street und Guilsborough House.
Natürlich ließen wir uns gleich die Seekarte geben, breiteten sie auf dem großen Tisch im Salon aus und steckten die Köpfe darüber, gerade so eng zusammen, wie es die heiße Petroleumlampe eben noch zuließ. Geplant war die Reise also von Nizza durch den Löwengolf zu den Balearen, von dort an der Costa del Sol entlang nach Gibraltar, dann rechts um die Ecke in den Atlantik rein, um anschließend den Guadalquivir nach Sevilla hochzufahren.
Bald begannen wir Pläne zu machen, wie wir die Reiseroute unter Umständen abändern könnten, um den Törn noch abwechslungsreicher zu gestalten. Afrika könnte man da beispielsweise anlaufen und vielleicht sogar die Kanarischen Inseln. Was machten schon 400 Seemeilen mehr oder weniger aus? Mike versicherte uns, dass die KALINA gut und gerne 120 Seemeilen pro Tag, also in 24 Stunden, machen würde. Naja, da wären ja nur sechs Tage zu veranschlagen, um auch die Kanarischen Inseln mitzunehmen.
Mike Harrick saß dabei und lächelte nur in sich hinein. Zu oft hatte er derartige Gespräche unter Neulingen schon erlebt. Natürlich wusste er, dass Chartertörns grundsätzlich anders ablaufen als geplant. Auf unsere Frage, wann wir auslaufen werden, meinte Mike, dass morgen Vormittag nur noch ein paar Sachen zu erledigen seien, das Schiff aufgeklart werden müsse und dann stünde einer Abreise nichts mehr entgegen.
Ungefähr das gleiche erzählte er uns zwei Tage später immer noch. Die anderen Gäste begannen bereits unruhig zu werden, aber Carla und mich störte die Verzögerung nicht. Stundenlang streiften wir durch den Hafen und versuchten Kontakte mit anderen Yachtleuten zu knüpfen. Bald hatten wir heraus, dass es dazu eine ganz einfache Methode gab. Man stellt sich an die Pier und wenn jemand im Cockpit erscheint, versucht man, ihn mit geistreichen Fragen ins Gespräch zu ziehen. „Wie lang ist diese Yacht eigentlich?“
Man muss natürlich entsprechend vorbereitet sein, um nicht schon bei der bündigen Antwort „11 m 30“ nur schweigend zu nicken. Es bietet sich als sofortige nächste Frage beispielsweise an: „Dann ist innen sicher Platz für mindestens vier Kojen!“ Wenn der Yachtmann antwortet: „Oh, wir haben sogar sechs Kojen“, dann kann man schon sicher sein, dass die Aufforderung: „Wollen Sie mal einen Blick ins Innere werfen?“ nicht mehr lange auf sich warten lässt.
So kann man ganze Tage damit verbringen, sich von Yacht zu Yacht durchzufragen. Mir haben diese Gespräche mindestens die Hälfte all meiner Segelerfahrungen eingebracht und ich verstehe es auch heute noch nicht, wenn Segler über einen missglückten Charterurlaub klagen, weil man angeblich soundsoviele Tage durch unnötige Hafenaufenthalte verloren hat. Wenn man sich beispielsweise vorstellt, wie viel Geld manche Leute ausgeben, um jährlich ein- oder zweimal auf eine Bootsausstellung zu fahren, um dort vor neuen, unerprobten Schiffen zu stehen, von – meistens – nichtsegelnden Verkäufern weitergereicht zu werden, dann ist es unerklärlich, warum diese „Segler“ sich über die angeblich wertlose Zeit im Yachthafen beschweren.
Besonders gut kann ich mich an ein älteres Ehepaar erinnern, das ein für damalige Zeiten immerhin recht großes Schiff von 15 Metern Länge zu zweit von England um Spanien herum ins Mittelmeer gesegelt hatte. Er war Direktor einer kleinen Fabrik in Rhodesien, hatte diese wegen der politischen Schwierigkeiten aufgegeben und sein ganzes Geld in die Yacht gesteckt. Für seine 80 Jahre war der weißhaarige Herr erstaunlich rüstig und es machte ihm sichtlich Spaß, Carla und mich, die aus ihrer Unerfahrenheit keinen Hehl machten, etwas einzuweisen: „Wann immer du auf ein fremdes Schiff kommst, nutze jede Minute, um dich umzusehen. Ich verspreche dir, dass du auf jeder Yacht mindestens ein Detail entdeckst, das du für deine eigene Segelpraxis verwerten kannst.“
Man bekommt in seinem Leben so viele Ratschläge, dass es kaum möglich ist, zwischen den besonders guten und den nur wohlgemeinten zu unterscheiden. Die meisten, auch wenn sie recht weise sind, vergisst man ohnehin. Wenige bleiben im Gedächtnis und von diesen nimmt man auch nur selten bewusst den Vorteil wahr, den sie einem gebracht haben. Dem Tipp des klugen Rhodesiers aber verdanke ich sicher den größten Teil meiner seglerischen Erfahrung. Auch heute noch, wenn ich auf eine Yacht gehe, um mich zu unterhalten, verlasse ich sie nie, ohne nach diesem einen Detail zu suchen, von dem jener Skipper damals in Nizza gesprochen hat.
Allmählich merkten auch wir Landratten, dass die KALINA langsam in einen seetüchtigen Zustand gebracht wurde. Wir hatten uns durch viele Gespräche in diesen Tagen schon ein kleines seemännisches Grundwissen angeeignet, auch wenn es noch eine ganze Reihe von Dingen gab, die uns verwirrten. Mein dickes Buch, die „Seemannschaft“, hatte ich natürlich mit an Bord und so konnte ich Details, die mich interessierten, immer nachlesen.
Aber es gab da doch einige Dinge an Bord der KALINA, die sich mit meinem angelernten theoretischen Wissen nicht in Einklang bringen ließen. So irritierte mich, dass der große Kompass der KALINA nicht draußen auf dem Ruderstand angebracht war, sondern immer noch auf dem Sofa im Salon lag. Mit einem jede weitere Diskussion ausschließenden breiten Lächeln beantwortete Mike Harrick meine bohrenden Fragen. Um die Kompensation des Kompasses solle ich mir mal keine Gedanken machen. Schließlich sei man auf einem Holzschiff und im Mittelmeer würde sich die Deviation mit der Missweisung genau aufheben.
Gläubig nickte ich, denn damals konnte ich nicht glauben, dass ein ausgewachsener Seebär wie Mike Harrick mir einen derartigen Unsinn erzählen würde. Denn die Deviation ist die Ablenkung des Kompasses, die durch magnetische Störfaktoren wie Metallmassen (Maschine) an Bord hervorgerufen wird. Missweisung dagegen ist die Ablenkung des Kompasses, die daher kommt, dass der geographische Nordpol mit dem magnetischen Nordpol nicht zusammenfällt. Natürlich gibt es Kurse, auf denen sich die Missweisung und die Deviation tatsächlich aufheben; aber das ist reiner Zufall, denn auf anderen Kursen können sie sich addieren.
Obgleich also die Auskunft von Mike Harrick grundfalsch war, würde auch ich heute möglicherweise einen lästigen Wissensdurstigen mit einer derartigen Auskunft abspeisen, denn in der Praxis ist das alles gar nicht so wichtig. Die Missweisung beträgt im Mittelmeer ein paar Grad. Eine Yacht von der Größe der KALINA lässt sich im Seegang höchstens auf zehn Grad genau steuern, so dass es gleichgültig und viel bequemer ist, sich um die Missweisung keine großen Gedanken zu machen. Heute würde ich diese Erfahrung als Weisheit des Alters bezeichnen, aber davon waren wir Chartergäste damals noch weit entfernt.
Eine kleine Enttäuschung bereitete mir Mike, als ich den Sextanten sehen wollte, jenes Wunderding, mit dem der Seemann – das wusste ich aus vielen Büchern – auch ohne Landsicht mit Hilfe der Gestirne auf wundersame Art und Weise seinen Weg zu einem hinter dem Horizont liegenden Ziel findet. Mike Harrick besänftigte mich: Im Mittelmeer sei ein Sextant nicht erforderlich. Basta.
Das waren ganz neue Dinge für mich. Ich spürte, dass unser Captain die Navigation, für mich der Inbegriff der Seemannskunst, etwas leicht nahm. Mitsegler Bill, der schon einmal mit Mike Harrick unterwegs gewesen war, lobte aber unseren Skipper in den höchsten Tönen und meinte, dass Mike Harrick an der ganzen Küste berühmt sei. Wie ich später erfuhr, resultierte seine Popularität allerdings nicht aus irgendwelchen seemännischen Glanztaten, sondern mehr aus seinen Kochkünsten und anderen Dingen, über die noch zu berichten sein wird.
Am nächsten Morgen verkündete Roger, dass heute tatsächlich ausgelaufen werde, zwar nicht nach Mallorca, sondern nach San Remo, wo noch einiges einzukaufen sei. Obgleich San Remo in entgegengesetzter Richtung von Mallorca liegt, war die gesamte Schiffsbesatzung ganz happy, dass es endlich losging. Zuvor wurde der große Kohleofen im Salon ausgebaut, der in diesen Märztagen abends immer so viel Gemütlichkeit verbreitet hatte, und über Deck zur Gangway gerollt. Unser mitsegelnder Lord, der uns offensichtlich mochte, uns gleichzeitig wegen unseres wortarmen Englisch zutiefst bedauerte, erklärte uns: „It was winter, now it is summer!“
Was dann folgte, war zu erwarten. Damals aber überraschte es mich. Statt den Anker schnell mal raufzuholen, stellte man fest, dass er sich den Winter über mit den unendlich vielen Ketten und Trossen anderer Anker einen Kleinkrieg geliefert hatte und hoffnungslos festhing. Roger musste also mit seinen rostigen Tauchflaschen in die ölige Brühe steigen. Zwei Stunden später klickerte die Kette endlich in den Kettenkasten. Unter dem leisen Tuckern der Maschine näherten wir uns der Hafenausfahrt. Aus dem grünbraunen, öligen Hafendreck wurde allmählich klares Wasser, bis wir uns auf dem tiefen Blau der Riviera vor der Hafeneinfahrt wiederfanden. Das Meer war spiegelglatt, der Himmel dunstig, wie es in den Frühlingstagen, wo auch am Mittelmeer die Sonne noch kraftlos scheint, eben üblich ist. Ich musste an Strolchi, meinen Touristensegler vom Wörthersee, denken: „Das Segeln auf dem Meer ist das Größte.“
Genau das war in diesem Moment auch mein Gefühl. Es störte uns wenig, dass wir gar nicht segelten, ja, dass nicht einmal die Persenning von den Segeln entfernt worden war. Nur die Maschine schob uns durch das glatte Wasser. Und von wegen „hohe See“ und so! Wir schlichen in ein paar hundert Meter Abstand an der Küste entlang. Wenn man zum Bugspriet ging, sich in das darunterliegende Netz legte, in das beim Segelbergen der Klüver fallen soll, dann war die Maschine so weit weg, dass man nicht einmal ihr Tuckern hörte, sondern nur ein leises Rauschen, das durch das langsame Heben und Senken des Buges der KALINA entstand. Captain Harrick beantwortete wieder einmal naive Fragen über die Seefahrt. Er erzählte, dass er um ein Haar einen Charterauftrag zu den Westindischen Inseln bekommen hätte.
Mein Gott, wir waren auf einem Schiff, das notfalls auch nach Westindien segeln konnte! Damals wusste ich nicht genau, wo Westindien liegt. Ich vermutete es irgendwo in der Nähe von Indien.
Aber das machte nichts, denn es klang auf jeden Fall nach ganz weit weg. In Geographie war ich ohnehin immer sehr schlecht gewesen und von der Seefahrt hatte ich naturgemäß überhaupt keine Ahnung. Nur einen einzigen Begriff kannte ich und der war „Kap Hoorn“.
Damals war die Zeit, in der sich ein Engländer namens Francis Chichester gerade auf dem Weg nach Kap Hoorn befand. Die Weltöffentlichkeit begann sich für diesen Mann zu interessieren, der sich anschickte, mit einem vergleichsweise kleinen Schiff von 13 Metern Länge auf den Routen der alten Segelschiffe die Welt zu umsegeln.
Für mich war allerdings Mike Harrick und nicht Francis Chichester der Inbegriff und so fragte ich ihn, ob er schon einmal um Kap Hoorn gesegelt sei. Kap Hoorn, jener Felsen an der Südspitze von Südamerika, galt als Seemannsschrecken, so dass ich, wenn ich schon keine positive Antwort bekam, zumindest erwartete, dass Mike Harrick seiner Zufriedenheit Ausdruck geben würde, dass er dort noch nicht gewesen sei. Aber Mike Harrick zögerte einen Moment und sagte dann unerwartet: „Leider war ich noch nicht am Kap Hoorn.“ Das Bedauern war echt, wie ich später erfuhr.
Die ersten Seemeilen
Schnell verging die wenige Meilen lange Fahrt nach San Remo. Wir waren noch zu aufgeregt und voller Scheu, als dass wir zu fragen gewagt hätten, ob wir nicht auch einmal ans Ruder dürften. Und weder Mike Harrick noch sein Bootsmann forderten uns dazu auf. Heute weiß ich natürlich, dass sie damit eine Falle stellten, in die jeder unerfahrene Chartergast auf der ganzen Welt blindlings hineintappt. Denn über kurz oder lang wird er einmal seine Neugierde nicht mehr bezähmen können und darum bitten, ans Ruder zu dürfen. Meistens wird er diese schwache Minute noch verfluchen, denn von da ab muss er Stunde um Stunde die Suppe auslöffeln, die er sich selbst eingebrockt hat. Rudergehen ist eine stupide und nervtötende Sache. Jeder Skipper ist heilfroh, wenn er einen Dummen findet, der ihm diese notwendige Arbeit abnimmt. Nur eben: Das weiß der dumme Chartergast zu Beginn nicht.
Die noch dümmeren Chartergäste – ich war damals auch so einer – bitten den Skipper, um ja das Leben auf See voll auszukosten, darum, sie nicht als „Gast“ zu betrachten, sondern als ganz gewöhnliches Mitglied der Mannschaft. Auch diese Bitte kennt ein erfahrener Charterskipper längst, denn fast alle seine Gäste haben diese originelle Idee. Scheinbar zögernd wird der Skipper, so auch Fuchs Harrick, den Novizen dann in die Wache einteilen und dieser wundert sich dann, wenn er sich, während alle anderen den Schlaf des Gerechten schlafen, nachts allein an Deck, frierend, am Ruder wiederfindet.
Alle tappten in die Falle des Mike Harrick und so geschah es von da an, dass sich Mike Harrick jeden Abend vergnüglich verabschiedete, seine Gäste die Nacht über am Ruder ließ und morgens schön ausgeschlafen wieder nach dem Rechten sah. Rückblickend muss ich die Nerven von Mike bewundern, nicht nur Segelanfänger, sondern totale Ignoranten ohne den geringsten Schimmer von Lichterführung und Verkehrsvorschriften eine 20-Meter-Yacht durch die Nacht steuern zu lassen. Aber offenbar wimmelt es auch auf dem Meer von Schutzengeln. Bald lernten wir die echten Vorzüge von Mike Harrick kennen. Neben der Tatsache, dass er stets unerschütterliche Ruhe ausstrahlte – die brauchte er auch im Verlauf des weiteren Törns – war er tatsächlich ein Meister der Küche. Schon vom Aussehen her hätte der Mittags- und Abendtisch, den Mike Harrick im Salon angerichtet hatte, in jedes bessere französische Restaurant gepasst, wenn er sich nur nicht bewegt hätte.
Er war nämlich kardanisch aufgehängt. Versehen mit schweren Bleigewichten und in der Längsachse gelagert, blieb der Tisch bei leichtem Schaukeln immer waagerecht, gleichgültig, nach welcher Seite die KALINA sich im Seegang legte. Leider ließ unsere Begeisterung für das Essen an diesem Schlingertisch schon nach ein paar Minuten schlagartig nach, wenn wir nämlich jenes flaue Gefühl im Magen verspürten, das recht schnell den Appetit auf grüne Salatblätter in Mayonnaise oder feinste französische Salami mit Paprikaschoten vergehen lässt. Jeder grabschte sich schnell noch ein paar Brote und lud sie auf seinen Teller, bevor er zum Niedergang stürzte und die frische Luft einsog.
Von der Seekrankheit hatten wir schon viel gehört und waren entsprechend mit Tabletten ausgerüstet. Leider haben diese Tabletten recht unangenehme Nebenerscheinungen. Sie machen müde. Und die Müdigkeit wird durch die Schiffsbewegungen noch verstärkt. Zudem verursachen sie bei den meisten Menschen eine depressive Grundstimmung. Trotzdem sind die Begleiterscheinungen viel leichter in Kauf zu nehmen als wirklich seekrank zu werden. Davor hatte ich schon immer eine panische Angst und habe sie bis heute. Noch immer nehme ich zumindest die ersten Tage Medikamente, wenn ich auf einen Törn gehe, obwohl ich mich noch nie in meinem Leben auf einem Schiff habe übergeben müssen.
Auf der KALINA erwischte es einige von uns bereits auf den ersten Seemeilen in Richtung Mallorca, als wir den Löwengolf überquerten. Der Golf von Lion ist eine der sturmreichsten Gegenden der Welt, mit einer Sturmhäufigkeit, die dreimal so hoch ist, wie die der berüchtigten Biskaya. Die sturmreichste Zeit ist neben dem Winter der Frühling, genau die Zeit, als wir uns im Löwengolf befanden. Aber das wussten wir damals nicht. Wir hatten grenzenloses Vertrauen zu „unserem alten Seebären“ Mike Harrick. Er hatte uns nichts davon erzählt, dass es etwas wilder werden könnte.
Rückblickend betrachtet, war es eine recht ruhige Überfahrt. Uns Landratten waren die zwei Meter hohen Wellen, die uns entgegenrollten, und die fünf bis sechs Windstärken schon wie ein kleiner Sturm erschienen. Die KALINA legte sich – diesmal unter Vollzeug – auf die Seite und bald zeigten sich die Nachteile eines Holzschiffes. Langsam sogen sich die Kojen voll mit Seewasser, das durch die Planken des arbeitenden Schiffes und natürlich durch das leckende Bullauge seinen Weg in die Bettwäsche gefunden hatte. Wir legten uns in die Leekojen, meistens auf den Bauch mit gegrätschten Beinen, was das Herumrollen etwas milderte.
So lauschten wir im Halbschlaf dem Gurgeln des Wassers und blinzelten in das grünliche Dämmerlicht, das durch die halb unter Wasser liegenden Bullaugen drang. In dieser misslichen Lage befielen uns zum ersten Mal Zweifel, ob denn unser Entschluss richtig gewesen war, eine Fahrt auf der maroden KALINA dem Luxus eines guten Hotels mit Swimmingpool und Campari Soda vorzuziehen.
Die Nachtwachen waren alles andere als gemütlich. Einerseits verstärkte sich das Übelsein sofort, wenn man die Koje verließ, andererseits konnte man ohne Ölzeug das Deck nicht mehr betreten, weil pausenlos vom Bug her Gischt über das ganze Schiff flog, wenn die KALINA donnernd gegen die See einstampfte. So quälte man sich in dicken Pullovern in das enge Ölzeug, ungeduldig, weil man genau wusste, dass der Magen höchstens noch Sekunden unter Deck mitmachen und sich erst in der frischen Luft an Deck wieder beruhigen würde. Wenn man sich dann hinter das Rad klemmte und die Augen an der Kompassnadel festen Halt fanden, kehrte die innere Ruhe wieder ein. Ich begann, das Segeln langsam wieder zu genießen.
Wie auf der Bühne beleuchtete in der dunklen Nacht das Kompasslicht das Ölzeuggelb des Steuermanns und des Mannschaftskameraden, der neben dem Rudergänger stand und auf seine Ablösung wartete. Der eiskalte Maestrale brachte die Wangen unter dem Südwester zum Glühen und die Segel hoben sich deutlich gegen das tiefe Dunkel des nächtlichen Firmaments ab, weil sie von der Gischt angestrahlt wurden, die die KALINA in Form eines weißen Teppichs am Heck zurückließ. Strolchi fiel mir ein: „Das Segeln auf dem Meer ist das Größte.“
Dank meiner Tabletten hatte ich auch die Seekrankheit gut im Griff. Ich fühlte mich wieder ganz in Ordnung. Lord Guilsborough, der mit mir die Wache von Mitternacht bis vier Uhr morgens teilte, gehörte zu den Helden, die nur mit Verachtung auf jene Mitmenschen herabsehen, die nicht einmal stark genug sind, ohne Tabletten gegen die Seekrankheit anzugehen. Ich bin froh über seine Einstellung, denn sie hat mir einen noch tieferen Einblick in englisches Benehmen gewährt als beispielsweise der reizende Film „Adel verpflichtet“ mit Alec Guinness.
Trotz des schwachen Kompasslichtes hatte ich schon längere Zeit beobachtet, wie sich das Gesicht des Lord Guilsborough unter seiner goldbetressten Seeoffiziersmütze (Südwester war nicht exklusiv genug) verfärbte. Wortlos ging er zum Heck der KALINA, kniete sich auf seine orangeroten Hosen, nahm, wie in der Kirche, die Schirmmütze ab und beugte sich über Bord.
Ganz offensichtlich kotzte der Lord. Ich habe das in meinem Leben schon oft als Zeuge miterlebt. Bei gewöhnlichen Menschen ist dies von einem lauten Stöhnen oder von einem todesschreiähnlichen Gebrüll begleitet. Seine Lordschaft übergab sich jedoch total lautlos, was mich verblüffte. Er setzte sich seine Mütze wieder auf, erhob sich und stakte geraden Schrittes wieder zum Ruderstand, wo er sich neben mich hinstellte, als sei nichts geschehen. Seine rechte Hand steckte er wieder zwischen die Knöpfe seines Ölzeugs und meinte: „Ich habe gerade nach dem Kielwasser gesehen, die KALINA macht gute Fahrt.“
In der Tat, wir liefen mit sieben Knoten in Richtung Mallorca. Ich kam mit der Seemannsprache schon ganz gut zurecht. Man hatte mir erklärt, dass ein Knoten eine Meile pro Stunde sei, also 1,85 Kilometer. Sieben Knoten waren also etwa 13 Stundenkilometer. Man braucht die Meilen (Knoten) nur zu verdoppeln und etwas abzuziehen, dann kommt man ziemlich genau auf die Stundenkilometer. Die Bezeichnung Knoten kommt daher, dass die Seeleute früher ein Stück Holz mit einer Leine daran über Bord warfen, in die in einem festgelegten Abstand Knoten geknüpft waren. Die Anzahl der Knoten, die in einer bestimmten Zeitspanne von einer Rolle abliefen, ergab dann die Schiffsgeschwindigkeit.
Auf der KALINA benutzte man, wie auf vielen tausend anderen Yachten und auf den alten Rahseglern, den Walker Knotmaster, ein primitives englisches Gerät, das nichts anderes als eine Art Wasseruhr ist, an der eine Leine mit einem Propeller befestigt ist. Der wiederum wird im Fahrtstrom über das Heck nachgeschleppt. Je schneller die Fahrt, desto mehr Umdrehungen im Propeller und damit werden an der „Wasseruhr“ desto mehr zurückgelegte Meilen angezeigt. Die Geschwindigkeit selbst kann man nicht ablesen. Aber man kann die Umdrehungen des Propellers im Wasser an einer Schwungscheibe des Anzeigegerätes mitzählen und so mit Hilfe einer Tabelle direkt in Geschwindigkeit umrechnen. Dies wurde während der langen und in der Erinnerung so schönen Stunden auf der KALINA zu unserer Hauptbeschäftigung.
Der frische Wind, der über den Löwengolf pfiff, gab uns die nötige Geschwindigkeit, um nach zwei Tagen vor Mallorca zu sein. Das heißt, wir befanden uns nicht nur vor Mallorca, sondern wir befanden uns ziemlich genau vor der Hauptstadt von Mallorca, vor Palma, wo wir hinwollten. Wir bewunderten unseren Captain Harrick maßlos, weil er es ohne Sextant und nach ein paar Tagen ohne Landsicht geschafft hatte, uns dort hinzubringen, wo wir hin wollten. Dass es eigentlich die selbstverständlichste Sache der Welt war, übersahen wir in unserem Enthusiasmus.
Mike Harrick wurde für uns zum Inbegriff des kühnen Seefahrers, der nicht nur das rechte Feeling (wie seine Lordschaft meinten) für die Navigation hatte, sondern sich auch moderner technischer Möglichkeiten bediente. So hatte er mir auch die erste Funkpeilung, die ich erlebte, demonstriert. Für die Nachrichten befand sich im Salon ein Kofferradio, auf dem eine Scheibe – offensichtlich von Amateurhand – montiert war, die in 360 Grade unterteilt war. Als Mallorca noch im Dunst lag, erschien mit gewichtiger Miene Mike an Deck, stellte den „Funkpeiler“ auf das Deckshaus, klemmte einen Draht mit einer Krokodilsklemme an ein Want, legte ein Ohr an den Lautsprecher und drehte die Scheibe so lange, bis die Morsezeichen vom Funkfeuer Palma am lautesten eingestellt waren. Mit zufriedenem Gesicht deutete er zum Bug der KALINA und meinte: „Dort ist Palma.“ Sprach’s, nahm seinen „Funkpeiler“ unter den Arm und verschwand unter Deck.
Zwei Tage waren für Palma de Mallorca geplant, aber es sollte ganz anders kommen. Nach einem fürstlichen Abendessen (Mike Harrick kaufte persönlich auf dem Markt ein) holten wir gegen elf Uhr nachts den Anker auf, um nach Ibiza zu segeln, wo wir dann am frühen Morgen anlegen wollten. Mike, der uns gönnerhaft an seiner Erfahrung teilhaben ließ, hatte uns zuvor erklärt, wie spannend es sei, nachts auszulaufen und in das Dunkel der offenen See hineinzusegeln. Aber unter „Spannung“ hatte Mike sicher etwas ganz anderes gemeint als das, was wenige Minuten später geschah.
Der Anker war bereits an Deck und Mike Harrick schob langsam den Gashebel in Richtung volle Fahrt voraus. Gleichzeitig suchte er mit den Augen im Dunkeln nach der Hafenausfahrt, wobei er mit der Hand das blendende Kompasslicht abschirmte. Roger stand vorne am Bug und versuchte Mike den Weg durch das Lichtermeer zu zeigen.
Wir anderen Mitsegler standen neben Harrick und freuten uns auf das erste Auslaufen bei Nacht. Ich glaubte, rechts voraus ein anderes Schiff zu erkennen, jedenfalls leuchtete dort ein grünes Licht. Soweit war ich schon, dass ich wusste, dass ein grünes Licht auf der rechten Seite und ein rotes Licht auf der linken Seite keine Gefahr bedeuteten. Harrick am Ruder bestätigte meine Meinung, denn er blickte schon wieder geradeaus in Fahrtrichtung. Plötzlich veränderte sich das Licht des anderen Schiffes in ein Rot und Grün, was mir zwar auffiel, ohne jedoch eine Signalwirkung auszulösen, wie es heute der Fall sein würde. Vom anderen Schiff her erschollen plötzlich Rufe: „Uno, uno, uno!“ Und wie eine Antwort kam es aus Rogers Mund vom Bug her: „Captain, you are on collision course!“ (Kapitän, du bist auf Kollisionskurs!).
Jetzt war der andere schon so nah, dass man ihn gut erkennen konnte. Es war ein Fischerboot, doppelt so groß wie die KALINA und sein spitzer Bug wies genau auf uns. Ich lernte Neues: Im Straßenverkehr passiert ein Unfall blitzschnell, es bleibt meist keine Zeit, um richtig zu reagieren. Vor einem Schiffsunfall geht alles sehr langsam, man hat genügend Zeit zur Reaktion. Und trotzdem kommt sie meist zu spät, weil das Schiff zu träge ist.
So war es auch hier. Blitzschnell warf Captain Harrick das Ruderrad nach Steuerbord, um den scharfen Bug des Schiffes nicht in seine Seite krachen zu lassen, sondern möglichst „nur“ einen Frontalzusammenstoß herbeizuführen, was bei zwei Schiffen glimpflich abgehen kann, wenn die beiden Buge aneinander vorbeischrammen. Wie gebannt – so langsam ging das alles – blickten alle nach steuerbord, wo sich der dunkle stählerne Spriet des Gegners langsam, aber bedrohlich näherte.
Carla ging sogar auf die Steuerbordseite, um alles genau mitzubekommen. Ich riss sie zurück und dann war der Bug schon über uns. Ich konnte genau beobachten, wie er auf den Besanmast zu fuhr, ihn glücklicherweise um 20 Zentimeter verfehlte und anschließend Achterstag und Besanwanten wegrasierte. Der Bug des Fischers rammte unser Heck, Holztrümmer flogen durch die Luft und ein ohrenbetäubendes Krachen übertönte das Geschrei vom Fischkutter. Dann war der Spuk schon vorbei und der Fischer verschwand im Dunkel der Nacht.
Das von der Kompasslampe geisterhaft erleuchtete Chaos auf dem Achterschiff allerdings erinnerte deutlich daran, dass wir nahe an einer Katastrophe vorbei gekommen waren. Mike Harrick lag unter Holztrümmern am Boden, rappelte sich jedoch gleich wieder hoch. Als er sich verlegen grinsend das Blut von der Stirn wischte, bekam ich so richtig seeräuberromantische Gefühle und glaubte mich auf ein Schiff Seiner Majestät unter Admiral Hornblower versetzt. Ein fürchterlicher Fluch Harricks, in dem er den anderen Skipper der Trunkenheit bezichtigte, rief mich in die Gegenwart zurück.
Glücklicherweise war bei diesem Zusammenstoß niemand verletzt worden und auch Harricks blutende Schramme erwies sich als harmlos. Während die KALINA