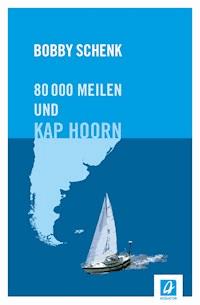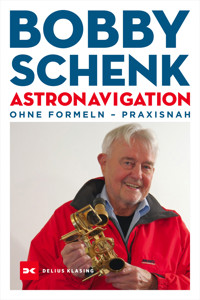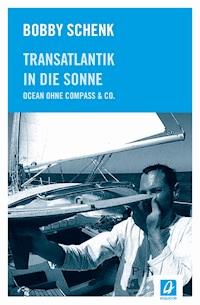
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aequator
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ist es möglich ohne Kompass, ohne GPS, ohne Seekarten, ohne Funk und ohne Uhr – kurz: ohne jegliche Navigationsinstrumente den Atlantik zu überqueren und auf der anderen Seite das angestrebte Ziel Barbados zu erreichen? Der Navigationsexperte Bobby Schenk geht mit Carla Schenk und einer sechsköpfigen Crew das Risiko ein. Gelingt der Selbstversuch? Mit welchen Schwierigkeiten haben sie zu kämpfen? Woran orientieren sie sich? Und wie wirkt sich die Ungewissheit auf die Stimmung an Bord aus? Dass dieser Selbstversuch auf der SARITA, einer 16 Meter langen Charteryacht, gelungen ist, ist zu Recht in die Seglergeschichte eingegangen. Der Bericht über diese ungewöhnliche Reise ist nicht nur für Blauwassersegler spannend zu lesen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Angaben sind im Internet unter https://dnb.de abrufbar.
Aequator Verlag GmbH, München © 2016 Aequator Verlag
ISBN 978-3-95737-017-4
Inhalt
Vorwort
Blind im Stum
VOM PLAN ZUR WIRKLICHKEIT
Der Traum vom Passat
Der Mythos Columbus
Navigationsgeheimnisse der Polynesier
Sponsorensuche
Karibiksterne auf den Philippinen
Riesenkatamaran zwischen 7.000 Inseln
Segeln pur in Boracay
Die Schiffsposition steht in den Sternen
Schattenspiele
Anker über Kreuz in der Schwedenbucht
Gesucht: sechs Mitsegler mit Freude am Risiko
Der Schenk wird's schon richten
Zweifel und Drehbuchideen
Sieger und Verlierer
Brainstorming
So dreht sich die Sonne um die Erde
Versicherungsrisiko
Hochseevögel treffen ein
Ämterverteilung
Die „Notare"
Schlussbesprechung
IM SELBSTVERSUCH ÜBER DEN ATLANTIK
Proberunde
Start ins Blaue
Holznavigation
1. Tag auf hoher See: Wacheinteilung ohne Uhr
2. Tag auf hoher See: Der Sonnenkompass
3. Tag auf hoher See: Die Sternenuhr
4. Tag auf hoher See: Keine Geheimnisse am Himmel
5. Tag auf hoher See: Bierdosenlogge
6. Tag auf hoher See: Wo bleibt das Wasser?
7. Tag auf hoher See: Tanzendes Lot
8. Tag auf hoher See: Doppelgenuas machen Speed
9. Tag auf hoher See: Wachtorturen
10. Tag auf hoher See: Salmonellen verderben den Appetit
11. Tag auf hoher See: Eine Mittagshöhe – drei Winkel
12. Tag auf hoher See: Alle an Deck zum Sonnemessen
13. Tag auf hoher See: Regulus ist nicht zu peilen
14. Tag auf hoher See: Supermann tobt
15. Tag auf hoher See: Die Breite von Barbados ist getroffen
16. Tag auf hoher See: „Leichenrutsche" gegen
SARITA I
17. Tag auf hoher See:
SARITA
tanzt im gestörten Passat
18. Tag auf hoher See: Der Abendstern führt nach Barbados
Welcome in Barbados
LICHT UND SCHATTEN
Planter‘s Punch und Piña Colada
Holzbrett gegen Präzisionssextant
Ein Seglerschicksal
Navigationsgeheimnisse
Das Interview
TECHNISCHER ANHANG
SARITA-Törn in Zahlen
Navigation im Notfall
Ratschläge für den Skipper einer Charteryacht
Theo Rauscher: Tipps zur Vorbereitung auf einen Chartertörn
Carla Schenk: Proviant für den Atlantiktörn
Das Einfache ist manchmal ziemlich schwer.
Bertold Brecht
Vorwort
Dieses Buch ist jenen gewidmet, die diesen Törn ermöglicht haben, allen voran Kurt Ecker, dessen wunderschöne Yacht SARITA uns über den Atlantik gesegelt und Barbados gefunden hat, ohne dass ein Navigationsinstrument an Bord war, als wir lossegelten.
Den wichtigsten Teil zum Gelingen der Reise hat jedoch meine Mannschaft beigetragen, bestehend aus Bernhard, dem Arzt aus Wien, Theo, dem Kriminalbeamten aus Graz, Thomas, dem österreichischen Journalisten in Diensten der deutschen Bildzeitung, Ludwig, dem Fernsehregisseur, Michael, dem Kameramann, und Karl, dem Zimmermann, die letzten drei aus dem Oberbayerischen.
Vor allem aber hat großen Anteil an dieser Unternehmung meine Frau Carla, mit einer Weltumsegelung, mehreren Kap-Hoorn-Umrundungen und acht Jahren Bordpraxis auf allen Weltmeeren wohl die erfahrenste deutsche Seglerin.
Dies ist der Bericht des Skippers über eine ungewöhnliche Atlantiküberquerung, die, beim engen Zusammensein von acht Menschen auf kleinstem Raum in der Weite des Ozeans nicht verwunderlich, gelegentlich auch negative Seiten hatte.
Der Leser ist sicher an einem ehrlichen Bericht interessiert, deshalb kann dieser nicht geschrieben werden, ohne gelegentlich auch Kritik an der Mannschaft zu äußern. Meine Mitsegler hatten nicht die Gelegenheit, die Schattenseiten des Skippers aufzuzeigen. Oder sie waren zu vornehm dazu. Deshalb ist der Leser aufgefordert, sich seinen Teil zu denken!
Saint Lucia/Westindien Bobby Schenk
Blind im Sturm
Auf Tonband gesprochen:
Heute ist der 17. Dezember 1992. Letzte Nacht ist etwas passiert, das uns alle doch ziemlich erschüttert hat. Während wir bereits die ersten Wetten abschlossen, wann Barbados in Sicht kommen würde, wurde der Wind abends stärker und stärker; wir konnten die Maschine ausschalten, flogen unter Großsegel und gereffter Genua mit acht, teilweise auch neun Knoten nur so dahin und die Stimmung war bestens. Wir tranken unseren Sundowner wie jeden Abend und amüsierten uns über die Schauer um uns herum. Die feine Linie am Horizont war weiß gefärbt. Wir freuten uns, wenn der Regen besonders schräg ins Wasser fiel und es in der Feme blitzte, was gelegentlich die Nacht taghell erleuchtete. Wir hatten ja zurzeit abnehmenden Mond, das heißt, der Mond ging erst lange nach Mitternacht auf, sodass es also gleich nach der Dämmerung stockfinster wurde.
Ich war nicht wirklich überrascht, als es plötzlich anfing, hart zu blasen. Es war ungefähr zehn Uhr; wir hatten ja keine Uhr und Zeiten konnten somit nur geschätzt werden. Wir nahmen die Genua ganz weg und ließen vom Großsegel nur noch einen kleinen Rest stehen.
Plötzlich wurde es um uns herum richtig wild. Die See begann zu kochen. Selbst Theo, sonst die Ruhe in Person, bat mich, nach oben zu kommen.
Inzwischen prasselte der Regen aufs Deck, also suchte ich mir Ölzeug heraus. Ich hatte es aber noch nie zuvor benutzt und fand den Südwester nicht. So warf ich mir in der Eile nur die Jacke über und ging nach oben.
Um uns herum herrschte Chaos. Das Großsegel stand back. Es war eine enorm starke Windbö und mir wurde sofort klar: Das bereits gereffte Groß musste ganz weg.
Wir halsten. Der schwere Sturm machte eine Wende von vornherein unmöglich.
Ich schätzte die Bö auf Windstärke 10 bis 11. Sie trieb mir die Regentropfen mit solcher Gewalt ins Gesicht, dass sie wie Nadelstiche schmerzten. Am schlimmsten tat es in den Augen weh, selbst wenn sie zugekniffen waren. Jetzt hätte ich einen Tipp von befahrenen Seglern für solche Fälle ausprobieren können: Tauchermaske benutzen. Doch in dem Chaos und in der Hektik war gar nicht daran zu denken, auf der SARITA nach Tauchsachen zu suchen. Sofort war ich auch unter dem Ölzeug triefend nass. Ich zog die Jacke aus und versuchte, jetzt ohne Schutz gegen den Regen, das Schiff auf einem Kurs vor dem Wind zu halten.
Ich ließ mich nach wenigen Minuten am Ruder wieder ablösen. Obwohl die Situation in der Dunkelheit bedrohlich wirkte, nahm ich eine kurze Regendusche.
Vor wenigen Stunden noch waren wir durch tropische Temperaturen gesegelt. Jetzt war es empfindlich kalt geworden, bereits nach fünf Minuten fror ich.
Theo war wie immer der erste, als es zu handeln galt. Er stand bereits am Mast, um den Rest des Großsegels zu bergen. Ich ging langsam in den Wind. Die wenigen Quadratmeter Großsegel schlugen und knatterten ohrenbetäubend, bis Theo sie endlich weggerollt hatte.
Doch die Ruhe, die wir dadurch gewonnen hatten, war nur kurz. Wir waren jetzt in einer Situation, die es bisher auf der SARITA nicht gegeben hatte: Das Unwetter hatte uns die Orientierung geraubt. Wir wussten nicht mehr, wohin wir segeln sollten.
Erst nahmen wir an, dass der Wind immer noch aus derselben Richtung wehte. Deshalb fuhren wir unter Maschine und bestimmten den Kurs nach dem Wind. Aber schon bald kamen uns Zweifel. Wahrscheinlich war das ganz falsch.
Gefühlsmäßig ahnte ich die Richtung, die uns aus dem Chaos herausführen konnte. Ich schrie dem Rudergänger Kommandos zu: 20 Grad mehr Backbord. 10 Grad mehr Backbord. 20 Grad mehr Backbord. Michael am Ruder brummelte nur etwas zurück.
Wie sollte er auch solche Kommandos befolgen? Wie sollte er ohne Kompass in diesem Chaos 20 Grad nur geschätzt steuern, ganz zu schweigen davon, den Kurs halten?
Auch am Wellenbild konnte er sich nicht orientieren. Zwar war die Salinglampe an, doch sie beleuchtete die Wasseroberfläche nur wenige Meter weit: Sie war kochend und milchig weiß. Je mehr Kommandos ich schrie, umso deutlicher wurde, wie sinnlos sie waren. Wir konnten nur noch im Kreis fahren oder Schlangenlinien ins Wasser kielen.
Insofern allerdings war die Lage nicht so erschreckend, als der Sturm unserer Yacht ohne Segel am Mast vorerst nicht mehr viel anhaben konnte. Außerdem waren wir auf hoher See, weit weg vom nächsten Land, vom nächsten Riff.
Aber stimmte das wirklich?
Wir waren mitten im Passatgebiet in dieses Unwetter geraten. Das beunruhigte mich vor allem. Aufgrund meiner früheren Reiseplanungen war mir der Begriff der Passatstörung vertraut. Sie wird auch Konvergenzzone genannt und bringt zahlreiche heftige Schauer, ebenso Gewitter mit wechselnden Winden. An und für sich ist das nicht tragisch. Wenn da nicht eine besondere Gefahr dabei wäre.
Aus Wetterberichten ist bekannt, dass einem Orkan immer eine Konvergenzzone vorausgeht. Um diese Jahreszeit sind Wirbelstürme in dem Gebiet zwar selten, aber wenn einer auftritt, dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit auch tödlich.
Theo kommentierte trocken: „Dann können wir aufgeben.“
Normalerweise bringen mich solche Unwetter nicht besonders aus der Ruhe. In meinem Seglerleben habe ich schon Dutzende davon erlebt. Doch in dieser Nacht war ich extrem nervös. Zwar kannte meine Mannschaft die Gefahr nicht, mir aber war sie sehr bewusst.
Die „hurricane season“ in Westindien endet im Oktober. Doch auch zu Unzeiten sind schon Wirbelstürme aufgetreten. Sie haben immer verheerende Schäden hinterlassen. Üblicherweise geht man davon aus, dass ein „hurricane“ schön brav zwischen April und Oktober auftreten könnte und sonst Ruhe garantiert ist.
Ich schaute gelegentlich zu Theo. Selbstverständlich hatte er meine Gedanken erraten. Im Gegensatz zur übrigen Crew wusste er sehr wohl um die Gefahren des Wetters. Darüber brauchten wir gar nicht zu reden. Es war klar, wo hier das Problem lag: Wir befürchteten noch weitere Schwierigkeiten. Als eine Art Passatbesegelung fuhren wir zwei Rollgenuas an einem Stag. Das sind zwei riesige Vorsegel an einer Vorstagstange, die üblicherweise nur für ein einziges Segel gedacht ist. Es wird in Ruhestellung einfach aufgerollt und bietet so keinen besonderen Widerstand.
Bei uns aber waren gleich zwei riesige Segel eingerollt. Wenn sich der Wind darin verfing und wenn bei dem Sturm wegen des viel größeren Windwiderstandes die dünne Reffleine brach, würden sich beide Genuas am Vorstag ausrollen. Wir hatten dann zwei riesige Segel auswehen, die im Sturm nie mehr zu bändigen wären. Theo sagte: „Wenn das passiert, ist es das Ende.“
Es hätte keine Möglichkeit gegeben, die Segel runterzubekommen. Zwar waren zwei Parten Genuaschoten um die eingerollten Vorsegel gelegt, dennoch befürchtete ich ein derartiges Unglück. Es musste ja nicht einmal die Reffleine brechen. Auch eines der Segel hätte einreißen und sich auflösen können. Dann hätte der Wind genügend Ansatzpunkte gehabt, um mit seiner enormen Kraft schlimmes Unheil anzurichten.
Allmählich wurde die Stimmung an Bord ziemlich hysterisch. Wir waren vom Wachwechsel zwar noch einige Stunden entfernt, dennoch meinte Ludwig: „Jetzt muss unbedingt auch die zweite Wache raus.“
In einer Art psychischen Schwächeanfalls stimmte ich zu. Ludwig ging nach vorne. Er weckte Bernhard und Michael, obwohl der eigentlich Koch für den Tag und damit wachfrei war. Statt sich weiter selbst an der Wache zu beteiligen, versuchte Ludwig jetzt allen Ernstes, den Gasofen in Gang zu bringen. Das war unmöglich. Zwei Stunden vorher war das Gas zu Ende gegangen. Eine neue Flasche wollten wir am nächsten Morgen anschließen.
„Ich brauche aber Gas“, forderte Ludwig. „Ich will eine Nadel aufheizen, bis sie magnetisch wird. So können wir einen Ersatzkompass bauen und ungefähr unsere Richtung herausfinden.“ Das war natürlich Quatsch. Ein solches Experiment funktioniert vielleicht zu Hause im Wohnzimmer, was weiß ich, jedenfalls auf einem ruhigen Platz. Es funktioniert aber sicher nicht in einer Notsituation, in der auf Deck ziemliche Unruhe herrscht. Ich war einfach sauer, weil Ludwig den Ernst der Situation kaum begriff und mit derartigen Experimenten herumspielte.
Noch vor wenigen Minuten hatte Karl getönt, dass er einen absolut dichten Kajakanzug anlegen würde. Damit könne er im schlimmsten Regenguss staubtrocken bleiben. Jetzt kam er bleich nach unten. Ihm war die Seekrankheit anzusehen.
Merkwürdig, dachte ich. Karl ist physisch der Stärkste der ganzen Mannschaft. Aber wenn es ernst wird, ist von ihm meistens nichts zu sehen.
Das lag sicher nicht am bösen Willen, sondern allein daran, dass der Kajakfahrer Karl hier eben nicht in seinem Element war. Er konnte mit derartigen Situationen innerlich nicht viel anfangen. Ich musste an ein zynisches Wort des sonst so fröhlichen Michael denken, der in Anspielung auf die mannigfaltige Zusammensetzung unserer Crew den Spruch erfunden hatte: „Der offene Ozean ist wie eine geschlossene Anstalt!“
Wir fighteten Stunde um Stunde, um irgendeinen Ausweg aus diesem riesigen Schauergebiet zu finden. Lag das Schiff mit blankem Mast da, torkelte es umher, dass uns angst und bange wurde. Dann setzten wir den Motor ein, um die SARITA in Fahrt zu halten. Wir versuchten es auch mit Beidrehen. Wir zogen einen kleinen Teil des Großsegels heraus und legten das Ruder hart in den Wind. Das hatte zwar die Folge, dass die Yacht keine Fahrt voraus mehr machte, dafür aber wurde sie gelegentlich von der anrollenden See hochgehoben und mit dem Heck aufs Wasser geschmettert. Es krachte jedes Mal, als würde der Rumpf auseinanderreißen und wir bekamen ernsthafte Angst um das Ruder.
Schließlich hielten wir die SARITA mit vielleicht 1.000 Umdrehungen in Schleichfahrt. Das war noch die beste Variante. Welchen Kurs wir laufen sollten, wussten wir nicht mehr.
Vom Plan zur Wirklichkeit
Der Traum vom Passat
Rückblickend erstaunt es, dass die Idee zu diesem Transatlantiktörn, der so sicherlich noch nie unternommen wurde, in derart kurzer Zeit realisiert werden konnte. Anders als bei unseren bisherigen Reisen war nämlich plötzlich der Plan präsent. Als meine Frau Carla und ich vor gut 20 Jahren um die Welt gesegelt waren, da hatte es keinen bestimmten Zeitpunkt gegeben, den ich nennen könnte, an dem uns die Idee zur Weltumsegelung kam. Es war ein ganz allmählicher Prozess. Wir hatten uns ein zehn Meter langes Kunststoffschiff gekauft, segelten auf dem Chiemsee im Oberbayerischen und waren irgendwann dabei, Bäume für Passatsegel zu bestellen. Nun lässt es sich mit Doppelfocks auf dem Chiemsee nur sehr schwer segeln. Mit dem Setzen der Passatsegel vergeht allein schon eine halbe Stunde, also unter Umständen so viel Zeit, dass die Yacht bereits das andere Ufer des für einen Binnenländer riesigen, für einen Hochseesegler jedoch sehr kleinen Sees erreicht hat. Außerdem lässt es sich mit Doppelfocks nur platt vorm Wind segeln und die oberbayerischen Seen sind dafür bekannt, dass der Wind in seiner Richtung unstet ist. Wenn uns damals jemand gefragt hätte, ob wir um die Welt segeln wollten, dann hätten wir leicht erschrocken abgewinkt. Und trotzdem waren die Passatsegel für eine Weltumsegelung bestimmt. Aber es gab kein Datum, keinen Zeitpunkt, an dem die Entscheidung fiel. Wir sind halt so hineingeschlittert.
Auch nach unserer Weltumsegelung, von der wir 1974 zurückkehrten, machten wir nicht gleich Pläne für die nächste Unternehmung. Unsere gute alte THALASSA, die uns trotz ihrer Kleinheit – nur zehn Meter Länge über alles – so sicher um die Welt getragen hatte, wurde zum Chiemsee zurückgebracht, dort noch ein wenig gesegelt und dann verkauft. Nach ein oder zwei Jahren fingen wir an, wieder Prospekte von Yachten zu sammeln und unsere Urlaubsreisen spielten sich immer verdächtig nahe an irgendwelchen Werften ab. Und irgendwann hörte ich mich am Telefon sagen: „Also gut, wir kaufen das Schiff, die erste Rate werde ich morgen überweisen!“ Wofür benötigten wir die Yacht? Mit ihren 48 Fuß Länge war die THALASSA II zu groß, um jemals auf einem der bayerischen Seen gesegelt zu werden. Nein, das war eine Segelyacht, die von vornherein für große Fahrt bestimmt war. Aber auch mit der für zwei Segler doch sehr großzügig bemessenen Yacht, die alsbald in einem kleinen Hafen in Friesland lag, gab es noch keinen Plan, um die Welt zu segeln oder auch nur ein bestimmtes Ziel anzulaufen. Und genau mit dieser Planlosigkeit segelten wir beide 1979 wieder los, natürlich Richtung Westen, Richtung Tropen, Richtung Südsee. Rund vier Jahre lebten wir in der Südsee, auch auf der nach Meinung vieler weitgereister Menschen schönsten Insel der Welt, nämlich Moorea, der kleinen Schwester von Tahiti. 1983 brachte uns die gute THALASSA II auf dem rauen Weg durch die brüllenden Vierziger und um Kap Hoorn nach Europa zurück.1 Da Carla und ich zu den Durchschnittsmenschen gehören, die Geld verdienen müssen, um leben zu können, kehrte ich in meinen alten Beruf zurück, das heißt, ich hatte das Glück, überhaupt noch genommen zu werden. Mein Arbeitgeber hatte sich insofern immer wieder großzügig gezeigt, als er mich weder beurlaubt noch gar pensioniert, sondern mich nach meinen Eskapaden (wie er es nannte) immer wieder in seine Dienste aufgenommen hat. Dieses Mal allerdings musste ich mir ausdrücklich sagen lassen, dass ein nochmaliges Aussteigen aus meinem Beruf künftig nicht mehr in Frage käme. Also musste ich wieder einer geregelten Arbeit nachgehen, die ganz im Gegensatz zum Leben eines Seevagabunden stand.
Nachdem ich aber schon viele hundert Tage das Glück gehabt habe, mir von der Sonne den Weg zu den schönsten Inseln der Welt zeigen zu lassen, wird es gelegentlich unerträglich, mit der Natur nur noch dann zu tun zu haben, wenn ich die Fenster auf dem Dach des Hauses schließen muss, damit es nicht hereinregnet. Denn Bergsteigen am Wochenende ist nicht meine Sache, weil einfach zu beschwerlich. Und unter Natur verstehe ich auch nicht ihre vielgepriesene Schönheit bei langweiligen Spaziergängen. So verbringe ich notgedrungen die meiste Freizeit vor dem Fernseher. Das ist zwar ganz im Sinne derjenigen, die vom Konsum profitieren, aber gleichzeitig auch ein Leben in armseliger Isolation von der Natur, trotz Auto und Eigenheim. Wirklich leben heißt: Der Natur nahe sein; ihre Kraft ahnen; wissen, dass Naturgewalt menschliches Leben erst ermöglicht – oder auch vernichtet. Kurzum, das ist es, was mich nach ein paar Jahren Büroaufenthalt immer wieder beunruhigt. Den Drang, etwas zu unternehmen, spüre ich ständig. Ich will herausfinden, wo die Grenzen des Menschen liegen.
So sind Carla und ich vor wenigen Jahren auf die Idee gekommen, in den wohl stürmischsten Gegenden der Welt zu segeln, in den Gewässern um die Staateninsel. Der Weg dorthin ist leicht zu beschreiben: Man segelt von Westen kommend durch die berüchtigten Vierziger, dann zum 57. südlichen Breitengrad hinunter an die Eisberggrenze und biegt nach Kap Hoorn links ab. Eine Tagesreise weiter sollte man schon in die Le-Maire-Straße einlaufen, die östlich von der Staateninsel begrenzt wird.
Wir aber dachten uns einen besonders abenteuerlichen Weg dorthin aus: Fliegen! Nein, nicht mit einer Linienmaschine, das wäre zu langweilig gewesen, sondern selber mit einem Kleinflugzeug. Auch diese Idee, bei der alle Piloten, die wirklich etwas von der Materie verstanden, die Hände über dem Kopf zusammenschlugen, war keine plötzliche Eingebung; vielmehr wuchs sie langsam und unmerklich, bis sie plötzlich da war. Weil Carla und ich ein kleines Flugzeug besaßen, lag es nahe, gedanklich immer wieder die Leistungsgrenzen dieser Maschine hinauszuschieben. Ein Flug von Europa nach Südamerika war von ihrem Hersteller nicht vorgesehen, denn die Reichweite lag bei Ausnutzung aller Tankkapazitäten im besten Fall bei 2.000 Kilometer. Auf dem Weg nach Südamerika galt es aber, den Südatlantik zu überqueren, der an seiner engsten Stelle 3.000 Kilometer breit ist. Wenn ich nicht Segler wäre, hätte ich auch den Flug nicht gewagt. Ich wusste, dass genau an dieser Engstelle, zwischen den Kapverden und Brasilien, der Passat mit einer für Landratten unvorstellbaren Gleichmäßigkeit bläst. Warum sollte ich dieses Wissen nicht für mich ausnutzen und mich auf eben diesen Passatwind verlassen? Er würde mir die fehlende Tankkapazität ersetzen!
So war es dann auch. Wir flogen mit diesem Kleinflugzeug von Europa nach Südamerika, segelten dort ein zweites Mal ums Kap Hoorn und in den rauen Gewässern der Staateninsel. Die Rückreise erfolgte wiederum in unserem kleinen einmotorigen Flugzeug, aber diesmal über den gesamten amerikanischen Kontinent, von Feuerland bis weit nach Norden, nach Grönland, um von dort über Island die riesengroße Schleife über dem gesamten Atlantik zu schließen. Dieser weite Umweg nach Hause war keine Vergnügungsreise, sondern notwendig. Der entgegengesetzte Flug, von Brasilien zu den Kapverden, also von West nach Ost über den Atlantik, wäre für uns mit Sicherheit tödlich gewesen.
Denn der Passat lässt sich nicht umdrehen, er bläst immer aus einer (östlichen) Hauptrichtung. Nach Meinung vieler Experten war unsere Unternehmung trotzdem höchst riskant, denn immerhin setzten wir unser Leben auf einen Motor. Zwar hatten wir durch eine gewissenhafte Vorbereitung das Risiko vermindert, doch gegen ein Stückchen Dreck in der Treibstoffleitung oder gegen ein Ölleck des Motors gibt es keine Garantie. Ohne Risiko geht es nicht! Aber ist es nicht gerade das, was uns gelegentlich daran erinnert, dass wir Menschen nicht unfehlbar, sondern häufig dem Zufall ausgeliefert sind, dass jederzeit die Schicksalskurve böse nach unten zeigen kann? Vielleicht ist es so, dass wir nur in den Augenblicken, in denen wir mit der Gefahr konfrontiert werden, wirklich leben.
Bei unserem Transatlantiktörn in die Sonne war alles ganz anders gewesen. Da hatte es tatsächlich einen bestimmten Zeitpunkt gegeben, an dem Carla und ich – fast gleichzeitig – die Idee zu diesem Törn hatten. Diesmal hatten wir nicht viele Monate gedanklich herumgespielt. Wir hatten keine Ahnung, was auf uns zukommen würde. Nein, es war ein ganz gewöhnlicher Abend vor dem meist furchtbaren, aber unvermeidlichen Fernseher.
Es wurde ein Film über Columbus gezeigt, außerdem stob zur Untermalung eine schnittige Segelyacht unter strahlender Sonne, mit gleißenden Segeln über das blaue Wasser.
Carla meinte: „Mal wieder über den Atlantik gehen, Passatsegeln mit dem großen Löffel, das wäre schön!“
Auch mich hatten die Bilder beeindruckt. Weniger die Gemälde, die den Genueser Admiral beim Empfang durch den spanischen König zeigten, als die Gischt, die vom Bug der Segelyacht hochgepeitscht wurde.
Der Mensch hat die bemerkenswerte Eigenschaft, je nach Laune in der Erinnerung negative oder positive Eindrücke weg zu filtern. So ging es Carla und mir in diesem Moment. Wir dachten zurück an unsere Atlantiküberquerungen und erinnerten uns in diesem Moment nur an die schönen Bilder. Wir dachten beispielsweise nicht mehr daran, dass wir bei unserer ersten Atlantiküberquerung acht lange Tage in der Flaute gedümpelt waren. Mitten auf dem Atlantik hatte uns der Wind verlassen. An einer Stelle, wo nach der Statistik die Flautenhäufigkeit null Prozent betrug, war der Passatwind einfach schlafen gegangen.
An diese acht zermürbenden Tage dachten wir jetzt angesichts der anregenden Fernsehbilder nicht. Wir dachten auch nicht an den harten Sturm, den wir kurz nach unserem Auslaufen von den Kanarischen Inseln erlebt hatten. Damals, 1970, waren wir in Las Palmas auf Gran Canaria gestartet und hatten unseren Zeitplan so eingerichtet, dass wir noch bei Tageslicht die Südspitze von Gran Canaria rundeten, um dann unseren Bug Richtung Westen, also nach Amerika, zu richten. Dass wir nicht gleich den Passat finden würden, damit hatten wir gerechnet. Dass wir aber genau aus Westen einen starken Sturm auf die Nase bekamen, irritierte uns zuerst und ließ uns später erschrecken. Denn um einigermaßen die Generalrichtung Karibik halten zu können, hatten wir zunächst versucht aufzukreuzen, was uns aber angesichts der Windstärke und erschreckend hoher Wellen von der Natur sehr bald abgewöhnt wurde. Schnell waren wir in die Defensive geraten. Gegen die hohe Atlantikdünung konnten wir nicht aufkreuzen, wir konnten nur noch den Kurs laufen, bei dem wir nicht allzu sehr an Höhe verloren. Unsere Selbststeueranlage, eine Windfahnensteuerung, kannten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so gut, dass wir ihr unsere THALASSA hätten anvertrauen können. So saß also Carla in ihrem gelben Ölzeug Stunde um Stunde oben und führte einen verzweifelten Kampf gegen die heranrollende See und den stürmischen Wind.
Trotz meiner schwachen Magennerven quälte ich mich zum Navigationstisch und warf einen Blick in die Karte, auf der die Gruppe der Kanaren noch verzeichnet war. Ich erschrak. Denn wenn wir mit Kurs Süd nur noch einen halben Tag weitergelaufen wären, so wären wir sicherlich gestrandet, auf dem Weg nach Amerika ausgerechnet in Afrika. Die Sandbänke Westafrikas reichen nämlich viele Meilen in den Atlantik hinein.
Als wir mit der THALASSA II fast zehn Jahre später den Atlantik überquerten, waren wir zu acht. Carla, ich und sechs „paying guests“, wie wir sie nannten, um das hässliche Wort „Charter“ zu vermeiden. Wir hatten eine schnelle Überfahrt gemacht. Unsere THALASSA II von immerhin 22 Tonnen war eine behäbige Dame, doch wir hatten im Gegensatz zur ersten Atlantiküberquerung günstigen Wind. Besonders in der Mitte des Atlantiks blies er über viele Tage gleichbleibend mit 5 bis 6 Beauforts und dazu genau von achtern. Wir hatten unsere Passatsegel gesetzt, die Selbststeueranlage Aries hielt die THALASSA II wunderbar auf Kurs. Die einzige Aufgabe der Crew war, gelegentlich auf dem Kompass abzulesen, ob der Kurs noch einigermaßen stimmte und sich um das leibliche Wohl zu sorgen.
Das Segeln war so, wie man es sich im Passat nur wünschen konnte. Wir machten rasende Fahrt nach Westen und waren von der Segelei so gut wie gar nicht in Anspruch genommen. Das waren die Tage, an denen die THALASSA Etmale von 180 Meilen und mehr machte, darunter sogar eines von 196 Meilen. Es waren geschenkte Seemeilen, denn wir mussten dafür nicht arbeiten, sondern lagen auf dem angenehm temperierten, weil weiß gestrichenen Stahldeck auf dem Rücken und starrten zur Mastspitze empor, wo sich die beiden rot-weiß-gestreiften Passatsegel in einem einzigen Schäkel am Fockfall trafen. Obwohl der Bug an Backbord und Steuerbord beim Vorwärtsstürmen hohe Gischtwellen emporwarf, kam nie ein Spritzer Wasser an Deck, weil die See vom gutmütig einsetzenden Steven abgewiesen wurde. Viele Stunden verbrachten wir auf dem Vorschiff im Gespräch oder nur einfach damit, durch den Spalt der Passatsegel zum Himmel zu blicken.
Dies gehörte zu den schönsten Eindrücken vom Segeln, die ich jemals gehabt hatte und daran dachte ich, als Carla sagte: „Wieder einmal im Passat zu segeln, das wäre schön.“
Das war aber nur die Hälfte des Denkanstoßes zu unserem neuen Unternehmen. Die andere kam vom Stichwort „Columbus“.
Der Mythos Columbus
Es scheint heute Ausdruck intellektueller Denkweise zu sein, alles in Frage zu stellen, was über Jahrhunderte unangefochten seinen festen Platz in der Geschichte hatte. Christoph Columbus war als Entdecker Amerikas eine der ganz großen Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte, bis 500 Jahre nach seiner historischen Großtat gewisse Kreise meinten, diesem Mann der Geschichte eine Verantwortung zuschieben zu müssen, die er wohl nie gespürt und auch nie gehabt hat. Columbus hat uns schlicht ein Faktum hinterlassen, nämlich die Tatsache, dass er als erster Europäer seinen Fuß auf amerikanischen Boden setzte. Aber war er es wirklich?
Einiges an Columbus ist geheimnisvoll. Dies beginnt schon mit der Tatsache, dass er zwei verschiedene Logbücher von seiner Reise hinterließ. Freimütig räumte er ein, dass das eine Logbuch dazu diente, seine Mannschaft irrezuführen, um sie angesichts des ungewissen Ausgangs der geplanten „Entdeckung von Indien“ zu beruhigen und bei der Stange zu halten. Ist es aber nicht schon etwas dubios, wenn ein Admiral zu solchen psychologischen Tricks greifen muss?
Es gibt auch Gerüchte aus jener Zeit, nicht etwa erst aus der Neuzeit, dass Columbus im Besitz von Karten war, die das Zielgebiet einigermaßen genau beschrieben. In die Reihe der Geheimnisse um Columbus gehört auch die Tatsache, dass sein eigentlicher Landeplatz in der neuen Welt bis heute nicht bekannt ist. Rund ein Dutzend kleiner Inseln in den Bahamas streiten seit vielen Jahrzehnten um die Ehre, Ort der Entdeckung der neuen Welt gewesen zu sein. Columbus nannte seinen Landeplatz „San Salvador“, so dass sich dem Unkundigen die Gewissheit aufdrängt, dass die Entdeckung Amerikas eben auf dem Inselchen San Salvador stattgefunden hat, das auf dem 24. nördlichen Breitengrad liegt. Genau das hatten die Bewohner von Watling Island beabsichtigt. Denn bis in die 20er Jahre hieß das Inselchen, das sich heute San Salvador nennt, Watling Island. Sie hatten, wohl um den Landeplatz von Columbus festzuschreiben, kurzerhand ihre Insel in „San Salvador“ umbenannt.
1986 startete das große amerikanische Magazin „National Geographic“ eine Untersuchung mit dem Titel "Our search for the true Columbus landfall" („Unsere Suche nach dem wahren Landeplatz von Columbus“), wobei mein Bekannter Luis Marden den angeblich wahren Landeplatz von Columbus nach Samana Cay verlegte. Luis Marden war über den Atlantik gesegelt und hatte sich strikt an das Logbuch von Columbus, wohlweislich an das ungeschminkte, gehalten. Er verbesserte den Kurs von Columbus um Abtrift und Strömung und kam so zum Landfall auf Samana Cay.
Als Carla und ich 1989 in unserem einmotorigen Kleinflugzeug auf der Rückreise von Kap Hoorn den südamerikanischen Kontinent bereits passiert hatten und auf dem Flug von Martinique zu den Vereinigten Staaten waren, mussten wir unversehens wegen Treibstoffmangels auf der uns bis dahin unbekannten Insel Grand Turk, die zu den Bahamas gehört, landen. Unsere Überraschung war groß, als wir auch hier auf die Spuren von Columbus stießen, die uns der 80-jährige Mr. Sadler in Form von acht selbstverfassten Büchern über dessen angeblichen Landfall in Grand Turk unter die Nase hielt. Der Verdacht lag nahe, dass es sich bei Mr. Sadler um einen alten Spinner handelte, aber nach einer mehrstündigen Unterhaltung mit ihm konnte ich seine profunden Kenntnisse von nautischen Vorgängen und allem, was mit Christoph Columbus zusammenhing, nur bewundern. Seine Beweisführung war so überzeugend, dass es mich wundert, warum nicht allgemein Grand Turk als der wirkliche Landeplatz von Columbus anerkannt ist. Denn ein Detail in Columbus' Beschreibung der Insel „San Salvador“ kann nur Grand Turk aufweisen. Keiner der anderen angeblichen Landeplätze hat nämlich inmitten der Insel eine „große Lagune“ oder gar einen kleinen See. Genau diesen aber besitzt Grand Turk.
Kurzum, es wird wohl niemals mit letzter Sicherheit nachgewiesen werden, welche der Inseln als erste von Columbus angelaufen worden ist. Möglicherweise ist dem Genuesen damit etwas gelungen, was er seit jeher vorgehabt hat: einerseits als der große Entdecker gefeiert zu werden, andererseits aber seinen Nachahmern keine verwertbaren Spuren zu hinterlassen. Liest man nämlich seine Logbücher und die Aufzeichnungen seiner Zeitgenossen, dann fällt auf, dass sich das Denken und Handeln des Admirals nicht so sehr um die Entdeckung des Seewegs nach Indien drehte, sondern ganz banal um das, was damals als das wertvollste Gut der Welt angesehen wurde: um Gold.
Aber all das inspirierte mich noch nicht, ein neues nautisches Abenteuer zu suchen. Wir besitzen für die erste Reise von Columbus nach Amerika nicht viele unbestreitbare wissenschaftliche Fakten. Die Art und Weise, wie er letztlich navigierte, der Ort seines Landfalls und die Positionen der danach aufgesuchten Inseln liegen weitgehend im Dunkeln. Aber das wenige, das wirklich feststeht, verblüfft: die kurze Hinreisedauer von nur 36 Tagen am nördlichen Rand des Passatgebiets – und die ebenso zügige Rückreise nach Spanien im Gebiet der westlichen Winde.
Würde ein Yachtsegler heute eine solche Rundreise in die Bahamas planen und zu diesem Zweck das gesamte Yachtschrifttum und die modernen Segelanweisungen, die gleichermaßen für die Berufsschifffahrt gelten, durchforsten, so ist es leicht vorstellbar, dass seine Reise zeitlich und von der Route her in gleicher Weise verläuft.
Um es deutlich zu sagen: Es kommt der Verdacht auf, dass Columbus schon damals auf ähnliche Erkenntnisse zurückgreifen konnte. Dies aber würde bedeuten, dass er nicht der erste Mensch war, der eine solche Fahrt unternahm. Hierbei denke ich nicht an Nordeuropäer, etwa an die Wikinger, die auf der nördlichen Atlantikroute möglicherweise schon um das Jahr 1.000 nach Amerika gekommen waren, sondern an Seefahrer aus den sonnigeren Breiten, also aus dem Mittelmeerraum oder von den afrikanischen Gestaden, eben irgendwo aus den Breiten des Äquators bis hinauf nach 40 Grad Nord. Gleichzeitig würde dies aber auch heißen, dass damals Menschen unterwegs waren, die nicht einmal über die technischen Navigationsmöglichkeiten von Columbus verfügten. Columbus hatte ja auf seiner Fahrt im Jahr 1492 einen Kompass, eine Logge und ein Astrolabium oder einen Quadranten, jedenfalls ein Winkelmessinstrument. Davon würde als einziges sein Kompass auch heutigen Ansprüchen genügen. Möglicherweise war die Kompassrose nicht so schön gedämpft wie bei den modernen Geräten, möglicherweise wusste er auch mit dem Begriff Missweisung bei Reisebeginn nicht sehr viel anzufangen. Doch immerhin, Kurshalten war ihm möglich.
Die Missweisung resultiert aus der Tatsache, dass geographischer und magnetischer Nordpol, wie wir alle wissen, Kompassnadel bzw. Kompassrose immer parallel zur jeweiligen magnetischen Kraftlinie auf der Erdoberfläche ausrichten. Im damaligen Europa, besonders im Mittelmeergebiet, wird das den Navigatoren nicht besonders aufgefallen sein, denn dort bewegte sich die Missweisung schon immer um null Grad herum. Die Kompassnadel zeigte also ungefähr (für praktische Zwecke ausreichend genau) auf den geographischen Nordpol. Anders in der Mitte des Atlantiks: Dort erreicht die Missweisung schon mal Werte um 20 Grad, also einen auffälligen Winkel zwischen geographisch Nord und magnetisch Nord.
Aber selbst wenn Columbus dies sofort erkannt hätte, hätte er für seine eigentliche Navigation daraus nicht allzu viele Schlüsse ziehen können. Denn mit dem Kompass allein lässt sich nicht navigieren, jedenfalls nicht über so weite Strecken wie über den Atlantik. Wenn ich von einer Insel in Polynesien los segle und weiß, dass 40 Meilen weiter, also jenseits des Horizonts, meine Zielinsel liegt, so reicht allein der Kompass für die Navigation. Wenn allerdings mein Ziel 1.000 Meilen oder noch weiter entfernt ist, so kann ich mit dem Kompass, entgegen einer Laienmeinung, nicht viel anfangen. Denn der Kompass gewährleistet nicht, dass ich mein Ziel auch erreiche. Auf offener See, gleichgültig, in welchem der Weltmeere, muss nämlich mit Abtrift durch Wind und vor allem mit seitlicher Stromversetzung gerechnet werden. Das heißt, selbst wenn es mir mit den modernsten Kompassen und den besten Steuerautomaten gelänge, den Kurs auf ein Grad genau über mehrere Wochen zu halten, so wäre es ein reiner Zufall, wenn ich genau an der Stelle auf der anderen Seite des Atlantiks herauskäme, an die ich ursprünglich wollte.
Eine Verbesserung bringt auch nicht die Tatsache, dass ich unter Umständen mit einer Logge meine abgelaufene Strecke feststellen kann. Auch hier habe ich das gleiche Problem wie mit dem Kompasskurs. Wenn wir einen Blick in die Pilot Charts werfen, so sehen wir sofort, wo es liegt. Pilot Charts sind Wind- und Stromkarten, in denen Erfahrungen und Beobachtungen vieler tausend Segelschifffahrten statistisch ausgewertet wurden. Sieht man sich die Strecke an, die Columbus von der kanarischen Insel Gomera aus zurückgelegt hat, so sagen die niedergelegten Beobachtungen für die jeweiligen Quadrate von 5 zu 5 Grad lediglich aus, dass dort mit einem Strom von bis zu eineinhalb Knoten zu rechnen ist. Sie sagen aber nicht aus, dass in jedem Fall dort Strom setzt. Im Klartext: Setzt Strom, dann müssen der mit der Logge gemessenen Strecke in 24 Stunden bis zu 36 Meilen hinzugerechnet werden; oder aber der Strom bleibt unberücksichtigt, wenn zufällig die Windverhältnisse der letzten Tage so waren, dass der Strom auf null Knoten abgebremst wurde. Auf Hochseeyachten wird üblicherweise mit einem Mindestetmal von 100 Seemeilen gerechnet. Ein Etmal ist traditionsgemäß die Strecke, die ein Segelschiff von Mittag bis zum nächsten Mittag zurückgelegt hat. Zeigt also unsere Logge 100 Meilen an, so hat die Yacht möglicherweise 100 Meilen, möglicherweise aber auch 136 Meilen zurückgelegt. Strom ließe sich nur aus dem Vergleich von zwei festen Schiffsorten feststellen, so dass er bis zur Erfindung einer genau gehenden Uhr im 18. Jahrhundert auf hoher See nicht bekannt war.
Würden wir also den Atlantik mit einer modernen Segelyacht überqueren, ausgerüstet nur mit dem genauesten Kompass und der genauesten Logge des 20. Jahrhunderts und nichts weiter zur Navigation benutzen, so wäre es unmöglich, drüben mit Sicherheit ein bestimmtes Ziel zu treffen.
Was moderne Yachten Columbus voraushaben, ist die Möglichkeit, mit Hilfe präziser Instrumente, mit denen exakt der Winkel eines Gestirns über dem Horizont gemessen werden kann und mit der genauen Uhrzeit die Position auf ein oder zwei Seemeilen exakt zu bestimmen. Columbus besaß zwar einen Quadranten, was nichts anderes ist als ein höchst primitives Winkelmessinstrument, aber offensichtlich war er selbst von seiner Güte nicht überzeugt. Denn aus seinen Logbüchern weiß man, dass er dieses Messinstrument gar nicht oder nur höchst widerwillig eingesetzt hat. Und über die genaue Uhrzeit verfügte er schon gar nicht. Columbus hatte also eine Navigationsausrüstung, die möglicherweise für die europäischen Küsten ganz gut geeignet war, die aber für eine Navigation, die diesen Namen wirklich verdient, bei einer Atlantiküberquerung nichts taugte.
Wenn aber Columbus so treffsicher den Atlantik überqueren und zurückkehren konnte, ohne ein hierfür geeignetes Navigationsinstrumentarium bei sich zu haben, so spricht einiges dafür, dass gleiches schon viel früher möglich gewesen sein muss. Denn ob seine nautischen Vorfahren den von ihm kaum benützten Quadranten besaßen oder nicht – so meine Idee –, war für die Durchführung einer erfolgreichen Atlantikpassage unwichtig. Wenn auch ein Kompass dafür nicht taugte, blieb es gleichgültig, ob ein solcher an Bord war.
Folglich war es dann sogar ohne Belang, ob eine Yacht überhaupt Navigationsinstrumente mit sich führte. Wenn dem aber so war, musste es möglich sein, auch heute den Atlantik ohne irgendwelche navigatorischen Hilfsmittel zielsicher zu überqueren.
Navigationsgeheimnisse der Polynesier
Seit 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Navigation. Aus welchen Gründen auch immer, diese Materie hat mich von jeher gereizt. Es befriedigte mich nicht, alle möglichen Ziele bei unseren jahrelangen Reisen punktgenau zu erreichen, sondern ich versuchte immer wieder, neue Navigationsmethoden zu finden (was selten gelang) oder die bestehenden so zu vereinfachen, dass sie wirklich auch unter rauen Bedingungen an Bord, möglicherweise selbst bei Schwächung durch Seekrankheit, leicht und damit sicher zu handhaben waren. Es freute mich, dass die Leser meiner Bücher über Navigation dies offensichtlich honorierten und mir mehr als einmal ihre Aha-Erlebnisse schrieben: „Jetzt habe ich es endlich begriffen...“
So war es fast logisch, dass die Idee, den Atlantik ohne jedes Navigationsinstrument zu überqueren, mich blitzartig faszinierte. Denn dabei konnte ich nicht auf Geschriebenes oder Überliefertes zurückgreifen, sondern musste an Ort und Stelle etwas „erfinden“, um sicher anzukommen.
Aber konnte ich wirklich auf nichts zurückgreifen? Hatte ich nicht jahrelang in der Südsee gelebt und war mit zahlreichen Polynesiern zusammengetroffen, denen man ja nachsagt, dass zumindest ihre Vorfahren Pioniere der Navigation gewesen seien? Die Antwort lautet schlicht: „Nein.“
Dies mag überraschen, weil man in Europa immer wieder von den kaum nachvollziehbaren Navigationsleistungen der Südseeinsulaner hört. Es mag nachdenklich stimmen, wenn man in Museen oder in historischen Veröffentlichungen immer wieder damit konfrontiert wird, dass Polynesier über geheimnisvolle Fähigkeiten verfügt haben müssen, um ihr Inselreich (das immerhin der Fläche von Europa entspricht) abzusegeln. Und doch ist dem so.
Carla und ich hatten in der Südsee sogar die Genehmigung bekommen, mit unserer THALASSA II und zahlenden Gästen kreuz und quer durch Polynesien zu segeln. Es ist leicht, mit den Einheimischen dort Kontakt zu bekommen, mit Menschen, die wie wenige andere stets ein fröhliches „Ja“ zum Leben sagen. Polynesier leben auf dem Wasser. Sie benutzen ihre Boote wie wir ein Auto oder ein Motorrad. Auf vielen Inseln sind die Wege nur wenige hundert Meter lang. Um Freunde im Nachbardorf zu besuchen, fahren sie mit dem Auslegerboot am Ufer entlang dorthin. Es gibt somit kaum einen Polynesier, der mit diesen wackligen Booten nicht meisterhaft umzugehen verstünde.
Wovon aber alle Polynesier (bis auf wenige Ausnahmen), die ich jemals traf, keine Ahnung haben, ist Navigation. Sie benützen keinen Kompass, weil sie nicht damit umgehen können – nicht etwa, weil sie ihn nicht brauchen. Üblicherweise müssen sie auch gar nichts von Navigation verstehen. Denn ihr Ziel sehen sie immer am Horizont. Wenn die Bewohner der Insel Ahé mit ihren Auslegerbooten zu sportlichen Wettkämpfen nach Manihi fahren, so haben sie Manihi am Horizont vor Augen und achten nur darauf, genügend Benzin für den Außenborder dabeizuhaben. Die Kapitäne auf den Kopraschonern (wir sagen immer noch wie zu Zeiten von Jack London zu den Versorgungsschiffen „Kopraschoner“, obwohl die Segel längst durch starke Dieselmotoren abgelöst wurden) sind keine Tahitianer, die mit der Intuition von Naturvölkern durch die Inselwelt Polynesiens navigieren, sondern meistens Ausländer. Es sind Chinesen, denen der Dampfer gehört, es sind rumänische Seeleute, die es auf der Jobsuche nach Polynesien verschlagen hat, es sind Deutsche, die nach mehreren Jahrzehnten Dienst in der Fremdenlegion nun pensioniert sind und als Gelegenheitsjob eben Kapitän auf einem Kopraschoner spielen. Es gibt auch einige wenige Polynesier, die das Kommando über so ein Schiff führen. Aber enttäuschenderweise navigieren sie, wie überall auf der Welt in der Berufsschifffahrt navigiert wird: mit Radar und Sextant (früher) oder heute mit GPS.
Vor ein paar Jahren wollte ich einen Artikel für die Zeitschrift „Yacht“ über die geheimnisvolle Navigationskunst der Polynesier schreiben, doch bin ich nicht sonderlich fündig geworden. Nur wenig gab es im Museum zu entdecken. Das mag daran liegen, dass die Tahitianer keine Schrift kannten, somit auch keine schriftlichen Überlieferungen vorhanden sind. Der große Freund des polynesischen Volkes, der Forscher James Cook, konnte deshalb ebensowenig über die Navigationskünste der Polynesier erzählen wie es heute zu entdecken gibt.
Über den Atlantik wollte ich segeln, was nicht heißt, dass es mich nautisch befriedigt hätte, irgendwo anzukommen. Dies lässt sich an der amerikanischen Küste schwer vermeiden. Aber mit Navigation hat es nichts zu tun, wenn eine Yacht aus Europa kommt und irgendwo am amerikanischen Kontinent anlandet (oder angespült wird). Nein, die Herausforderung musste schon viel enger gefasst werden. Es musste sich um eine Navigation handeln, die den Namen auch verdient, es musste also das Ankommen an einem ganz bestimmten, vorher ausgesuchten Ort als Ziel definiert werden. Hätten die Polynesier dies gekonnt? Haben die Polynesier über derartige Fähigkeiten verfügt?
Wie jedermann mit Papier und Bleistift feststellen kann, nimmt der Schwierigkeitsgrad mit der wachsenden Entfernung des Ziels und dessen Kleinheit entscheidend zu. Auch ein Europäer ohne jegliche Navigationskünste könnte von Ahé aus Manihi erreichen, wenn er nach Verlassen des Passes das Motu am Horizont schon deutlich ausmachen kann. Wäre das Inselchen ein wenig weiter entfernt, so dass es bereits unter dem Horizont (also hinter der Erdkrümmung) liegt, so wäre es auch keine Kunst, dieses Inselchen ohne jedes Navigationshilfsmittel zu finden, wenn man nur genau genug nach dem Kompass steuern würde. Allerdings dürfte kein zu starker Strom von der Seite setzen. Würde man ein noch entfernteres Ziel ansteuern, so würde mit zunehmender Entfernung dies alles zu einem unberechenbaren Glücksspiel werden, hätte also mit Navigation nichts mehr zu tun.
Wie aber haben es die Polynesier geschafft? Der einzige Experte, den ich für meine damalige „Yacht“-Geschichte ausfindig gemacht habe, war der Tahitianer Rodo, dem der sagenhafte Ruf vorausging, der letzte seines Geschlechts zu sein, der sich auf die alte Kunst der Navigation seiner Vorfahren verstand. Um es gleich vorwegzunehmen: Rodo war tatsächlich der einzige Polynesier, den ich jemals getroffen habe, der Fachmann genug war, um über Navigation sprechen zu können.
Aber wirklich Neues konnte er mir nicht erzählen – bis auf wenige Tricks, die tatsächlich faszinierten. So konnte er mir das Geheimnis seiner Vorväter verraten, wie sie feststellten, dass hinter dem Horizont eine Insel lag, ohne sie überhaupt zu sehen. Ich habe das in der polynesischen Inselwelt selbst nachgeprüft, es hat wirklich funktioniert: Wegen der über Landmassen vorhandenen Luftfeuchtigkeit und dem Atmen der Vegetation befindet sich über Inseln häufig eine niedrig stehende Wolke. In Polynesien gibt es kaum Inseln ohne eine smaragdgrüne Lagune. Wenn man nun die Insel noch nicht, „ihre“ darüberstehende Wolke jedoch schon erkennt, so lässt sich bei genauem Hinsehen auf der Unterseite der grauen Wolke eine leichte smaragdgrüne Einfärbung finden, also die Reflektion der darunterliegenden Lagune. Dies war häufig ein hübscher Überraschungseffekt, wenn ich meinen Gästen demonstrierte, wie ich eine Insel hinter dem Horizont optisch wahrnehmen konnte. Auf einer Atlantiküberquerung allerdings wäre dieser Trick kaum von großer praktischer Bedeutung, denn bei einer Entfernung von 2.700 Seemeilen, also rund 5.000 Kilometern, geht es in erster Linie darum, die Insel zu treffen. Auch andere Tricks, die Rodo mir verriet, waren zwar ganz attraktiv zum Weitererzählen, aber für meine jetzige Idee und für die Übertragung auf europäische Verhältnisse ungeeignet. So wies mich Rodo auch in Geheimnisse ein, die aus im Wasser treibenden Blättern (zum Beispiel des Brotfruchtbaums) abgelesen werden können.
Aber dies sind alles Kniffe, die erst dann funktionieren, wenn die eigentliche Aufgabe der Navigation bereits erfüllt ist, wenn sich also das Schiff sozusagen schon im Zielgebiet befindet. Dorthin zu gelangen, ist die Herausforderung bei einer Atlantiküberquerung. Und dafür konnte mir Rodo nicht viel verraten. Oder doch?
„Wie findet ihr eine ganz bestimmte Insel weit weg von eurem Ausgangspunkt?“, fragte ich Rodo bei einem dieser Fachgespräche. Er lächelte überlegen und erklärte: „Schau zum Firmament. Dort gibt es Millionen von Sternen. Jedes Inselchen hat einen eigenen Stern, der ganz genau über dieses hinwegzieht. Unsere Vorväter kannten all die Sterne, die zu bestimmten Motus (polynesisch für Inseln) passen. Auch ich kann dir einen Stern nennen, wenn du zu einer ganz bestimmten Insel segeln möchtest. Du musst eben deinen Kurs so legen, dass du in ein Gebiet kommst, wo dieser Stern ganz exakt über dein Schiff hinwegzieht; dann brauchst du nur diesem Stern zu folgen!“
Das hatte mir damals eingeleuchtet. Sicherlich kann man nicht das ganze Jahr über einen bestimmten Stern für eine Insel benutzen, denn mit den Jahreszeiten wechseln auch die Winkel, unter denen man einen Stern sieht. Doch ließ sich schon vorstellen, dass die Kunst der Polynesier weit genug fortgeschritten war, um für jede Jahreszeit den Leitstern der jeweiligen Insel zu benennen. Die Hauptschwierigkeit schien mir die Feststellung, ob der Stern exakt über das Schiff hinweg zog. Aber auch hierfür hatte Rodo eine Patentmethode: „Du musst dich nur unter den Mast legen und zur Spitze peilen, dann kannst du ohne weiteres erkennen, ob ein Stern genau senkrecht über dir steht.“
Damals hatte ich mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht, wie sich diese Art zu navigieren in der Praxis realisieren ließ. Denn wir waren auf solche Spielereien nicht angewiesen. Carla und ich benutzten Omega-Computer, nautische Tafeln und später auch Satellitennavigationsgeräte.
Noch etwas gab den Anstoß, dass aus den Stichworten „Passatsegeln“ und „Columbus“ die Idee zu einem neuen Projekt wurde. Bei unserer ersten Weltumsegelung navigierten wir mit Hilfe der Gestirne, doch war die Rechenarbeit immerhin so mühsam und umständlich, dass Fehler gemacht wurden, wohl nicht beim Messen, eher beim Rechnen.
Umständlich war die Handhabung der für die damalige Zeit recht modernen Nautischen Tafeln. Da ich von jeher recht verbissen danach trachtete, die Navigation für meine Leser zu vereinfachen, stürzte ich mich mit Begeisterung auf die Möglichkeiten, die die aufkommenden Taschenrechner und später die Computer zur Vereinfachung der Navigation und zum Eliminieren der umständlichen Rechenarbeit boten. Es ließ sich nicht ganz vermeiden, dass einige meiner treuen Leser, denen ich die Arbeit mit Tafeln gerade eben plausibel gemacht hatte, sich etwas enttäuscht von mir abwandten, weil sie keine Lust mehr hatten, sich nun auch mit dem modernen „Computerkram“ zu beschäftigen. Aber die Entwicklung ließ sich nicht aufhalten. Immer noch bin ich überzeugt, dass es ein Beitrag zur Sicherheit auf Yachten ist, wenn die Messung eines Gestirns innerhalb einer Sekunde von einem Computer berechnet wird, statt dass man eine halbe Stunde lang in fehlerträchtigen Zahlenkolonnen herumsuchen muss.
Ist man publizistisch tätig, freut man sich für gewöhnlich, wenn man sich einen gewissen Ruf erschrieben hat. In diesem Fall war es etwas anders. Immer häufiger wurde ich in Buchkritiken oder in Zeitschriftenartikeln als „Computerspezialist“ abqualifiziert. Das klingt danach, dass jemand Maschinen für sich arbeiten und denken lässt. Kurzum, der Ruf behagte mir nicht. Für mich ist Navigation nach wie vor etwas ganz Originäres. Denn wo sonst lässt sich die eigene Position, auch im übertragenen Sinne, ausschließlich mit Hilfe von Gestirnen, also mit Hilfe der Natur bestimmen? Nur die Verwertung meiner Beobachtungen in der Natur überlasse ich hirnlosen Maschinen, weil die eben nicht genial genug sind, Fehler zu machen. So spielte bei mir auch der Gedanke eine Rolle, durch das Experiment einer Atlantiküberquerung ohne nautische Hilfsmittel meinen Ruf als Navigator wieder zu festigen.
Sponsorensuche
Damit war also der Gedanke an eine Atlantiküberquerung ohne jegliches navigatorische Hilfsmittel geboren. Aber von der Realisierung unseres Projekts waren wir noch weit entfernt. Denn wir hatten nicht einmal eine Yacht zur Verfügung. Nachdem wir von unserer Südseereise zurückgekehrt waren, hatten wir die THALASSA II noch einige Zeit behalten. Ihr Liegeplatz war in Santa Ponza auf Mallorca, einem kleinen hübschen Hafen. Wer nun glaubt, es sei geradezu ideal, in Mallorca eine Yacht liegen zu haben, irrt. Zwar ist es heute kein Problem, in zwei Stunden von München aus auf der Yacht zu sein, doch häufig werden die Nachteile übersehen. Nicht, dass wir mit unserer THALASSA II nicht zufrieden gewesen wären. Nein, für mich war es das ideale Schiff schlechthin. Aber eine Yacht bedarf einer gewissen Betreuung, Unterhaltung und Pflege.
Ich war bei meinen Segelaktivitäten zeitlich durch das mir zur Verfügung stehende Quantum an Urlaub vom Beruf eingeschränkt. Mehr als einmal passierte es, dass wir mit der Werft in Mallorca für das Frühjahr einen ganz bestimmten Termin ausgemacht hatten, um der THALASSA II den jährlich notwendigen Unterwasseranstrich zu verpassen. Wenn ich also zu der Zeit, für die der Travellift angemietet war, Urlaub genommen hatte, um in zwei oder drei Tagen die Yacht zu streichen und anschließend in den hübschen Gewässern von Mallorca zu segeln, mussten wir an Ort und Stelle erfahren, dass der Travellift gerade zu der Zeit besetzt war. Damit war wieder einmal unser wertvoller Urlaub damit zugebracht, in einer Werft auf den nächsten freien Termin für die notwendigen Unterwasserarbeiten zu warten. Kurzum, dies empfanden Carla und ich, die wir ja jahrelang mit unseren Yachten die Freiheit der sieben Meere kennengelernt hatten, als so deprimierend, dass wir die THALASSA II verkauften.
Denjenigen, die bedauern, keine eigene Yacht zu besitzen, zum Trost: Ohne eigene Yacht ist man an kein Revier der Welt gebunden. Auch Unterhaltskosten fallen nicht an. Mit dieser Freiheit und deshalb vergleichsweise viel gespartem Geld lässt sich einiges anfangen. Heute werden alle attraktiven Segelreviere der Welt von potenten Charterfirmen abgedeckt, so dass der yachtlose Segler für seine Abenteuer den gesamten Globus absegeln kann. Wen die Kosten schrecken, der kann nicht richtig rechnen. Werden nämlich die Charterkosten für eine ganze Yacht auf die Anzahl der Teilnehmer am Segelurlaub umgelegt, so kommt ein Überraschungspreis heraus, für den es in keinem Hotel der gehobenen Preisklasse ein Unterkommen gibt.
Vor ein paar Jahren war ich vom Inhaber einer Charterfirma, nämlich Kurt Ecker aus dem österreichischen Ried, eingeladen worden, bei einer von seiner Firma veranstalteten Hochseeregatta 1.000 Meilen quer durchs Mittelmeer in Ägypten die Siegerehrung vorzunehmen. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen, denn wer hat schon die Möglichkeit, schnell mal übers Wochenende nach Ägypten zu fliegen, dort ein paar Hände zu schütteln und ansonsten nur im feinen Hotel rumzusitzen? Darüber hinaus war es für mich ein großes Vergnügen, denn so lernte ich eine Unmenge von wirklich begeisterten Seglern kennen, die beim Ecker-Cup vom damaligen Jugoslawien nach Alexandria mitgesegelt waren.
1.000 Meilen Mittelmeer im Spätherbst ließen von vornherein erwarten, dass es sich nicht um eine gemütliche Segelgaudi handelte, sondern dass härtestes Segeln geboten wurde.
Entsprechend hart war auch beim Ecker-Cup gesegelt worden, wobei sich die Spannung erst legte, nachdem die letzte Yacht in Alexandria eingelaufen war. Bei der Siegerehrung, einem festlichen Abend mit rund 500 Seglern im Yachtclub von Alexandria, hatte ich von den Gesichtern der Segler den Stolz ablesen können, unter so harten Bedingungen eine Yacht erfolgreich und sicher in der Winterzeit quer übers Mittelmeer gesegelt zu haben.
Als ich mir nun überlegte, wo ich ein Schiff für unseren Columbus-Törn finden konnte, fiel mir als erster Kurt Ecker ein. Ich will hier kein großes Geheimnis daraus machen und wahrheitsgemäß berichten, dass ich mir, wenn möglich, die Charterkosten für eine Atlantiküberquerung gern erspart hätte. Möglicherweise hätte Kurt Ecker ohnehin im Winter 92/93 eine Yacht in Westindien gebraucht und dorthin überführen müssen. Wenn er mir abgesagt hätte, so hätte ich immer noch bei einer x-beliebigen Charterfirma eine Yacht anmieten können. Ob mir allerdings jemand eine Yacht verchartert hätte, wenn ich ihm vorher mitgeteilt hätte, dass ich keinerlei Navigationsausrüstung mit mir führen, ja, die vorhandene ausbauen würde, ist fraglich. So schrieb ich also an Kurt Ecker folgenden Brief:
„Lieber Kurt, Carla und ich haben eine Idee ausgebrütet. Ich falle mal gleich mit der Tür ins Haus: Hättest Du nicht ein Schiff, das in die Karibik zu überführen wäre? Ich möchte auf den Kanaren lossegeln, ohne Kompass, Sextant, GPS, Uhr, nautische Bücher, Seekarten, Computer, Sender und Radioempfänger. Auch nicht „zur Sicherheit in versiegelten Behältern“ werden derartige Dinge an Bord sein. Selbst die Mitsegler (ich habe an sechs Leute gedacht) werden weder Uhr noch Radio oder Ähnliches haben. Sie werden also mir hundertprozentig vertrauen (müssen). Niemand von uns wird die Uhrzeit oder die Position kennen oder Nachrichten von außen erhalten können. Damit werden wir nicht irgendwohin in Amerika segeln, sondern zu einer ganz bestimmten Insel!“
Umgehend faxte Kurt Ecker zurück:
„Servus, Bobby, Euer Vorhaben finde ich enorm. Wir müssten das Schiff zu den Kanaren bringen. Wenn wir dieses Terminproblem in den Griff bekommen, würde ich mich sehr freuen. Die navigatorische Ausrüstung könnte auf den Kanaren ausgebaut und von einem der anderen Schiffe mitgenommen werden. Ich würde mich freuen, wenn Ihr eines unserer Schiffe (natürlich denke ich in erster Linie an die Solitaire 52) trotz des Terminproblems verwenden könnt.
Vorerst verbleibe ich mit besten Grüßen Kurt“
Kurt Ecker in der Navigationsecke seiner Sarita, einer Solitaire 52
Das war eine Überraschung, denn viele Segler versuchen in Deutschland, einen Sponsor zu finden. Häufig werden Dutzende von Firmen angegangen, alles vergeblich. Dass gleich mein erster Versuch erfolgreich war, bewies mir aber die Qualität meines Plans. Denn bei leistungsstarken Gönnern handelt es sich ja nicht nur um Menschenfreunde, sondern meist um erfolgreiche Geschäftsleute, die sehr genau Risiko gegen Erfolgsaussichten abwägen.
Gleichzeitig war ich über Kurts Bereitschaft, uns eine Yacht zur Verfügung zu stellen, erschrocken. Denn bis dahin war es mehr ein Gedankenspiel gewesen, ohne dass ich allzu viel über das Risiko einer solchen Fahrt nachgedacht hatte. Jetzt aber war ich mitten drin und hatte noch nicht die leiseste Idee, wie das Ganze funktionieren sollte. Doch genau dies hatte ich beabsichtigt. Ich glaube nämlich an die Leistungsfähigkeit des Menschen, besonders in Stresssituationen. Ich wollte mit einer Yacht lossegeln, ohne ein fertiges Rezept in der Tasche zu haben. Der Reiz an der Sache war gerade, dass wir vielleicht erst unterwegs rausfinden würden, wie ein fester Punkt in der Karibik ohne Navigationsinstrumente erreicht werden kann.
Wir? Carla und ich hatten ausreichend bewiesen, dass es uns ohne Weiteres möglich war, ein 20-Tonnen-Schiff zu zweit in den härtesten Revieren der Welt zu segeln. Solches Segeln ist aber immer ein kleiner Kompromiss, denn eine 16-Meter-Yacht bedarf schon einer Mannschaft von sechs bis acht Leuten, um entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit ausgesegelt zu werden. Wir haben unsere THALASSA II zwar nicht gerade im Schongang gesegelt, doch eingedenk der zahlenmäßigen Schwäche unserer Mannschaft haben wir immer darauf geachtet, dass beispielsweise frühzeitig Segel weggenommen wurden und dass wir uns nicht gerade nachts in nautisch schwierigen Gewässern herumtrieben. Nun aber schwebte uns das Bild einer unter Vollzeug im Passatwind dahinpreschenden Yacht vor. Das heißt, wir wollten dieses Mal nicht nur eine navigatorisch anspruchsvolle Reise machen, sondern auch möglichst sportlich segeln. Deshalb war von Anfang an klar, dass wir die SARITA mit ausreichender Besatzung, also mit sechs bis acht Mann, segeln würden. Wen wir auf diese Reise mitnehmen wollten, darüber machten wir uns noch keine Gedanken. Denn ich war mir sicher, dass es für mich kein Problem sein würde, innerhalb kürzester Zeit eine geeignete Mannschaft zu finden. Noch blieb ja länger als ein halbes Jahr Zeit, um uns auf die Columbus-Fahrt vorzubereiten. Das Wichtigste jedenfalls hatten wir: das Schiff!
Dass die Atlantiküberquerung im Herbst stattfinden würde, darüber gab es keine Diskussionen. Traditionsgemäß wird der Atlantik im November oder Dezember überquert, was mit dem Wetter zusammenhängt. Denn wie viele Gebiete in den Tropen hat auch die Karibik eine „hurricane season“, die es zu meiden gilt. Selbst mit der besten Yacht hätte man kaum eine Chance, einen tropischen Orkan auf hoher See zu überleben. Hier gilt das Seemannsgesetz: Einem Wirbelsturm weicht man aus, indem man in der „hurricane season“ nicht segelt. In den letzten Jahren hat es, sicherlich in Zusammenhang mit der vieldiskutierten Klimaveränderung, in einigen Gebieten der Welt zahlreiche Orkane außerhalb der Saison gegeben, was nicht ganz ungewöhnlich ist. So sind in der Karibik vor vielen Jahren Wirbelstürme auch im Dezember über die Inseln hergefallen und haben schwerste Schäden angerichtet. Dies ist ein gewisses Restrisiko, mit dem jeder Atlantiksegler leben muss.
Karibiksterne auf den Philippinen
Die Zusage Kurts, uns ein Schiff zur Verfügung zu stellen, führte dazu, dass mein Nachdenken über die Prä-Columbus-Navigation nicht mehr reine Gedankenspielerei blieb, sondern nun einen ernsten Hintergrund bekam. Denn selbstverständlich wollte ich Kurt sein schönes Schiff heil zurückgeben und nicht irgendwo auf ein Riff in der Karibik setzen. Sein Vertrauen ehrte mich, doch setzte es mich auch unter Druck. Offensichtlich ging er davon aus, dass die Sache schon klappen würde.