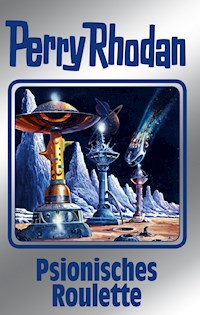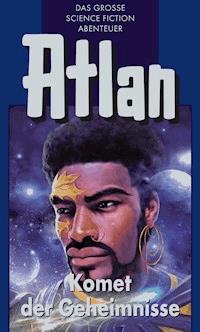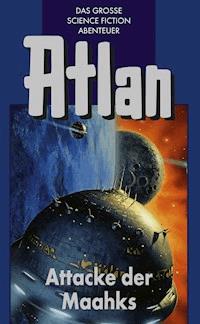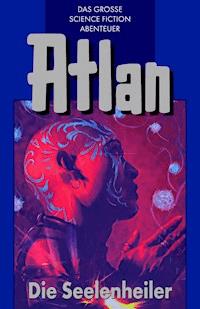Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Perry Rhodan digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Atlan classics
- Sprache: Deutsch
Mehr als 200 Jahre lang war die SOL, das Fernraumschiff von Terra, auf seiner ziellosen Reise durch die Tiefen des Alls isoliert gewesen, bis Atlan in Kontakt mit dem Schiff kommt. Die Kosmokraten haben den Arkoniden entlassen, damit er sich um die SOL kümmert und sie einer neuen Bestimmung zuführt. Jetzt schreibt man an Bord des Schiffes den September des Jahres 3792, und der Arkonide hat trotz seines relativ kurzen Wirkens auf der SOL entscheidende Impulse zu positiven Veränderungen im Leben der Solaner gegeben - ganz davon abgesehen, dass er gleich nach seinem Erscheinen die SOL vor der Vernichtung rettete. Inzwischen hat das Generationenschiff Tausende von Lichtjahren zurückgelegt, und unter Breckcrown Hayes, dem neuen High Sideryt, hat längst eine Normalisierung des Lebens an Bord stattgefunden. Allerdings sorgen unerwartete Ereignisse immer wieder für Unruhe und Gefahren. So ist es auch im so genannten "Sternenuniversum", in das die SOL durch einen Hyperenergiestoß versetzt wurde. Als man eines der seltenen Planetensysteme erkunden will, trifft die SOL auf gnadenlose Gegner. Diese Gegner entfesseln DIE SCHLACHT UM AQUA ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nr. 569
Die Schlacht um Aqua
Die Gravo-Energetiker greifen an
von Peter Terrid
Mehr als 200 Jahre lang war die SOL, das Fernraumschiff von Terra, auf seiner ziellosen Reise durch die Tiefen des Alls isoliert gewesen, bis Atlan in Kontakt mit dem Schiff kommt.
Die Kosmokraten haben den Arkoniden entlassen, damit er sich um die SOL kümmert und sie einer neuen Bestimmung zuführt. Jetzt schreibt man an Bord des Schiffes den September des Jahres 3792, und der Arkonide hat trotz seines relativ kurzen Wirkens auf der SOL entscheidende Impulse zu positiven Veränderungen im Leben der Solaner gegeben – ganz davon abgesehen, dass er gleich nach seinem Erscheinen die SOL vor der Vernichtung rettete.
Inzwischen hat das Generationenschiff Tausende von Lichtjahren zurückgelegt, und unter Breckcrown Hayes, dem neuen High Sideryt, hat längst eine Normalisierung des Lebens an Bord stattgefunden. Allerdings sorgen unerwartete Ereignisse immer wieder für Unruhe und Gefahren.
So ist es auch im so genannten »Sternenuniversum«, in das die SOL durch einen Hyperenergiestoß versetzt wurde. Als man eines der seltenen Planetensysteme erkunden will, trifft die SOL auf gnadenlose Gegner.
Die Hauptpersonen des Romans
Perester Fassyn – Ein Bewahrer der Welt.
Fallund Kormant – Ein Verbannter von Aqua II.
Atlan – Der Arkonide und sein Team auf Aqua I.
Breckcrown Hayes – Der High Sideryt setzt die Machtmittel der SOL ein.
Grahn Furler – Kommandant einer Space-Jet.
Bora St. Felix
1.
»Sieh an, ein Neuer!«
Das waren die ersten Worte, die Perester Fassyn vernahm, als er aus seiner Ohnmacht erwachte. In seinem Schädel dröhnte und hämmerte es, und der Mann brauchte lange, bis er seine Gedanken wieder geordnet hatte.
Richtig, er war Perester Fassyn, der Bewahrer der Nuun. Er bekleidete das höchste Amt, das es im Volk der Versteckten überhaupt gab.
Und was machte er an diesem Ort? Wer wagte es, so despektierlich über ihn zu reden?
Und wieso Neuer?
Nur stückweise kehrte die Erinnerung zurück, und die war begleitet von Scham und Schmerz. Die eigene Tochter hatte sich aufgelehnt, den Bewahrer entmachtet.
»Tautilla«, murmelte Perester.
»Er kommt zu sich. Schlagen wir ihn gleich tot, oder lassen wir ihn noch ein bisschen zappeln?«
Es tat bitter weh, das erleben zu – müssen, und noch ärger wurde der Schmerz, da es sich um das leibliche Kind handelte. Was hatte er getan, dass seine Tochter so mit ihm verfahren hatte?
Hatte er sie tatsächlich, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, so schändlich behandelt, dass sie wahren Grund hatte, ihn, den Vater, dem Höllenschlund zu überantworten?
Perester Fassyn nahm seine Umgebung nicht zur Kenntnis. Seine Wahrnehmung war ganz nach innen gerichtet. Was auch immer ihm nun zustoßen mochte, welches Schicksal ihm auch bestimmt war – er wollte zuvor sich selber erforschen, sein Gewissen prüfen, ob dies eine Quälerei oder eine gerechte Strafe der Schicksalsmächte war.
Nein, er hatte sich nichts vorzuwerfen. Er hatte die Tochter nach besten Kräften erzogen, sie geliebt und geachtet; frühzeitig hatte er ihre Gedanken und Wünsche ernst genommen und respektiert. Zu früh? Nur wenig Zeit hätte noch verstreichen müssen, dann hätte er ihr in gebührend feierlicher Form Amt und Würde des Bewahrers übergeben – und damit auch die geheimen Kenntnisse, die mit dem Amt verbunden waren. Während er nun auf einer harten Unterlage ruhte und raue Stimmen böswillige Reden führten, war Tautilla vermutlich längst Bewahrerin – aber ohne Kenntnis der tieferen Zusammenhänge. Das Schicksal des Volkes war damit der Willkür preisgegeben, der Jahrtausende währende Zusammenhang vom ersten bis zum amtierenden Bewahrer war zerrissen.
Das konnte für das Volk der Nuun den Untergang bedeuten, dem sie so knapp entronnen waren – und was schadete es da, wenn ruppige Gesellen in lästerlichem Ton die Todesarten besprachen, die sie ihm bereiten wollten?
»He, du, versuche nicht, uns zu täuschen. Wir wissen, dass du wach bist, also mach die Augen auf.«
Es wurde Zeit, sich wieder mit der Wirklichkeit zu beschäftigen. Perester Fassyn öffnete die Augen.
Er lag auf einer metallenen Pritsche, und neben diesem Lager standen drei grimmig dreinblickende Nuun, deren Äußeres arg ramponiert war. Perester kannte den Grund dafür – diese Nuun waren verbannt worden, vermutlich schon vor Jahren. Ja, er erinnerte sich an eines der Gesichter. Er hatte selbst am Urteil mitgewirkt – ein Aufrührer und Störenfried, der aus der Gemeinschaft hatte entfernt werden müssen. Seltsamer Hohn, dass ihm nun das gleiche widerfahren war.
»Wo bin ich?«, fragte Perester verwirrt. Zeit gewinnen, das war das erste Ziel. Wenn diese Leute erkannten, wer da zu ihnen gestoßen war – ausgerechnet der Bewahrer, der sie selbst dem Höllenschlund hatte überantworten lassen –, war sein Leben keinen Wassertropfen mehr wert. Sie würden ihn vermutlich auf der Stelle erschlagen.
Perester raffte das Gewand enger. Er erinnerte sich, dass man ihm das Zeichen des Bewahrers gelassen hatte – das Abbild der orangefarbenen Sonne mit einem einzigen Planeten. Perester trug es wie stets an der Kleidung; noch wurde es vom Umhang verborgen.
»Bei deinesgleichen, Alter«, sagte der größte der Nuun, ein bulliger Kerl, dem ein Ohr fehlte. »Nun, wie fühlst du dich? Dass ein Mann deines Alters sich so gebärdet, dass man ihn in den Höllenschlund wirft, will mir nicht in den Sinn.«
»Mir auch nicht«, sagte Perester Fassyn und stand langsam auf. Der Raum, in dem er sich befand, war kahl. An den Wänden zeigten sich leichte Rostspuren.
»Wo sind wir hier?«, fragte Fassyn. »Ich habe wohl die Besinnung verloren.«
Der Einohrige stieß ein geringschätziges Lachen aus.
»Ohnmächtig geworden, vor Angst, wie? Nun, wo du bist, das kann ich dir so genau nicht sagen. Wir wissen es selbst nicht. Aber es gibt viele hier von uns. Die Schergen des Bewahrers sind in den letzten Jahren sehr eifrig gewesen.«
»Seine Lungen sollen verdorren!«, schimpfte der jüngste der drei Nuun.
»Den Gefallen wird er dir nicht tun«, sagte der Einohrige. »Ich bin Lotham, der Kleine heißt Orlin, und dieser schweigsame Bursche ist Zurraf. Und du?«
»Nennt mich Sterfas«, bat Perester Fassyn. »Warum wolltet ihr mich erschlagen?«
»Sei nicht zu sicher, dass wir es nicht doch noch tun«, knurrte Lotham. »Es gibt viele Nuun hier und wenig zu essen, und du wirst uns kaum behilflich sein können.«
»Zeigt mir, was zu tun ist, und ich werde mich nützlich machen«, bat Fassyn.
Er wusste, wo er sich befand. In der geheimnisumwitterten Station, von der aus vor Urzeiten die Große Flut über den Planeten der Nuun hereingebrochen war. Vor undenklich langer Zeit war es dem Volk der Nuun gelungen, dieser Flut Herr zu werden. Aber das lag so lange zurück, dass sich keiner mehr richtig daran erinnern konnte – es gab Sagen und Legenden, mehr nicht, und sie wurden hinter vorgehaltener Hand weitergegeben von einem Bewahrer auf den anderen. Nun war die absonderliche Lage eingetreten, dass einer, der Bescheid wusste, diese Station erreicht hatte, wenn auch gegen seinen Willen.
»Führt mich herum, Freunde. Ich möchte alles sehen.«
Lotham wandte sich an seine Begleiter.
»Er ist nur ein Fresser mehr. Was sollen wir mit ihm?«
»Dreh ihm das Gesicht auf den Rücken«, gab Zurraf von sich. Es war der erste Satz, den Fassyn von ihm zu hören bekam.
»Vielleicht kann ich euch doch von Nutzen sein«, gab Fassyn zu bedenken. »Und töten könnt ihr mich immer noch – aber erst zeigt mir eure Welt.«
Es hieß, die Station – angeblich befand sie sich auf einer Umlaufbahn, die der Nuuns genau entsprach, damit man die Station niemals zu Gesicht bekam – sei ziemlich klein, nur knapp 22.000 Trockenschritte sollte sie durchmessen. Die Vorstellung, dass das Unheil, von dem das Volk der Nuun ums Haar vernichtet worden wäre, seinem Ausgang in einem so winzigen Gebilde genommen hatte, war erschreckend. Aber bislang hatte niemand die Legende nachkontrollieren können – der Höllenschlund funktionierte nur in einer Richtung. Er verschlang, was ihm eingefüttert wurde, und spie es auf der anderen Seite wieder aus.
»Also gut, komm mit. Vielleicht hat einer der anderen eine Idee, was mit dir geschehen soll.«
Perester Fassyn zog den Mantel eng um die Schultern. So lange wie möglich wollte er das Symbol des Bewahrers verbergen – sein Tod war sonst unvermeidlich.
Die Station war uralt, und das war zu sehen. Es waren nur Kleinigkeiten – eine ausgefallene Beleuchtung hier, ein defekter Schalter dort, ein wenig Rost und Schmutz, in einem anderen Raum ein modriger Geruch. Aber die Fülle dieser Kleinigkeiten traf den Bewahrer tief.
Er kannte das Phänomen von den Anlagen unter dem Grünmantel; war dort erst einmal ein Schaden aufgetreten, zog dieser meist einen zweiten Fehler nach. Lawinengleich schwollen die Pannen an – bis zur völligen Zerstörung, wenn nicht sehr frühzeitig dagegen angegangen wurde. Dass sich eine solche Zerstörungslawine im Lauf von Jahrhunderten abspielte, nahm dem Vorgang nichts von seinem Grauen – und das galt ganz besonders für die Station, in der der Bewahrer gelandet war. Was geschah mit der Heimat, wenn Rost und Zerfall diese Station zerfraßen und zermürbten? Wenn die technischen Geräte ausfielen? Kam dann das Wasser zurück?
Mit immer stärker werdendem Grauen vergegenwärtigte sich der Bewahrer, dass an jedem noch so kleinen Rostfleck dieses technischen Wunderwerkes das Leben von Tausenden hing. Und ein Wunderwerk war diese Station – hatte sie es doch auf rätselvolle Art und Weise geschafft, die Heimat der Nuun zu überfluten; dass sie jetzt auch die Aufgabe erfüllte, die Wassermassen von dem Planeten abzuhalten, nahm ihr nichts von ihrer bösartigen Perfektion und ihrer einzigartigen Wichtigkeit für das Leben und die Zukunft der Nuun.
Perester Fassyn fröstelte.
Er spazierte in einem Etwas herum, das nichts weiter war als eine gigantische Vernichtungsmaschinerie, die man gerade noch hatte bändigen können. Der Tatsache, dass es gelungen war, diesem unerschöpflichen Vernichtungspotenzial gleichsam Ketten anzulegen, verdankte das Volk der Nuun Sicherheit und Frieden. Und doch konnten die Ketten rosten, und dann war es mit der Sicherheit vorbei.
»Wahnsinn«, murmelte der Bewahrer.
»Was hast du gesagt, Alter?«
»Ich begreife dies alles nicht«, sagte Fassyn hastig. »Es übersteigt meinen Verstand.«
»Ach was«, sagte Lotham. »Seit vielen Jahrtausenden leben Nuun hier, und jetzt leben wir hier, und nach uns werden andere kommen und hier leben. Das Zeug funktioniert, und das genügt doch wohl.«
»Wovon ernährt ihr euch?«, fragte Fassyn.
»Es gibt Hefefarmen, da arbeiten viele«, sagte Lotham. »Wir haben das natürlich nicht nötig, wir sind die Oberschicht.«
»Aha«, sagte Perester Fassyn. »Und was muss man tun, um zur Oberschicht zu gehören?«
Lotham winkelte den rechten Arm ab und schlug sich auf den Bizeps.
»Kraft muss man haben, und man muss sie einsetzen können. Das ist alles.«
»Wirklich?«
»Du wirst es erleben – spätestens, wenn du selbst in einer Hefefarm arbeitest.«
Perester Fassyn senkte das Haupt.
Ein Gedanke, der aberwitziger nicht sein konnte. Eine Vernichtungsmaschine, die einen Planeten und seine Bewohner unwiderruflich zerstören konnte, am Leben gehalten von namenlosen Sklaven, von den Schwachen und Sanften, kontrolliert von einer Horde kurzgeschorener Kraftbolzen, und es war nur deren Dummheit und dem Glück zu verdanken, dass sie nicht längst sich selbst und alles andere zerstört und vernichtet hatten.
In diesen schrecklichen Augenblicken erfuhr Perester Fassyn an sich selbst eine Gefühlsregung, von der er wusste, dass sie ihm bisher völlig fremd gewesen war, von der er gleichfalls wusste, dass sie seiner Tochter noch weitaus fremder war, und von der er nun begriff, dass sie unabdingbare Voraussetzung für jeden war, der über ein Volk herrschen und es glücklich machen wollte – Perester Fassyn lernte die Demut.
Er kam an den Hefefarmen vorbei, übelriechenden Fabrikationsanlagen, erfüllt von Moder und Schweißgeruch, belebt mit elenden Kreaturen, denen das grässliche Schicksal der Sklaverei den Mut und die Zuversicht genommen hatte. Diese Unglücklichen hatten die Verantwortung für ihr Leben längst abgegeben, sie ließen die Dinge treiben und sich selbst – und diese Regung war für Perester Fassyn durchaus nicht fremd. Lange Jahre hindurch hatte er als Bewahrer auch darauf vertraut, dass das Alterprobte sich von selbst durchsetzte und die Dinge in stetem kontrollierbaren Fluss hielt.
Und er erlebte an seinen stämmigen Begleitern die hohlköpfige Kraftmeierei, die er ebenfalls praktiziert hatte – immer dann, wenn er staatliche und polizeiliche Mittel hatte einsetzen lassen, um Widerstand und Opposition zu unterdrücken. So viel Macht hatte er als Bewahrer besessen, dass er andere Meinungen gar nicht hatte zur Kenntnis nehmen müssen, und der Bequemlichkeit und Überheblichkeit halber hatte er es infolgedessen auch gar nicht getan, sondern die Kritiker gewaltsam zum Schweigen gebracht.
Tiefe Schuldgefühle erfüllten Perester Fassyn, und er schwor sich, die unhaltbaren Zustände in der Station zu ändern. Es war Zeit, dass etwas geschah.
»Ich habe die Hefefarmen gesehen und vieles andere mehr. Ich habe Wärter gesehen und euch – aber wer gibt euch Befehle?«
»Die Befehle? Die geben wir uns selbst. Hier redet uns keiner drein.«
Lothams Äußerung klang wenig glaubwürdig. Er war der Typ, der dreinschlug, und ganz ohne Nachdenken ließ sich das Leben in der Station sicherlich nicht aufrechterhalten. Irgend jemand in der Station musste Hirn genug haben, die charakterlose Kraft dieser Muskelstränge sinnvoll nach seinem Willen zu steuern. Lotham und seine kurzgeschorene Rüpelbande waren Werkzeuge, keine Planer.
»Ihr habt doch Ratgeber?«
»Klar, haben wir. Der Behüter hält sich eine Schar Tüftler, die auch für uns arbeiten müssen.«
Perester Fassyn entschlüsselte die Großmäuligkeit. Es gab eine Person, die der Behüter genannt wurde – es würde zu klären sein, ob es sich dabei um einen Größenwahnsinnigen handelte, der diesen Begriff tatsächlich auf sich selbst anwandte. Die Bezeichnung Tüftler galt vermutlich für die Schar der theorieversessenen Intellektuellen, die Perester Fassyn als Bewahrer des Volkes hatte verschwinden lassen, weil sie den Gleichlauf im Leben des Volkes arg stören konnten.
Perester Fassyn hatte den schrecklichen Verdacht, dass der Behüter von diesen Denkern vermutlich die hatte umbringen lassen, die auch in seinem Herrschaftsbereich jenen unbeugsamen Willen gezeigt hatten, der dem Bewahrer in seinem Bereich unerträglich gewesen war. Übriggeblieben waren wahrscheinlich jene, denen man das Rückgrat hatte biegen können.
Perester Fassyn presste die Zähne aufeinander.
Es waren Spekulationen, die er anstellte, und daher müßig. Bevor er irgendein Urteil fällte, ob positiv oder negativ, wollte er jetzt zuerst einmal Wissen sammeln.
»Ich möchte den Behüter sehen«, sagte er einfach.
Lotham lachte laut auf, Orlin stierte Fassyn an, und Zurraf stieß ein warnendes Knurren aus.
»Werde nur nicht frech, Alter. Der Behüter ist nicht für jeden zu sprechen, und für einen wie dich schon gar nicht.«
»Und was für einer bin ich?«
Lotham sah Perester Fassyn von oben bis unten an. Sein Gesicht drückte Verachtung und Überheblichkeit aus.
»Entweder bist du nichts weiter als ein alter Mann, ein Träumer wie viele. Dann wirst du in einer Hefefarm landen und dort bald sterben. Oder du bist einer von den Tüftlern, und allein deshalb haben wir dich nicht gleich erschlagen. Du wirst uns dienen – so oder so.«
Perester Fassyn lächelte mild. Er richtete sich auf.
»Ich diene niemandem«, sagte er. Er spürte, dass es unglaublich anmaßend war, aber in dieser Lage war die Überheblichkeit angemessen. »Ich bin Perester Fassyn, der Bewahrer!«
Er schlug den Umhang zur Seite und zeigte das Symbol des Bewahrers. Orlin wich erschrocken zurück. Zurraf fletschte die Zähne und machte Anstalten, sich auf Fassyn zu stürzen. Lotham hielt ihn mit hartem Griff zurück.
»Ich erkenne dich, Bewahrer!«, zischte Lotham. In seinen Augen loderte heiße Wut.