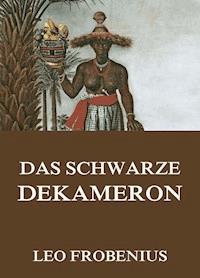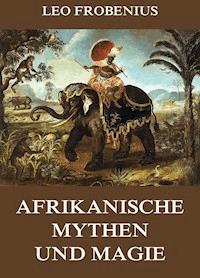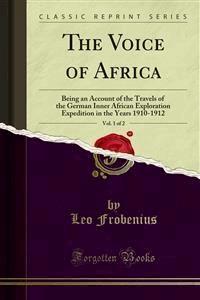9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Atlantis
- Sprache: Deutsch
Unter dem Titel "Atlantis" veröffentlichte der Berliner Ethnologe und Afrikaforscher Leo Frobenius zwischen 1921 und 1928 eine zwölfbändige Reihe mit Volksmärchen und -erzählungen aus Nord- und Westafrika, die zu den umfangreichsten Sammlungen afrikanischen Kulturgutes zählt und als Spiegel afrikanischer Mythologie gilt. In diesem ersten Band befasst sich Frobenius mit den Volksmärchen der Kabylen aus dem heutigen östlichen Marokko, welche die "Weisheit" zum Thema haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Atlantis
Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas, Band 1:
Volksmärchen der Kabylen: Weisheit
LEO FROBENIUS
Atlantis: Volksmärchen und Volksdichtungen Afrikas, Band 1: Volksmärchen der Kabylen – Weisheit, Leo Frobenius
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682062
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
AN FRAU EDITHA FROBENIUS!1
ERSTER TEIL. DIE GEISTIGE KULTUR UND VOLKSDICHTUNG DER KABYLEN3
Berber und Araber3
Das Hinschmelzen der Berber in den Oasenländern. 5
Das aufsaugende Berbertum in der Gebirgskabylie. 7
Die Kabylenkultur, zusammengedrängtes Berbertum... 9
I. Felsbilder und Götter9
II. Gräberformen und Berufe. 12
Das Kabylentum als reifes Samenkorn am absterbenden Berberstamme. — Architektur18
Die patriarchalischen Sippen und Altersklassen. 25
Früher Kasten, jetzt Parteien. 29
Die Frau in der Sippe. 34
Zeremonien der Knaben — (IV. Altersklasse)40
Die Volksdichtung als Ausdruck von Kultur und Geschichte. 46
ZWEITER TEIL. DIE SCHÖPFUNGSMYTHEN UND DAS WELTBILD50
DRITTER TEIL. LEBENSWEISHEIT (GESCHLECHT UND SIPPE)102
VIERTER TEIL. LEBENSWEISHEIT (SCHELMEN UND NARREN)160
FÜNFTER TEIL. LEBENSWEISHEIT (DAS SPIEL DES DASEINS)213
AN FRAU EDITHA FROBENIUS!
Gar manches Mal hast Du mich nun schon auf der Fahrt zu jenem Erdteil, zu meinen Afrikanern, zu den großen Naiven, zu den uns an Lebenskraft und Seelenfähigkeit so weit überlegenen Kindern der roten Erde begleitet, sei es Hand in Hand als Weggenossin mitschreitend, sei es im Gedankenflug meiner Wanderung folgend. Du hast teilgenommen an dem Reichtum, der über mich ausgeschüttet wurde, an dem Freudenrausch des Erlebens, an der Ergriffenheit des Wirklichen, an der Fähigkeit zum Bekennen, am gewaltigen Glück jubelnder Ideen in jener Welt; hast aber auch mit mir die Erschütterung, das Erschrecken, die stets tiefere Enttäuschung über die immer gieriger um sich greifende Öde der Tatsachen, der seelenlosen Begriffe, über die leere, von ihr selbst mit aufsteigendem Ekel empfundenen Mechanik und den totenschädelähnlichen Intellektualismus in dieser, unserer Heimatwelt, erlitten.
Zwei Welten!
Die Welt der Kinder, der Seelenreichen, uns beneidenden (weil sie aus erlebendem, schöpferischem Überreichtum sogar unserem Wesen und — oh Hohn! — unserer "Zivilisation" Beseelung zutrauten), und die Welt der erblindeten Greise, die Welt der nur noch Wissenden, die aus hochmütiger Armut und leeren Augen heraus auf jene "Primitiven'' blasiert, verständnislos herabschauen. —
Und wenn ich hoffnungslos-traurig aus den Ländern des Glückes wiederkehrte in die des Jammers, mit ihrer bis zum Stumpfsinn verkümmerten Disziplin, mit ihrer bis zur Hohlheit herabgesunkenen Lust am Erfinden, ihrer bis zur Geistlosigkeit niedergegangenen Politik, ihrer abblühenden Kunst und ihrer in Schematismus verknöchernden " Wissenschaft'' , mit ihren in Begriffen verdämmerten Ideen, — wenn ich fröstelnd fragte, wie es denn solchem Leblosen taugen könne, wenn neben seiner Bahre das Echo brandenden Lebens erweckt würde, — dann lächeltest Du und sprachst zu mir:
"Das ist nicht verrottende Leblosigkeit, das ist nicht samenlos ersterbendes Verblühen, das ist nicht die Todesstarre verbleichenden Wesens. Siehe: unter diesem hochmütigen Hohn glimmt heimlich sehnsüchtig — Liebe; aus diesem Ekel der Übersättigung spricht Hunger; in diesen doch auch vom Baume des Seins herabgefallenen und jetzt verfaulenden Früchten leben Samenkörner. Und wenn die Schälchen dieser Samenkörner einmal aufgesprungen sein werden und die zarten Keime sich entfalten wollen, — dann fordern sie fruchtbaren Boden. Fruchtbaren Boden sollst auch Du herbeiführen; solches scheint mir Deine Bestimmung! Schling also den Gurt fester um die Schulter und schiebe, die Frau Hoffnung im Herzen, Deinen Karren weiter!" —
Ja, so sprachst Du und so lebtest Du, neben mir und mit mir. Beide Welten hast Du mit mir durchmessen, die jubelnde und die jammernde, und trotz manches schweren Pilgerganges hast Du nie den Mantelzipfel der Hoffnung aus der Hand gelassen, — unserer Frau Hoffnung!
Meiner lieben Frau Hoffnung, die uns, vor heuer zwanzig Jahren, auf unserer ersten gemeinsamen Fahrt nach dem Süden geleitet, und die uns seit damals immer wieder hilfreich aus schwerer Not der Seele und des Leibes errettete. Unsere liebe Frau Hoffnung! — Oh, wo wären wir beide ohne sie gestrandet!
Und diese Frau Hoffnung war es ja auch, die uns einst den Weg aus dieser jammernden in jene jubelnde Welt eröffnete. Sie, die uns nie betrog, hat uns immer wieder das wirkliche Ende allen Jammers, des hohläugigen Elends unserer Zeit, unserer Völker und den Untergang des Materialismus träumend und ahnend vorherschauen lassen. Sie zeigte uns den Hunger in seiner gewaltigen, fordernden Macht wachsend. Sie wies uns keimende Kraft, — nicht mehr im Bizarren, im Zermalmenden, in sich selbst zermarterndem, fadem Skeptizismus und Egoismus endend, — sondern im neuen Erleben der Torheit und des Narrentums, der Weisheit und der Beseeligung, im harmonischen Zwieklang mit jener anderen Welt erstarkend.
Frau Hoffnung war Dir und mir und uns beiden eine gütige Fahrerin. Sie sagt mir, dass auch dieses große Bilderbuch aus dem jubelnden Seelenleben jener anderen Stärkeren unseren Niedergedrückten, unseren Bekümmerten, unseren Schwächeren eine nicht bedeutungslose Gabe sein werde. —
Welches anderen aber könnte ich in diesem Augenblicke, da mir der Abschluss dieser umfangreichen und inhaltsschweren Lebensarbeit gewährt wird, gedenken, als Deiner? — Deiner, Du meine sinnig-innige Weggenossin, Du meine Maßhalterin, Du meine ohne alles Beispiel opferfreudige Gattin, die mir immer wieder, trotzdem es mich oft und für lange Zeitspannen von Deiner Seite fortführte, — den Weg des Lebens und Segens zeigte, um dann selbst, freudig-entsagungsvoll und hoffend, dem Wanderer nachzulächeln!
Dein holdes Lächeln war mir die Erleichterung mancher schweren Stunde, Dein Gram die schwerste Unbill meines Lebens. Deine Wünsche waren die Gewähr meiner Erfolge. Deine fürsprechenden Empfindungen wurden mir zum Leben der Ideen. Dein Bild ist für mich das der Frau Hoffnung geworden. Ich weiß es: unter solchem Zeichen wird dies Werk einen guten Weg nehmen, denn Dein Glaube hat mich nie getäuscht.
Dein sei dies Werk!
Bayr. Gmain, Sinnhof II, Leo Frobenius
September 1920
ERSTER TEIL. DIE GEISTIGE KULTUR UND VOLKSDICHTUNG DER KABYLEN
Berber und Araber
Aus den vielen Völkerwanderungen, die im Laufe der Jahrtausende Nordafrika durchflutet haben, haben sich heute als Hauptbewohner zwei verschiedene Gruppen gebildet, die hier, nebeneinander gesiedelt und durcheinander gewürfelt, eine gewisse Gegensätzlichkeitdarstellen: Araber und Berber. Diese beiden Endergebnisse langer Völkermischungen wiegen so vor, dass (bis auf moderne Kolonisationen) alle kleinen Reste anderer Völker, wie Juden und Türken, demgegenüber gar nicht in Betracht kommen. Araber und Berber sind nicht nur durch die Sprache unterschieden. Beides sind, wie gesagt, Ergebnisse langer Entwicklungsreihen und Mischungen. Weder Berber noch Araber sind irgendwie als eine Rasse anzusehen. So wie wir sie heute vor uns leben und wirken sehen, sind sie aber die Ausdrucksformen zweier diesen Ländern sicher seit sehr frühen Zeiten eigentümlicher Geistesarten: der pflanzenhaften Bodenständigkeit und der zugvogelartigen Beweglichkeit. Das Wesen des Berbers haftet und ruht in seiner Heimat, an einem Ort, in einem Tal; die Heimat des Arabers ist dagegen eine Fläche, über die er hin und her pendelt. Wohl geht auch der Berber einmal in die Fremde, aber er kehrt immer in sein Dorf zurück; er ist und bleibt Bauer. Dem Araber aber gehört die Welt, soweit sie nicht Schranken seinem Bewegungsbedürfnis bietet. Der Araber ist seinem Wesen nach stets Nomade, und es spielt dabei keine Rolle, ob er eine Herde Kamele oder Rinder oder Schafe oder aber eine Sendung resp. Ladung von Kaufmannsgütern vor sich hintreibt, ob er in der Oase nächtigt oder in der Stadt. Denn auch diese Städte der Araber sind nicht Siedelungen eines Bodenerzeugnisse hervortreibenden Volkes, sondern gleichsam Hürden umhergetriebener Waren. Der Basar resp. die Suks sind die Mittelpunkte, neben denen sich die Moscheen erheben. Diese Selbstverständlichkeit des Pendelns zeigt sich beim Araber ganz deutlich darin, dass er, wie er als Viehzüchter eine Hauptlagerstätte für die Regenzeit und eine für die Trockenzeit hat, in der Mehrzahl der Fälle auch in zwei, (wenn nicht mehr) verschiedenen Städten eigene Häuser und Familien hat, denen er sich abwechselnd widmet.
Berbertum und Arabertum sind Ausdrucksformen verschiedener Geistesart. Das tritt deutlich hervor in der Bedeutung, die für beide die Moschee hat. Berber und Araber sind heute Mohammedaner. Aber dem Berber ist die Djemaa, die Moschee, heute noch das lokale Männerhaus, das Gemeindehaus; hier wird der Gottesdienst abgehalten; hier kommen aber die Männer zu ernster Beratung zusammen; hier nächtigen die Freunde; die Djemaa ist Verkörperung des Gemeindegefühls, und ebenso fließt das religiöse Zeremoniell, die Kultushandlung aus dem Gemeindeempfinden. — Dem Araber aber ist die Moschee Sinnfassung einer weltumspannenden, verbindenden, vereinheitlichenden Religion. Dem Araber ist eine Moschee die Kultstätte des Islam, der überall gleich ist, dem Berber die Moschee die Kultstätte seines Heimatbodens. Der Araber kennt nur einen Kosmos, den Kosmos; dem Berber ist die Heimat ein Mikrokosmos im Makrokosmos.
Solche Verschiedenartigkeit ist von großer Bedeutung. Die Weltanschauung des Arabers ist eine nebelhafte, eine formarme. Die Weltanschauung des Berbers ist eine konstruktive, eine gegliederte. Die Weltanschauung des Arabers kennt nur allgemeine Ideale und Legenden, die des Berbers persönliche Ideen und kosmogonische Mythen. Die Schöpfungskraft des Arabertums äußerte sich in dem einen Ideal des Islam; das Dämonische des Berbertums gab dem Christentum eine große Reihe von christlichen Kirchenvätern. Das aber ist, wie sich aus der nachfolgenden Fabulei ergeben wird, für die Beurteilung dieser Menschen entscheidend. Denn die Volkserzählungen des Arabertums (d. h. das, was die Araber volkstümlich aus den ihnen zugekommenen Märchen anderer Völker zu bilden vermochten) sind in Tausendundeiner Nacht zusammengefasst. Das vorliegende Werk bietet aber das berberische Gegenstück. Und eine Einleitung zum Verständnis dieses Gegensatzes sollen die vorstehenden Zeilen bilden.
Das Hinschmelzen der Berber in den Oasenländern
"Der Araber isst den Berber!" — lautet ein kleinafrikanisches Sprichwort. Es sagt die Wahrheit. Eine Oase nach der anderen, ein Landstrich nach dem anderen büßt das "Tamazirt" und "Schelha" (Berbersprache) ein. Die arabische Sprache ist fast überall siegreich. Der Vorgang ist charakteristisch. Die Araber sind zunächst Nomaden, die mit ihren Kamelen nur dann und wann in den von Berbern bewohnten Oasen auftauchen. Die Oasenberber hatten früher überall, und haben jetzt noch in den Gebirgsgegenden burgähnliche Wabendörfer inne, von denen aus sie in einem ununterbrochenen Kleinkrieg, in einem ständigen Streit der einen gegen die andren lebten. Sowie nun irgendwie eine arabische Nomadensippe, in den Streit hineingezogen, ein arabischer Priester zum Schlichten berufen oder aber eine bedrohliche Stammesschwäche dem Araber bekanntgeworden war, begann die arabische Vorherrschaft. Dann wurden die Araber die Herren der Berber; sie selbst zwar siedelten sich nicht in der Oase an, kehrten vielmehr in ihre Wüste in der Halbwüste und zu ihren Herden zurück, waren aber Besitzer der Oase geworden, und was der Berber in Zukunft nun auch im Schweiße seines Angesichtes erarbeitete, das musste er fürderhin dem Araber überlassen.
Nach der Ernte kam der Araber aus der Wildnis, um nach "seiner" Ernte Umschau zu halten und "seine" Datteln, "seine" Feigen, "seine" Gerste, "sein" Olivenöl in die Stadt zu führen und zu verkaufen. Nur das zum Leben Allernötigste behielt der Berberbauer. Der Berber, der früher selbst Sklaven und Hörige gehabt hatte, wird dergestalt selbst Höriger. War der Lohn des Fleißes und der Sorgfalt früher sein eigener, so floss er jetzt den Arabern zu. Die Oasenwirtschaft Nordafrikas mit ihrer kniffligen Berieselungswirtschaft, mit ihren sehr zartbesaiteten Bäumen fordert einen großen Aufwand an Fleiß und Sorgfalt. Sorgfalt und Fleiß ließen aber naturgemäß mit dem Aufhören des Besitzrechtes nach.
So findet man denn im größten Teil der Oasen eine Verwilderung der Bäume, Unregelmäßigkeiten in der Bewässerung, um sich greifende, weil nicht mehr künstlich gehinderte Versandung und Bodenverschlechterung. Wo noch vor wenigen Jahrhunderten mächtige Steinburgen stolzen Berberhäuptlingen als Sitz dienten, da wohnen verarmte Bauern in elenden Lehmbuden neben den Burgtrümmern. Wo einst kilometerlange Bewässerungskanäle durch üppige Pflanzungen führten, sprosst heute aus alten Kanalfugen kümmerlicher Kameldorn. Der stolze Berber bettelt in arabischer Sprache um einen Bakschisch.
Der Araber hat den Berber "gegessen"!
Dieser Vorgang spielt sich vor unseren Augen zwischen der Ammonsoase und der atlantischen Küste Marokkos ab. Das Berbertum schmilzt schnell dahin; der Vorgang wickelt sich umso schneller ab, je flacher das Land ist, je geeigneter für Kamelzucht; umso langsamer, je felsiger und gebirgiger und damit für die Viehzucht ungeeigneter. Am Nordrande Afrikas hat sich demnach das alte Berbertum in leidlicher Eigenart nur noch im östlichen Marokko und um das Djurdjuragebirge herum, in der sogenannten Kabylie erhalten. In Marokko haben nun die Berber aber jahrhundertelang unter islamischer Kaiserhoheit gelebt; in der Kabylie blieben sie dagegen selbständig — so selbständig, dass sie sich sogar der Herrschaft des hier einst so gewaltigen Byzanz zu entziehen vermochten. Erst den Franzosen gelang es, die Kabylen zu unterwerfen; auch ihnen war das ein schweres Werk.
Das aufsaugende Berbertum in der Gebirgskabylie
Der Djurdjura, ein gewaltiges Massiv, steigt östlich der Stadt Alger mit einer von ewigem Schnee und Eis bedeckten Spitze über 3200 Meter hoch empor. Tiefe Schluchten gliedern die Masse in Ketten und Reihen von Bergen. Die in 200 — 2000 Meter tiefen Schluchten abfließenden Wässer vereinigen sich im Sebau, der bei Dellis das Meer erreicht. Das Ganze ist ein Gebir gsland im wahrsten Sinne des Wortes. Die Berge der Kabylie sind aber auch ihrem Wesen nach und nicht nur ihren Dimensionen entsprechend gewaltig. Ihr Wesen aber ist so vollkommen unafrikanisch wie nur denkbar; das soll heißen: wer sich hier von Palmen und Baumfarren, von Licinen und sonstigen tropischen Charakterpflanzen umgeben denkt, ist im Irrtum. Eichen, Eschen, Eukalyptus, in den Gärten: Wein, Feigen, Ölbäume über Weizen und Gerste sind hier das Bezeichnende. Oftmals, wenn ich die kabylische Landschaft durchwanderte, hat sich mir der Gedanke aufgedrängt, ob nicht etwa diese pflanzliche Welt der großen Kabylie ebenso der letzte Rest einer ganz Kleinafrika einstmals eigenen Lebensform ist, der in diesen Bergen seine letzte Zuflucht fand, wie die Berber, die einst ganz Nordafrika bevölkerten und nun in völliger geistiger Reinheit nur hier noch erhalten sind.
Die Kabylen, die diese Gebirge bewohnen, haben ihren jetzigen Namen nicht immer geführt. Das Wort Kabyle stammt aus dem Arabischen und bezeichnet die Menschen, die ihre Sippen dorfmäßig zusammenfügen. Der Legende nach hießen die Kabylen früher "Amathir" (Plur.: imathieren). Sie haben selbst aber den Namen so gut wie vergessen, und ich fand ihn nur so nebenbei in einem Bruchstück ihrer uralten Schöpfungsmythe. Der Name Amathir ist aber der gleiche, den alle alten Berbervölker führen und der auch noch in dem Ausdruck "Temaschirt"-Schrift der Berber erhalten ist. Dem Geist der Sprache und auch wohl der Rasse nach sind die Kabylen Berber wie alle anderen Festsässigen der Länder nördlich der Sahara. Aber sie haben in ihrem Wesen einen Zug, der sie von den anderen ihrer Art trennt. Im vorigen Abschnitt zeigte ich das Hinschmelzen der Berber unter der arabischen Welle. Hier nun das Bedeutsame: Die Kabylen sind diesem Symptom nicht unterworfen; im Gegenteil: die Kabylen sind aufsaugende Berber!
Wir kennen verschiedene Araberstämme, die in die Kabylie verschlagen wurden; sie sind zu Kabylen geworden. Neger, Byzantiner (unter dem Namen suhaba), Römer (unter dem Namen aruma, Plur.: irumin), ja Franzosen sind in die Kabylie gekommen und zu Kabylen geworden. Ich betone: es handelt sich nicht um eine Hypothese, um einen oder mehrere Vorgänge der Vergangenheit und ganz und gar nicht um etwas Einmaliges oder Zufälliges. Hier stehen wir vielmehr vor einem eminent wichtigen Phänomen! Denn wie bedeutungsvoll ist dies: alle anderen Berber werden von einer jungen Welle resorbiert, so dass sie vor unseren Augen ihrer Art nach zerfließen; diese Kabylen aber sind die einzigen Berber, die ihre Art, ihr Wesen wahren und alles Fremde resorbieren!
Das Wichtige dieser Erscheinung wird sogleich verständlich, wenn wir nur das im Auge behalten, was ich im Anfange sagte: Das Berbertum ist eine Kulturform, eine Geistesart! Diese Geistesart ist innig verbunden mit pflanzenartiger Haftfähigkeit. Sie geht zugrunde, wo, wie in den meisten Länderstrichen Nordafrikas, die Kulturfläche schwindet und der Wüste Platz macht. Sie gedeiht ungestört und unzerstörbar weiter, wo durch die Natur der so weithin siegreichen Wüstenfortbildung eine Schranke gesetzt ist. — So bedeutet denn das Gebirgsland um den stolzen Djurdjura für mich gleichsam eine Insel, auf der sich der letzte Rest alten Berbertums in seiner ganzen Art erhalten hat. Deshalb gilt das, was wir heute an den Kabylen noch feststellen können, nicht anders als: Wesenszüge jenes Berbertums, das zur Zeit einer noch nicht verdörrten und verwüsteten Natur wohl ganz Nordafrika innehatte. Das Kabylentum bedeutet, von solchem Gesichtspunkte aus gesehen, also die Erhaltung einer uralten archaistischen Art. Es kann in seiner insularen Verbreitung in Parallele gesetzt werden zu jener kleinen Insel archaistischer Pflanzenformen, die nördlich der Kapstadt als Heimatsrest einer einst weit ausgedehnten Pflanzendecke erhalten ist. Dabei bedeutet mir diese Pflanzendecke, wie diese kabylische Kulturform nicht etwa nur (um es chemisch auszudrücken) eine Summe von Elementen, sondern hier wie da haben wir es mit einem "Körper" zu tun.
Und sicher: der kabylische Kulturkörper ist in seiner ehrwürdigen, uralten Art mit seinen archaistischen Ein- und Auswirkungen wohl erhalten, wenn im Laufe der Zeit auch noch so vielerlei junge Decken darüber geworfen wurden. Es spielt gar keine Rolle, ob den Trägern dieser Kultur ein paar hundert Vandalen zugefügt wurden, ob einige Tausend Römer, Byzantiner, Araber oder Türken und heute auch Franzosen dazukamen, ob das Altertum ägäische Kleiderformen, das Mittelalter den Islam und die Neuzeit moderne Bauteile zuführte. Unter dem neuen Gewände ist noch das alte Kleid erhalten; unter der Decke des Islam konnte ich noch die ganze alte berberische Schöpfungslehre, unter den aus Frankreich eingeführten Dachziegeln die alte Tektonik finden.
Unendlich Vieles und allerhand Fremdartiges ist dem Uralten zugefügt. Aber die kabylische Kulturform erweist sich bei jedem näheren Zuschauen als eine aufsaugende und stilbildende. Sie nimmt das Neue, baut es aber nach seinem seit uralten Zeiten eigenen Stil um.
Früher Kasten, jetzt Parteien
Die Sippen- und in den Sippen die Altersklassengruppierung stellen die Grundlage alles altkabylischen Gesellschaftswesens dar. Eine Gruppe von Sippen bildete die Gemeinde, die Zusammenfassung der verwandten Gemeinden den Stamm, ein Zusammenschluss mehrerer Stämme führte zur Bildung eines Bundes (= tach'ebilt). Staatenbildungen in unserem Sinne gab es nicht. Ein kabylischer Fürst europäischer Art wäre den Berbern überhaupt auf die Dauer eine Unmöglichkeit, und so sehen wir denn auch alle Versuche des Altertums, Dynastien zu bilden, immer wieder scheitern, nachdem sie ganz formell und äußerlich unter dem Einfluss fremder Mächte ein mehr als problematisches Scheinleben geführt hatten.
Jedes Dorf hat aber seinen Führer, der heute mit dem arabischen Wort Amin (Emir) bezeichnet wird, der früher aber der Agelith war. Der Amin wird gewählt. Ihm zur Seite treten die Tamen, das sind die Führer der Sippengruppen. Dazu kommen dann noch die ebenfalls gewählten Führer der Bünde und die aus persönlichem Einfluss herausgewachsenen Führer des ausgesprochenen Parteiwesens. Also alles zusammengenommen: nicht eine einzige erbliche Stellung, sondern alles auf Zutrauen und Persönlichkeit beruhend und nach jeder Richtung einem jeden äußerste Selbständigkeit gewährend. Indem die Sippen sich zu Dörfern, diese sich zu Stämmen und diese sich wiederum zu Bünden vereinigen, ist eine Richtung zu höheren Gesichtspunkten geboten, weshalb wir diese dem Sippen- und Männerklassenwesen erwachsende Linie als die senkrechte bezeichnen wollen. Das Bundwesen ist das Leitmotiv in der Gruppierung der Altersklassen eines Sippenverbandes, wie in der der Stämme zu umfassenden Bünden.
Diese senkrechte Entwicklungslinie wird aber geschnitten von Gliederungen und einer anderen Idee des Gesellschaftslebens, deren Wirkungsrichtung ich, da er die erstere kreuzt, als den waagerechten Werdegang bezeichne.
In sehr alten Zeiten waren die Kabylen wie alle Berber in Kasten gegliedert. Man wird der Bedeutung der verschiedenen Spielformen wohl am besten gerecht, wenn man von vier Echrumen (Sing.: achrum) spricht.