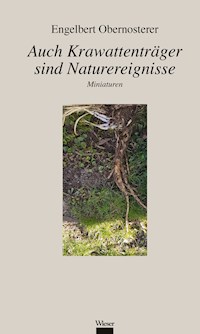
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wieser Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wie schon in früheren seiner neunzehn Prosa-Bände geht der Autor in seinem neuen Miniaturen-Band den als bekannt geltenden Vorgängen des Landlebens nach im Bestreben, die allzu fest stehenden Zustände geistig wieder locker zu stellen und für eine andere Sichtweise frei zu machen, eine meist desillusionierende, kühl registrierende, aus unmittelbarer Nähe aufgenommene. Den Stoff bezieht der Autor sowohl aus der direkten Umgebung wie auch aus der erinnerlichen Kindheit im Gebirge und den dortigen Naturereignissen, zu denen auch die Naturen einzelner Bewohner gehören. Die Achse, um die sich die Studien drehen, ist "ein schrottreifer Altpädagoge", der sich als bedingt im Sinne von determiniert erlebt und dessen Mechanik des Verhaltens aus nächster Nähe beobachtet und durchleuchtet wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ENGELBERT OBERNOSTERER
Auch Krawattenträger sind Naturereignisse
Prosa-Miniaturen
Die Herausgabe dieses Buches erfolgte mitfreundlicher Unterstützung durch das Land Kärnten.
A-9020 Klagenfurt/Celovec, 8.-Mai-Straße 12
Tel. + 43(0)463 370 36, Fax + 43(0)463 376 35
www.wieser-verlag.com
Copyright © dieser Ausgabe 2019 bei Wieser Verlag GmbH,
Klagenfurt/Celovec
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Josef G. Pichler
ISBN 978-3-99029-369-0
eISBN 978-3-99047-104-3
Abgesehen von den Notwendigkeiten der Existenzerhaltung besteht mein Leben darin, dass ich mich entspannt zurücklehne und registriere, was mit mir und rings um mich geschieht.
Alles, was mit mir geschieht, geschieht auf seine Weise, nicht auf meine.
Inhalt
Auch Krawattenträger sind Naturereignisse
He, du, schrottreifer Altpädagoge, du allwissender, rüttelt einer im Wirtshaus an meiner Schulter, kannst du mir sagen, warum – glotz nicht so blöde! – wa-rum, ich, ein Mensch, der niemandem etwas getan hat, warum ich eigentlich da bin, da hier bei euch Langweilern … so ähnlich redet er, beziehungsweise lallt er auf mich ein und verfällt in ein geradezu ernsthaftes Grübeln, warum es mit ihm denn so weit gekommen sei, warum gerade er so einer geworden sei, wie er nun einmal geworden ist, mehr breit bereits als hoch, ein alter, zu nichts nützer Krauterer, der schon lange nicht mehr in den Spiegel schauen wolle, es sei denn, um die Krawatte zurechtzurücken. Nie, zu keiner Zeit hätte er so einer werden wollen, wie er hier da sitze bei seinem lauwarmen Achtel, nicht einmal ein Säufer sei er geworden, geschweige denn ein Bösewicht! Solche Mixturen aus abgestandenen Üblichkeiten habe er von Kind auf verachtet.
He, hörst du mir überhaupt zu? Dann sag mir doch, du Schmalspur-Philosoph, warum das alles so gekommen ist.
Ich greife nach meinem Achtel und nehme verlegenheitshalber einen Schluck davon. Meistens, wenn ich nicht weiter weiß – und das geschieht mir ziemlich oft –, überbrücke ich die Kluft mit einem Getränk. Zu Hause ist es der Merlot aus der Fünf-Liter-Packung oder etwas aus dem Kühlschrank, was zur Folge hat, dass rund um meine Leibesmitte sich so einiges angesammelt hat, von Verlegenheit herrührender, mich belastender und befremdender Papp. Im Übrigen stecke ich wohl in einer ähnlichen Misere wie er, der mit mir immerhin Geschlecht, Alter und derzeitige Situation gemeinsam hat.
Sieht ja wirklich verfahren aus, diese Akkumulation, aus der heraus mich das dazugehörige Augenpaar um eine Antwort anfleht. Ich krame in den Resten meiner etymologischen Kenntnisse. Warum, das dürfte wohl aus dem Fragesatz Was (ist) herum? zusammengezogen worden sein, also auf die Frage hinauslaufen: Was befindet sich rings um den Fragesteller, was be-dingt ihn?
Nun, das wäre immerhin eine Frage, der man nachgehen könnte. Auch in meinem Fall. Dass ich mich, wie nun folgt, mehr für meine als für seine Bestimmungsstücke interessiere, hat seinen Grund einzig darin, dass ich die meinen besser kenne. Darüber hinaus handelt es sich in beiden Fällen um nichts Besonderes, sondern um so alltägliche Situationen, dass man sie normalerweise gar nicht der Rede wert findet.
Bisher habe ich mich mit der Einschätzung meines Aussehens selbstgefälligerweise an den Fotos meiner mittleren Jahre orientiert und bin damit ganz leidlich über die Runden gekommen. Gewiss, es gibt ebenmäßigere, imposantere, sympathischere Anordnungen von Augen, Nase und Mund; im Großen und Ganzen schien aber auch meine Gesichtsausstattung auf einen Menschen hinzuweisen.
Gestern habe ich mich davon verabschieden müssen. Ich habe nämlich das Foto eines seriösen Porträtfotografen bekommen: eine detail- und nuancenreiche Aufnahme. Schrecklich! Das ist die Wende, ist der Abschied von der alten Selbsteinschätzung. Wo einmal das Menschliche für einige Zeit seine Zelte aufgeschlagen hatte, da herrscht nun ein Zerbröseln, Zerklüften und Erodieren von gleicher Sachlichkeit wie auf dem Mauerstein des Hintergrundes. So wie ich beim Blick auf irgendeinen Ausschnitt der nordafrikanischen Wüste nicht sehe, welchem Land dieses Geröll zuzuordnen ist, sehe ich auch in diesem beiläufig herumliegenden Nasentrumm, der seitlich davon abwärts verlaufenden Einfurchung und den umliegenden Buckeln und Mulden nicht, dass das etwas mit meinem Namen zu tun haben sollte. Das Foto lässt mir, wie ich mich bisher selber gesehen habe, keine Chance. Ein kreuz und quer zerfurchtes Gelände, ein ständiges Hoch-Tief als Ergebnis des Geschiebes, das früher einmal mit glatter Haut überspannt war, nun aber die Abdrücke der darunter herrschenden Spannungen ans Tageslicht kommen lässt.
Alles zusammen lese ich als eine Dokumentation und Summe dessen, was in mir im Laufe der Jahre vorgegangen sein mag, wovon ich das meiste, um meine Mitmenschen nicht zu erschrecken, unter die Decke einer glatten Visage zu kehren versucht habe. Wie das Foto zeigt, ist mir das nicht gelungen; aus hundert Unebenheiten hebt es nun sein Medusenhaupt aus der Dunkelheit.
Schön ist so etwas wahrlich nicht! Aber wahr! In diesem Sinne begrüße ich die Offenlegung meiner bisher notdürftig verdeckten inneren Vorgänge.
Im Ganzen fühle ich mich einigermaßen normal und unauffällig, zumindest war das in den mittleren Jahren der Fall. Kann natürlich sein, dass ich seither es verabsäumt habe, meine Begriffe den laufenden Veränderungen, insbesondere den Folgen des unvermeidlichen Abbaus der Kräfte anzugleichen.
Diese Befürchtung befällt mich eines Morgens, als, von den Händen auseinandergehalten, einen Moment lang der geweitete Bund der Hose vor mir aufklafft, in deren Röhren ich hineinsteigen soll. Was für eine befremdend hässliche, unappetitliche, abstoßende Grube dieser Gesäßbehälter, ein unförmiger Krater, den sich die im Laufe der Jahre angefallenen Bestände hier ausgebeult haben!
Der Spiegel verschont mich auch nicht vor dem Anblick meines Bauches, dieser hässlich sich nach vorne wölbenden Kalotte. Von ihr aus betrachtet, hockt sie durchaus daseinsfreudig auf meinem Becken und verlangt knurrend und ohne Rücksicht auf das sich bietende Gesamtbild unbarmherzig wieder nach Stärkung, diese selbstsüchtig gewordene Akkumulation. Von ihr aus verständlich, es naht ja wieder eine Essenszeit, wo ich dem wacker arbeitenden Verdauungstrakt allerlei Bekömmliches zuzuführen pflege. Bis mich, vom dazugehörigen Bier schwer gemacht, die Müdigkeit erfasst und ich beseligt zur Seite sinke.
So läuft das diesmal nicht. Du Sau, du, schimpfe ich den unverschämt vorgewölbten, selbstgefällig in der Leibesmitte sich breit machenden Leibeshügel. Du kriegst heute gar nichts, verstanden, gar nichts!
Da zieht er sich aber beleidigt ein, zwei Zentimeter zurück.
Meine alten Fotos kehren allesamt eines hervor: wie ich sein wollte, wenn ich eine Kamera auf mich gerichtet sah: sympathisch, seriös, natürlich, interessant, nachdenklich und so weiter. Nicht anzusehen diese vermutlich auf irgendwelche Komplexe zurückgehenden Grimassen! Erst seit ich weiß, wie sehr sie ins Leere gehen und meine Gesichtsgewebe mit dem nicht mehr mitmachen, wie ich Komplexler den anderen erscheinen möchte, bemerke ich einen überzeitlichen Zug in der Gesichtslandschaft: den der Gravitation: etwas weit über die Person Hinausreichendes. Indem ich ihn in meinem Spiegelbild hervortreten sehe, geht von ihm eine wohltuende Ruhe aus, denn die Gesichtsgewebe, die im Alltag je nach Situation hin und her gerissen wurden, nähern sich nunmehr der Ernsthaftigkeit und Würde eines Steines.
Ich habe keine Kraft mehr, bin müde, lustlos: ein unbrauchbar gewordener, zum baldigen Austausch bestimmter Bestandteil der großen Landmaschine. Am liebsten möchte ich den ganzen Tag im Bett bleiben, zu den Mahlzeiten pro forma etwas essen, dem Abend zu mir etwas Flüssiges suchen, was mir über den toten Punkt hinweghilft.
Da ruft man nach mir. Ich müsse dringend in die Stadt, die Zutaten für den Hollersirup besorgen. Ich staune, wie frisch ich auf einmal bin. Die Landmaschine hat mich doch noch einmal als kleines Rädchen für ihr unbeirrbares Dahinrattern verwendet und ich genieße es, wie viel Schwung sie mir auf einmal verleiht.
Während mir die Mitmenschen zusehends unverständlicher, fremder und abweisender erscheinen, wächst mir mein PC mehr und mehr ans Herz. Geduldig disputiert er mit mir über einzelne Textstellen, sträubt sich gegen unpassende Formulierungen; manches, was ich ihm anvertraue, nimmt er zwar stirnrunzelnd auf, aber nur bis zur nächsten Durcharbeitung, anderes stößt er von sich, will es nicht auf dem Bildschirm dulden, schilt mich einen Stümper und Hohlkopf, zeigt sich aber bereit, auf sachlicher Ebene mit mir weiterzumachen.
Ich arbeite manchmal ziemlich verbissen, strenge mich an, spanne meine bescheidenen Kräfte und Fähigkeiten auf gewisse Ziele hin an. Was dabei herauskommt, naja: aus einigem Abstand betrachtet, doch sehr nach Schule riechendes Zeug.
Wenn ich damit nicht mehr weiterkomme, vertrolle ich mich aus dem Schreibzimmer, über die Stiege hinab vors Haus und setze mich, die Füße frei vom Leib gestreckt, die Arme seitlich herabbaumeln lassend in den Gartensessel und lasse geschehen, was geschieht.
Und horch, es arbeitet in mir, arbeitet natürlich anders, als ich es von mir aus täte, arbeitet ohne Ziel und völlig ungeschult. Dieser Art von Arbeit gegenüber könnte man schon die Lust verlieren, von sich aus zu arbeiten.
Ich als Zentrum und Bezugspunkt eines nach außen hin offenen Feldes, das sind weniger die in meinen Personaldokumenten aufscheinenden Daten, es sind, um ihnen endlich einmal die gebührende Ehre zu erweisen, die Vorgänge in den Zellen und Zellkolonien mit ihrem eigengesetzlich ablaufenden Stoffwechsel und verlässlichen Energielieferungen unter anderem herauf ins Zerebrale.
Vielen, vielen Dank an all die selbstlosen, mir nur vom Hörensagen her bekannten Teilkräfte, die am Zustandekommen und der Aufrechterhaltung meiner Person beteiligt sind. Zu ihnen, die im Unsichtbaren rackern, bekenne ich mich, ihnen gestehe ich die drei Buchstaben ich zu.
In der ungeheuren, an die Ewigkeit gemahnenden Schweigsamkeit der Gebirge, aus denen ich komme, hat das Reden nie viel bewirkt. Eine mit dem Verlauten schon wieder verwehende Vordergründigkeit war es, ein durchsichtiger Lautvorhang, wahr nur für Sekunden.
Dort, in der Abgeschiedenheit, machen sich die Dinge ihre Lage unter sich aus. Gerät der Fuß ins Abschüssige, stellen Gelenke und Sehnen sich automatisch auf die jeweilige Winkelung ein und geben Halt. Fällt Schnee, kommt die Schaufel zum Einsatz; bei Kälte Wollhandschuhe und wüste Kopfbedeckungen, so wie bei der sommerlichen Hitze kühlende Getränke.
Was einigermaßen feststeht, sind die 36,8 Grad Celsius. Um sie aufrechtzuerhalten, erfordern die Außentemperaturen vom Organismus entsprechende Reaktionen. Hitze treibt in den Schatten, dazu braucht es keine eigene Intelligenz; das ist ein Ausgleichsvorgang, nicht mehr. Dabei dürfen die Betroffenen es ruhig so sehen, dass sie es gewesen seien, die den Schatten aufgesucht hätten.
Mit den Augen eines Physikers betrachtet, beruhen Warentausch, Handel und politische wie auch zwischenmenschliche Beziehungen auf der natürlichen Tendenz zum Ausgleich zwischen Ungleichem.
Das spüre ich, als ich einer meiner ehemaligen Schülerinnen, ohne ihr schmeicheln zu wollen, sage, dass sie seinerzeit bemerkenswerte Aufsätze geschrieben habe. Sie errötet und weiß nicht recht, wie sie darauf reagieren soll, befreit sich aber aus der ungleichen Verteilung des Lobes, indem sie mir ein paar faktisch kaum verdiente Lobesworte zurückgibt. Wahrscheinlich hätte sie diese nicht aus der Gesamtheit der Erfahrungen mit mir ausgesucht, wenn sie sie nicht als Ausgleich und Entgelt gebraucht hätte.
Ich habe geschrieben. Innerlich leer, begebe ich mich die Stiege hinunter, wo soeben ein Besuch angekommen ist: hoch gestimmt durcheinanderschnatternde Verwandte, Partikel eines nicht besonders bekömmlichen Meinungsbreis.
Als ich mich unauffällig wieder in mein Schreibzimmer verdrückt habe, braut sich etwas Ungutes in mir zusammen: So etwas wie ein Schuldgefühl ihnen gegenüber, ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht in den Brei habe einkneten lassen.
Aus der Erwerbswelt in die Pension entlassen, erübrigt es sich eigentlich, sich für etwas zu erhitzen, Partei zu ergreifen, sich für oder gegen jemand einzusetzen. Recht oder nicht recht, das war einmal, daran kann ich mich erinnern, ebenso an Objekt und Subjekt. Je mehr ich mich aber in meiner neuen Lage umsehe, desto mehr fallen die Unterscheidungen wieder in eins zusammen.
Von einem Gegenstand zum anderen geschoben tschure ich um mein altes Bauernhaus. Seine Pflege und Bedienung erfordernden Verrichtungen hängen mir längst zum Hals heraus, ich bin ihrer müde. Wie ich am Vormittag an der südseitigen Stadelwand Holzscheit auf Holzscheit aufgeschlichtet habe, reihen sich nunmehr die Sekunden als bloße Zeitstücke aneinander. Ich bräuchte etwas Anderes, mich Erfrischendes, eine Fahrt in die nahe Kleinstadt zum Beispiel.
Bald sitze ich in einem Korbsessel vor dem Café am Hauptplatz, meine Vorderseite der Straße zugewandt. Herrlich die zerhackten Eindrücke von bewegten Objekten: abwechslungsreiche, nur kurz akut werdende Reize, durch die Geschwindigkeit so leicht gemacht, dass sie nie zur Schwere von Gegenständen verkommen, für mich nur noch Lichtimpulse.
Bis das eintritt, was ich insgeheim befürchtet habe: Ein Passant kommt auf mich zu: ziemlich massiver Typ, gehabt sich als guter alter Bekannter, begrüßt mich flüchtig mit der leidigen Frage, wie es mir gehe und so weiter. Ich bin froh, dass er es eilig hat und sich bald im Geflimmer der zerhackten Eindrücke auflöst.
Ein Tagesausklang mit würziger italienischer Salami, Essiggurkerln und Zirbenschnaps. Vor allem mit dem! Unwiderstehlich, wie der sich im Gaumen entfaltet und über seine Gewölbe hinrollt, nicht so unkultiviert wie der Obstler aus der Literflasche. Nuancenreich entwickelt er sich und erzählt von seiner Herkunft aus Gebirgslagen mit mineralischen Böden, im Abgang spürbar das Raue der dortigen Witterung, wobei einem dermaßen wohl wird, dass man selbst auf die Gefahr hin, am nächsten Morgen unbrauchbar zu sein, noch einen nachschenkt und noch einen letzten.
Hah!
Wie anders, wie neu die Umgebung plötzlich erscheint! Was mich noch vor Kurzem fest in der Hand hatte, die Stumpfsinnigkeit der anstehenden Verrichtungen, sie haben mich in die Freiheit entlassen. Wie ein rücksichtsloser Despot schaut das neue Gefühl zurück auf sie, laut lachend, dass es durch die Räume hallt. Was soll der mutlose Gedanke, dass am nächsten Vormittag ein Termin ansteht, von dem einiges abhängt! Ihr könnt mich alle, kriegen die kleinmütigen Reflexe eine Abfuhr. Mit dem nächsten Schluck sind sie weggespült, dem herrschenden Hochgefühl gleichgültig; nicht näher sind sie ihm als die Bewohner eines fremden Kontinents. Sollen selber zusehen, wohin sie kommen mit ihrem Kleinklein. Mag ja einen Zusammenhang mit dem geben, der man die meiste Zeit über sein muss, aber den bewerkstelligen ohnehin die Automatismen.
Das Geld kommt am Ersten, streift mich kurz und fließt ohne nennenswerte Verzögerung weiter. Könnte ruhig ein bisschen bleiben; ich hab es gar nicht ungern. Aber wie bei den liebsten Gästen, die meist nur kurz einmal vorbeischauen, lässt es sich nicht länger aufhalten.
Unterwegs tut es allerlei Gutes. Ungut wird es nur, wo es gegen seine Natur am Weiterfließen gehindert wird: bei Geizkrägen, Knauserern und solchen, die ihm mit Haut und Haar verfallen sind.
Ein solcher ist mir aus früheren Jahren im Gedächtnis geblieben: Auf einer Tagung für Junglehrer referierte er eindrucksvoll in seiner Kompetenz über das neue Gehaltsschema, über Ruhegenussvordienstzeiten, Zulagen und Abgaben sowie die derzeit günstigsten Sparvarianten und Kapitalveranlagungen. So sehr er sich seines profunden Wissens freute, ich konnte nicht länger hinsehen: Er hatte ein mir hässlich erscheinendes verknautschtes Gesicht, eine Endmoräne des Menschlichen, wie mir schien.
Ähnlich wie mit dem Geld verhält es sich mit gewissen Stoffen, die durch mich durch wollen. Sie lachen mir manchmal von Weitem entgegen, zum Beispiel als Tortenstück. Rosafarben blinzelt es mir durch das Glas der Vitrine hindurch zu, regelrecht anzüglich, kommt an meinen Tisch, will gleich wieder weiter, kommt aber nicht weiter, bleibt in mir stecken: im Speck der Leibesmitte. Schon lange bevor ich selber zu einem solchen Staubereich geworden bin, habe ich Bäuche verachtet, seinerzeit aus ästhetischen Gründen, heute, wo ich selber ein Schuttkegel der Lebensmittelschwemme geworden bin, schwöre ich allen Bauchungen nur noch im Geiste ab: als dem Ende des Fließens.
Gegen Ende des Sommers hat die Sense ihre Schärfe verloren. Wegen des kleinen Hanges, der noch einmal gemäht werden soll, steht es kaum dafür, sie noch einmal zu dengeln, zumal die Schärfe über den Winter durch Oxydation ohnehin weiter abstumpfen wird. So schlage ich denn, anstatt die Sense in gefühlvollem Bogen zu schwingen, dem von einem Starkregen in den Boden gewaschenen Rindergras nur da und dort die Spitzen ab. Durch sein Verhalten gibt das sich unter der Sense wegduckende Gras mir zu verstehen, dass ich ein Blindgänger und Versager sei, ein Nichtkönner, der sich möglichst bald einen dieser jaulenden Motormäher anschaffen sollte.
Etwa zur gleichen Zeit haben die Reifen des Fahrrads Luft verloren, wodurch sie besonders auf der langen Steigung vor meinem Hause mir zusätzliche Anstrengungen abverlangen und mich schon mehrmals zum Absteigen gezwungen haben, an einer Stelle wohlgemerkt, wo ich bis dahin noch nie aus dem Sattel gestiegen bin. Irgendeinmal gibt es eben diese unvermeidlichen Hinweise auf das Alter, in meinem Fall äußerst sachlich und schonungsvoll dargelegt von Rad und Sense.
Ich bin einer der letzten Radfahrer der Gegend. Um das schmerzhaft Anstrengende bei längerem Aufwärtsfahren in den Hintergrund zu drängen, habe ich meine eigene Methode entwickelt, wenn ich von der ebenen Bundesstraße bergwärts abbiegend das letzte Stück zu meinem Haus in Angriff nehme. Wie ich einmal gezählt habe, braucht es von dort weg etwa sechzig Kurbelumdrehungen bis zu meinem Haustor, wobei ich bei den ersten Umdrehungen mich darauf konzentriere, locker und entspannt zu bleiben. Wo das Straßenstück deutlicher ansteigt, achte ich darauf, dass das jeweils aufwärts bewegte Bein die Pedale ja nicht belastet, weil das – ein häufiger Fehler bei Radfahrern – die vom anderen Bein aufgewendete Energie vermindert. Sofern ich einigermaßen bei Kondition bin, sollte ich bei Umdrehung zwanzig noch locker sein, andernfalls verwende ich die nächsten Umdrehungen darauf, Vermutungen anzustellen, ob es der Alk vom Vorabend war, ein zu schweres Essen mich geschwächt hat oder was das Schlimmste wäre, das Alter beginnt, seinen Tribut zu fordern. Sowie das steilste Stück beginnt, sollte ich noch nicht mehr als dreißig Umdrehungen benötigt haben. Ab jetzt geht es in kleinen harten Rucken, Tritt für Tritt, aufwärts: vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig … Die Zahlen lassen inzwischen leider einiges von dem in den Vordergrund dringen, wovon sie ablenken sollten: die schmerzhaft krampfigen Anstrengungen. Dem letzten Drittel zu, dem ich mich nun mit gebirglerischer Zähigkeit nähere, weht mir bereits die Vorfreude entgegen, es bald hinter mir zu haben.
Nachdem ich, im besten Fall schon vor der sechzigsten Umdrehung, aus dem Sattel steigend, zu zählen aufgehört habe, will wieder das schmerzhaft Anstrengende in den Vordergrund treten. Aber da schiebe ich rasch etwas Angenehmeres davor hin: die Erleichterung, es allen Befürchtungen zum Trotz wieder einmal geschafft zu haben.
Vorige Woche habe ich von einem meiner Nachbarn Holz geschenkt bekommen, schönes Hartholz, das, bereits auf Ofenlänge zerschnitten, im Walde verstreut herumliegt. Ich freue mich natürlich, obwohl meine Holzhütte bereits für mehrere Jahre Vorrat enthält.
Was das Brennholz anlangt, hätte ich somit wohl für den Rest meines Lebens ausgesorgt, überschlage ich meine Brennholz-Situation. Für zwei, drei Winter dürften die im Wald liegenden Prügel reichen, dazuzurechnen etwa das gleiche Quantum, das bereits in der Hütte liegt. Dann aber, nach fünf, sechs Jahren, wird es brenzlig für mich als Mann, der dann bereits Mitte achtzig ist. Wie es dann weitergeht, mit dem Holz wie auch meinem Dasein, bleibt somit offen. Das scheint auch der Nachbar zu spüren. Er will mich aber nicht so bald abservieren, der Taktvolle, und rettet mich, verbal zumindest: Er habe noch für mehrere Jahre Holz im Wald; mein Neunziger sei somit gesichert.
Ja, mag sein, rein holzlich vielleicht, füge ich hinzu, glitsche mit meinen Vorstellungen aber doch übers Holzliche hinaus.
Im Turnsaal unseres kleinstädtischen Gymnasiums. Während wir fünf Hobbyfußballer als Aufwärmung für die bevorstehende Kickerei verspielt mit dem Ball herumkünsteln, wärmt sich unser Sechster, seines Zeichens Psychologe, unverheiratet und im Besitz mehrerer Immobilien, nach sportmedizinischen Erkenntnissen auf. Er beginnt mit betont lockerem Laufen im Kreis, alle vier Schritte ein hörbarer Atemstoß, die Augen geschlossen, auf dem Gesicht Sorge ob der bevorstehenden Belastung. Nach einigen Runden steigerte er sein Dahintrollen etwas; die Aufmerksamkeit noch immer auf das richtige Zusammenspiel zwischen Schritt und Atem gerichtet, hebt er bei jedem vierten Schritt kurz und energisch das Knie an, gedanklich anscheinend mit der Frage befasst, ob dies das optimale Maß zwischen dem zu Langsamen und dem zu Schnellen sei. Die Miene zeigt, dass es da um etwas geht: um eine solide Leistung beim bevorstehenden Match, vielleicht auch um eine erhoffte Leistungssteigerung, auf jeden Fall aber um das Vorbeugen gegen Muskelschwund und Altersstarre, wie sie die meisten seiner Altersgenossen bereits erfasst haben.
Als wir anderen schon ein Spielchen angehen wollen, ist er erst beim Dehnprogramm. Wir sehen es ihm, der unsere Ungeduld nicht bemerkt, an, wie wichtig ihm die korrekte Abwicklung des Programms ist. Also ballern wir noch eine Weile gegen die Wände, indes er, jetzt um die Knöchelpartie besorgt, diese vorsichtig durch Sidesteps testet, vor seiner Stirne das gefürchtete Verknöcheln und der jederzeit mögliche Bänderriss …
Ärgerlich diese schwerleibige, kreuz und quer durchs Zimmer brummende, schon zum wiederholten Mal auf meinem Handrücken zwischenlandende Fliege, die letzte des Jahres hoffentlich! Die Müdigkeit und Schwerfälligkeit ihrer Flugbögen führt mir zu sehr meine eigene vor, so dass ich mich aus dem Fernsehstuhl aufrapple, um, die Klatsche in der vorgestreckten Rechten, der Störung ein Ende zu bereiten. Zu kurz nur gönnt die Schwerleibige sich auf der Fenstersprosse eine Rast, hinter ihr saust die Klatsche ins Leere, beziehungsweise aufs Glas. So gravitätisch sie auch an meiner Nase vorbeipropellert, Hand und Auge erweisen sich mehrmals als zu plump, um ihren doch recht schlingenreichen Flugkurven zu folgen. Nach jedem meiner Fehlschläge höre ich förmlich ihr Hohnlachen. Na warte nur, verhöhnen lasse ich mich nicht!
Endlich setzt sie sich wieder, diesmal auf die Mattscheibe des Fernsehers, die helle, warme, wo gerade Sepp Forcher seinem Publikum eine der wunderschönen Alpenlandschaften zur Bewunderung anbietet. Klatsch! Getroffen! Da hast du’s jetzt! Von der ganzen Unverfrorenheit nur noch eine ekelige Verschmierung im unteren Teil der Scheibe, wo inzwischen ein gemischter Chor Aufstellung genommen hat, so dass die Schliere aus Gallerte und Chitin sich über die blütenweißen Blusen der Sängerinnen schmiert.
Meines Wissens bin ich der Letzte im weiteren Umkreis, der bei einsetzender Dämmerung mit einer emaillierten Zweiliter-Milchkanne sich auf den Weg zum zehn Minuten entfernten Milchbauern macht, wobei ich in den Augen derer, die mir nachschauen, durch mein melancholisches Dahintrotten der Abendstimmung einen spezifischen Akzent verleihe.
Weil der alte Brauch zugleich mit mir zu Ende gehen dürfte, so denke ich unterwegs auf der Geraden, läge es doch nahe, mich nach meinem Ableben als letzten Milchholer auszustopfen: den Kopf leicht gesenkt, die wenigen Haare vom Wind zerzaust, in der Rechten die Zweiliterkanne, von der, wo der Boden in die seitliche Ummantelung übergeht, schon einiges Email abgesplittert ist.
So etwas würde gut ins hiesige Heimatmuseum passen. Man müsste das Vorhaben ja nicht eins zu eins ausführen; es genügt vorerst die Vorstellung davon.





























